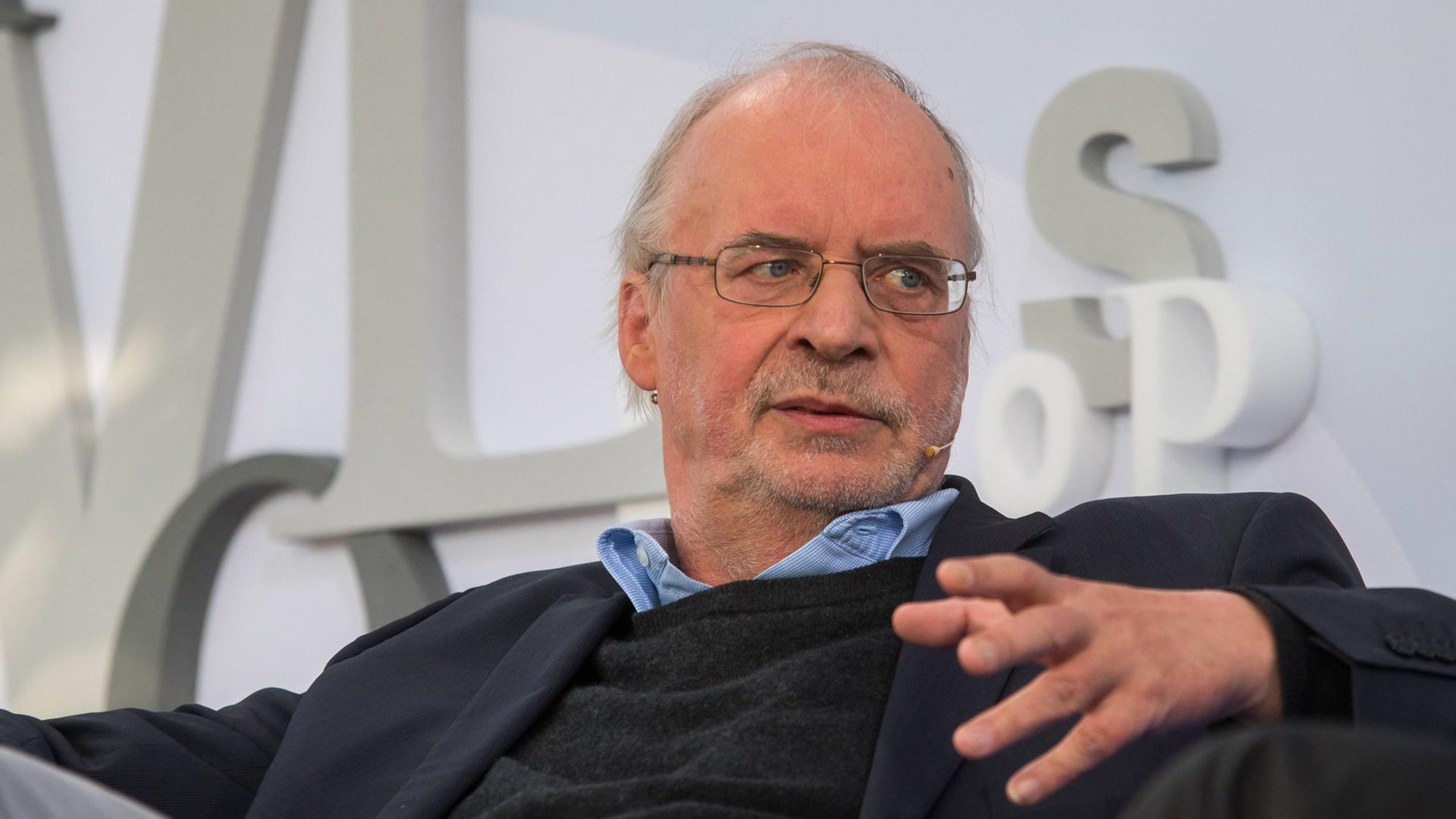Die aktuellen Zahlen der Autoritarismus-Studie der Universität Leipzig lassen aufhorchen. Demnach befürworten immerhin sieben Prozent der Ostdeutschen die Schaffung einer rechtsautoritären Diktatur, im Westen sind es 2,7 Prozent. Rund ein Drittel der Ostdeutschen vertreten der Studie zufolge eine "manifest ausländerfeindliche Einstellung", gegen ein knappes Viertel im Westen. Durchlebt der Osten Deutschlands eine Krise von Demokratie und Rechtsstaat? Die methodisch umstrittene Untersuchung der Uni Leipzig scheint dies nahezulegen. Aber wie erklärt sich der Erfolg rechtspolitischer Bewegungen im Osten? Das Phänomen allein auf das Fehlen einer demokratisch gesinnten Zivilgesellschaft zurückzuführen, lehnt der Berliner Historiker Raiko Hannemann entschieden ab.
"Da kam eigentlich immer wieder die Idee, die Ostdeutschen hätten einen gewissen Nachholbedarf, sie wüssten nicht, wie man Demokratie macht, sie hätten nie Zeit gehabt, eine Zivilgesellschaft zu entwickeln. Und da – auch in meinen Forschungen – muss ich wirklich klar widersprechen. Ich glaube, dass die Friedliche Revolution 1989 gar nicht möglich gewesen wäre, wenn es nicht genügend Zwischenräume gegeben hätte in der DDR. Gerade in der Zeit Honeckers, gerade in den 80er-Jahren mit den vielen Jugendsubkulturen und was es da schon alles gegeben hat. Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre ’89 gar nicht möglich gewesen, das muss man wirklich klar sagen. Das kam ja nicht aus dem Nichts."
Zwar hat es in der DDR keine freie Presse und keine organisierte Regierungsopposition gegeben. Dennoch sei Kritik und Diskussion in den Nischen der Gesellschaft, in Kirchen, Subkulturen, privaten Zirkeln oder auch staatlichen Kultureinrichtungen durchaus möglich gewesen, so Raiko Hannemann. Derzeit untersucht er in einem wissenschaftlichen Projekt im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wieso Menschen in Ostdeutschland sich vom demokratischen Gemeinwesen abwenden.
Unzufriedenheit mit Treuhand und Elitenaustausch
"Ich habe den Eindruck, dass nach den Erfahrungen der frühen 90er-Jahren, als man versucht hat, in dieser bundesdeutschen Demokratie mitzumachen, also für eigene Interessen einzutreten, sich zu engagieren, zu demonstrieren, dass da eine ganz starke Enttäuschung entstanden ist, dass man eigentlich gar nichts erreichen kann, und tatsächlich auch eine gewisse Unzufriedenheit, wenn nicht gar Enttäuschung, über das Justizsystem entstanden ist."
Vieles weist darauf hin, dass es in Ostdeutschland nach 1989 keineswegs an konstruktivem politischem Gestaltungswillen gefehlt hat, vielmehr mangelte es an praktischer Erfahrung in der Organisation politischer Bewegungen im demokratischen Wettbewerb. Gerade die oft undurchsichtige Abwicklung tausender DDR-Betriebe durch die Treuhand hat das Vertrauen in die Bundesrepublik bis heute beschädigt, davon ist Raiko Hannemann überzeugt. Er fordert, die Akten der Treuhand endlich freizugeben, um eine wissenschaftliche Aufarbeitung zu ermöglichen. Der Ausverkauf der DDR-Betriebe und der Austausch der politischen Eliten im Osten sind für Hannemann wichtige Aspekte in der Analyse demokratiefeindlicher Bewegungen heute.
"Es ist die Verunsicherung der gesamten Gesellschaft, so komplex sie ist im Osten, die dazu führt, dass große Teile, die nicht rechtsextreme Positionen vertreten, sich zurückziehen und nicht versuchen, die Demokratie zu retten, sich für die Demokratie stark zu machen. Weil sie das Gefühl haben, wir können eh nichts verändern und es ist gar nicht meine Bundesrepublik."
"Die marxistische Doktrin kennt Schuld und Haftung des Einzelnen nicht"
Eine andere Gruppe von Historikern sieht die Gründe demokratiefeindlicher Tendenzen in Ostdeutschland eher in einer geschichtlichen Prägung, die bis 1945 zurückgeht. Die Diktatur des sowjetischen Typs habe die Demokratisierung der Ostdeutschen nach dem Zusammenbruch der NS-Diktatur verhindert. Davon ist der Berliner Historiker Martin Jander überzeugt.
"Man hat ja so getan, als hätte man mit dem Umbau des Wirtschaftssystems – vereinfacht gesagt – also damit sei sozusagen alles erledigt. Aber dass die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht nur Fans von Hitler waren, sondern dass die auf den verschiedensten Ebenen in dem Vernichtungsprozess der europäischen Juden, in der Vernutzung der Zivilisten aus Polen, Russland und so weiter als Zwangsarbeiter beteiligt waren, und dass es kurz gesagt um die Re-Zivilisierung dieser Leute ging, das ist etwas, das in der DDR nicht stattgefunden hat und was jetzt, nach 1989, eben stattfinden muss."
So Martin Jander, einer der Herausgeber des aktuellen Sammelbandes "Nach Auschwitz: Schwieriges Erbe DDR". Die marxistische Doktrin, so betont Jander, kenne Begriffe wie Verantwortung, Schuld und Haftung des Einzelnen nicht. Die Rolle der deutschen Zivilbevölkerung in der NS-Diktatur sei in der DDR aus ideologischen Gründen verschwiegen worden.
"AfD-Chef Gauland spricht von 'Das war ein Vogelschiss', Höcke sagt, wir sollten dieses Denkmal doch abschaffen, ein Denkmal der Schande. Möglicherweise haben diese Formen der Zurückweisung von Verantwortung und Haftung, der Zurückweisung von Empathie gegenüber den Überlebenden und den Opfern des Nationalsozialismus etwas mit dieser nicht stattgefunden Auseinandersetzung mit dem NS zu tun. Ich würde vermuten, dass das so funktioniert, aber ich kenne keine Untersuchung, die das wirklich belegt. Also etwa an den Demonstranten in Dresden, wo man dann mal gucken müsste, wo sind die aufgewachsen, was für Schulbücher haben die gelesen, in was für Familien sind sie großgeworden."
Die DDR-Volkskammer bekannte sich erst 1990 zur Mitschuld am Holocaust
Tatsächlich war in den Schulbüchern der DDR nicht von den Deutschen, sondern ausschließlich von "Faschisten" die Rede, wenn es um Täter und Verantwortliche im NS-Staat ging. Zugleich hat die Anpassung an das DDR-System wie eine Schuldbefreiung ehemaliger NS-Täter gewirkt. Ein staatliches Schuldanerkenntnis, eine symbolische Geste wie der Kniefall Willy Brandts 1970 in Warschau, hat es in der DDR nicht gegeben. Tatsächlich bekannte sich die DDR-Volkskammer erst im März 1990 zur "Mitverantwortung für die Demütigung, Vertreibung und Ermordung jüdischer Frauen, Männer und Kinder." Die juristische Verfolgung der Täter wurde im Osten mit mehr Nachdruck betrieben – das zeigen die Statistiken zur strafrechtlichen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in BRD und DDR deutlich.

Dem gegenüber hat die SED-Propaganda aber die Entnazifizierung bereits zu Beginn der 1950er-Jahre für beendet erklärt, betont Anetta Kahane, Publizistin und Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung gegen Rechtsextremismus.
"Es ist ja in der Tat nicht so gewesen, dass die alle im Westen waren, die waren ja überall. Der Anteil der Widerstandskämpfer an der Gesamtbevölkerung mag in Ostdeutschland ein bisschen höher gewesen sein als in Westdeutschland, aber er war klein, er war winzig. Die Elite der DDR, die Führer der Partei und Regierung, das Politbüro, das Zentralkomitee mögen noch einen höheren Anteil an Menschen gehabt haben, die tatsächlich Kommunisten waren und keine Nationalsozialisten. Aber je weiter runter das ging, desto normaler wurde es."
Laut einer aktuellen Studie im Auftrag der Stasi-Unterlagenbehörde waren Mitte der Fünfzigerjahre immerhin ein Drittel der DDR-Staatsbeamten ehemalige NSDAP-Mitglieder. Bereits kurz nach der Gründung der DDR propagierte das SED-Regime den "Freispruch der DDR-Bevölkerung von jeder Schuld und [zog] damit den Schlussstrich unter die Vergangenheit", heißt es dort. Wie wenig die Idee einer entnazifizierten DDR-Gesellschaft dabei der Realität entsprach, untersucht derzeit der Historiker Enrico Heitzer von der Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin.
"Man sieht es ja in der DDR auch an den jüngeren Forschungen, dass es auch immer wieder manifeste rassistische Vorkommnisse gegeben hat, also Übergriffe auf Fremde oder als fremd wahrgenommene Menschen. Das hat etwas mit neuen Prägungen zu tun, mit Reaktionen auf neue Erfahrungen, aber sicher auch mit dem Weiterwirken alter mentaler Dispositionen. Beispielsweise in den 80er-Jahren waren von den sogenannten "Hetze-Fällen", die das Ministerium für Staatssicherheit registriert hat, 20 Prozent rechts. Und es gibt interne Erhebungen am Ende der DDR, die tausende Leute einem rechtsradikalen Spektrum zuordnen."
"Kontinuität rechtsextremistischen, antisemitischen Potentials"
Enrico Heitzer untersucht, inwiefern die Gegnerschaft gegen das DDR-System und neonazistische Bewegungen sich überschnitten. Eine Tradition der rechten Systemgegnerschaft bis heute sieht Heitzer nicht. Anetta Kahane dagegen spricht von einer Kontinuität rechtsextremistischen, antisemitischen Potentials, das in der DDR nicht aufgearbeitet, aber auch nach dem Mauerfall nicht ausreichend wahrgenommen wurde. Kahane sieht sogar eine direkte Entwicklung von der ideologischen Schuldabwehr zur völkischen Propaganda.
"Von Seiten der Leute, die aus dem Osten kamen, die in der DDR großgeworden waren, die hatten auch kein Interesse daran, auf diese Narration einzugehen, weil eine Opfernarration natürlich viel bequemer ist. Sie sagen, wir waren Opfer des Nationalsozialismus als Arbeiter, wir waren Opfer der Sowjetunion, die hat uns besetzt, jetzt sind wir Opfer der Wiedervereinigung, und die verhalten sich hier wie die Kolonialherren. Jetzt sollen wir auch noch über Juden nachdenken? Also bitte! Das passte einfach nicht in diese Zeit rein. Und das ist eine der Brutstätten für das Nicht-Verarbeiten und für das Fortbestehen von Ressentiments, von Einstellungsmustern, von autoritären Gesellschaftsbildern, von Antisemitismus."
Der Mythos des Antifaschismus in der DDR, die mangelnde Aufarbeitung des Nationalsozialismus erlaubten bis heute den unbedachten Umgang mit völkischen, rechtextremen Positionen, so Kahane. Der Historiker Raiko Hannemann ist der Ansicht, dass sich allein damit rechtspopulistische Tendenzen im Osten der Republik nicht erklären lassen.
Die Bundesrepublik als Muster der NS-Aufarbeitung?
"Es ist ja immer vom Mythos Antifaschismus die Rede, den es in der DDR als Staatsmythos gegeben hätte. Es gibt zurzeit einen anderen Mythos, der sich auf die Bundesrepublik bezieht, nämlich dass die Bundesrepublik von Anfang an sehr intensiv und sehr enthusiastisch, mit hohen Schuldgefühlen den NS aufgearbeitet habe. Das finde ich schon ganz interessant - als Richard von Weizäcker 1985 seine berühmte Rede gehalten hat, was da los war, was er da für Anfeindungen, nur weil er von Befreiung und nicht mehr von Niederlage gesprochen hat. Wie weit die Aufarbeitung in der Bundesrepublik war, da würde ich sehr sehr vorsichtig sein, das als das glänzende Gegenbeispiel zur DDR anzuschauen."
Historiker aus Ost- und Westdeutschland versuchen auf unterschiedliche Weise, die aktuelle Konjunktur des Rechtspopulismus mit dem Blick in die Vergangenheit zu erklären. Wieso die Führungsriege der Alternative für Deutschland fast ausschließlich aus den westlichen Bundesländern stammt, die Partei ihre größten Wahlerfolge aber im Osten erzielt, ist umstritten. Neben der These über die mangelnde Demokratiefähigkeit der früheren DDR-Bürger und der Theorie zur fehlenden Aufarbeitung der NS-Vergangenheit wird ein weiterer Aspekt diskutiert. Es geht um den Zusammenhang zwischen Abstiegsängsten und Fremdenfeindlichkeit. Diese Korrelation geht auf die sogenannte "Dimitroff-These" aus der unmittelbaren Nachkriegszeit zurück. Demnach ist die verarmte Arbeiterklasse vom Großkapital zum völkischen Rechtsextremismus verführt worden. Diese im sowjetischen Einflussgebiet gängige Erklärung zeige bis heute Wirkung, meint etwa der Historiker und Kulturanthropologe Patrice G. Poutrus.
Hängen Abstiegsangst und Rechtsradikalismus zusammen?
"Das Argument ist in den letzten fünf Jahren wieder sehr stark in den öffentlichen Raum gekommen. Wenn wir uns aber die sächsische Entwicklung anschauen - der Sachsenmonitor verfolgt das sehr lang – die Einkommenslage, die Lebenszufriedenheit, die Zukunftserwartungen steigen seit Jahren permanent. Und die Affinität zu autoritären, illiberalen, antisemitischen und rassistischen Einstellungen ebenso. Das legt zumindest den Verdacht nahe, dass man über den Zusammenhang von Rassismus und sozio-ökonomischer Lage neu nachdenken muss."
Poutrus betont, bereits vor 20 Jahren habe er wissenschaftlich bewiesen, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen rechtsradikaler Täterschaft und sozialökonomischer Deklassierung gebe. Als er sein Thesenpapier damals veröffentlicht habe, so Poutrus, hätten er und seine Kollegen spürbaren Gegenwind aus der Brandenburgischen Staatskanzlei bekommen. Auch Anetta Kahane ist überzeugt, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Unsicherheit und Rechtsradikalismus bis heute als Erklärung diene und die tieferliegende, historische Grundierung rechter Ideologien so ignoriert würden. Eine aktuelle Studie der Hans Böckler Stiftung kommt wiederrum zu einem anderen Ergebnis. Sie belegt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Rechtspopulismus und der subjektiven Angst vor materiellem und gesellschaftlichem Abstieg. Der Historiker Raiko Hannemann kommt bei seinen Feldforschungen zur Demokratiefeindlichkeit an der Ostberliner Stadtgrenze zu einem differenzierteren Schluss.
"Wie in allen post-nazistischen Gesellschaften hat es natürlich auch in der DDR immer rechtsextremes Gedankengut gegeben in der Bevölkerung, natürlich. Dass es das auch in den Familienerzählungen gegeben hat, und dass das natürlich in einer sehr aufgewühlten und instabilen Zeit dann hochkommt, wo Leute kommen, die es schaffen, das zu organisieren, ist glaube ich relativ klar. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein entscheidender Unterschied zwischen Ost und West, dass sich der Osten nie so stabilisiert hat, sei es ökonomisch, sei es sozial, sei es politisch-mental, dass es eben so leicht ist, rechtsextrem eingestellte Ostdeutsche zu organisieren. Das in eine politische Richtung, in eine politische Organisation zu bringen."
Die Analyse politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen in Ost und West ist nach 1989 vor allem den historischen Deutungsmustern der alten BRD gefolgt. Die derzeitige wissenschaftliche Beschäftigung mit der Konjunktur demokratiefeindlicher Strömungen kommt um einen gesamtdeutschen Blick nicht herum. Historiker aus Ost und West fordern deswegen einen Paradigmenwechsel in der Forschung zur DDR-Geschichte, der bis auf die Nachkriegszeit zurückgeht. Die durchaus auch in Kreisen der Wissenschaft noch heute virulente Überheblichkeit gegenüber vermeintlichen Defiziten der ostdeutschen Gesellschaft, so meint Anetta Kahane, ist dabei weder angebracht noch hilfreich.