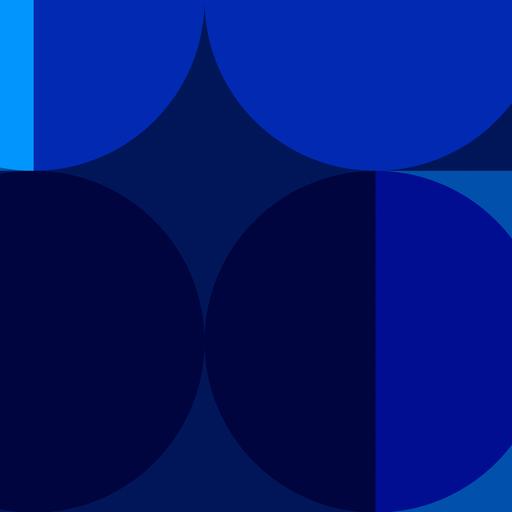Er hat sich als unruhiger und streitbarer Bürger zweier Staaten erwiesen: der deutsch-jüdische Historiker und Publizist Michael Wolffsohn. Geboren wird er 1947 in Tel Aviv in eine Familie, der noch 1939 die Flucht aus Deutschland gelungen war. Michael Wolffsohn ist also ein Jahr älter als der Staat Israel, den er, kaum eingeschult, jedoch verlässt. Seine Eltern beschließen, dass sie wieder in Deutschland leben wollen. Michael Wolffsohn geht in Westberlin zum Gymnasium und beginnt dort auch 1966 zu studieren, Volkswirtschaft zunächst. Der Sechstagekrieg, die existenzielle Bedrohung des jungen jüdischen Staates bewegt ihn jedoch 1967, seinen Wehrdienst in Israel abzuleisten. 1970 kehrt Wolffsohn zum Studium nach Berlin zurück. Seine akademische Karriere führt ihn bis zur doppelten Habilitation in Politik und Zeitgeschichte auch durch die Universität Saarbrücken. Die Universität der Bundeswehr in München beruft ihn im Jahr 1982 zum Professor für Neuere Geschichte. Vehement beteiligt sich Wolffsohn seit den 1980er-Jahren an der Debatte über das Verhältnis der deutschen Juden zur Bundesrepublik und darüber, wie in Deutschland des Holocaust gedacht werden soll. Wolffsohn sieht in Deutschland eine gefestigte Demokratie, die seiner Ansicht nach ruhig selbstbewusster sein könnte. Die Bundesrepublik habe bewiesen, dass sie sich ihrer Verantwortung gegenüber den Juden und gegenüber Israel ausreichend stelle, sagt er.
Michael Wolffsohn: "Also, Wolffsohns und Co sterben aus."
Vom Leben im Land der Mörder; Rückkehr in eine deutsch-jüdische Gemeinde, die ab 1990 ihr Gesicht komplett verändert
Stephan Detjen: Ein Mann für dreiste, chuzpige Auftritte, ein Vielschreiber, schon immer ein Quatschkopf, und zwar seit den Schülerzeiten am Gymnasium im Berliner Grunewald. Herr Wolffsohn, man muss gar nicht Ihre Kritiker befragen, das sind alles Selbstbeschreibungen, die ich jetzt zitiert habe aus Ihrer Autobiografie "Glückskinder". Man könnte noch mehr aufzählen. Was haben Sie ein Bild von sich selber, Herr Wolffsohn?
Wolffsohn: Ich befleißige mich oder versuche mich auch einer Selbstironie zu bedienen, denn nichts ist unerträglicher für mich als mit Menschen zusammen zu sein, die sich selbst für den Mittelpunkt nicht nur der Welt, sondern des Kosmos halten, und das wollte ich nie.
Detjen: Inwieweit war dieser Schreibprozess oder entsprang dieser Schreibprozess für Sie auch einem Bedürfnis, sich noch mal zu erklären, vielleicht auch zu rechtfertigen?
Wolffsohn: Das mit Sicherheit, aber zunächst einmal nachzudenken. Also ich finde, dass zur Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber, auch die Selbstkritik, das Nachdenken über Fehler, gehört – das habe ich beispielsweise in diesem Buch getan, konkret Heinz Galinski, der langjährige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, später Zentralrats-, damals hieß es Vorsitzender.
Detjen: Den Sie schon als Kind erlebt haben.
Wolffsohn: Ja, genau, und als junger Erwachsener. Wir haben oft und öffentlich gestritten. Damals meinte ich recht gehabt zu haben, und heute – und das habe ich auch geschrieben –, er hatte recht, konkret in Bezug auf die Frage, sollten 1990/91 die aus der damals noch bestehenden Sowjetunion kommenden Juden nach Israel gehen oder nach Deutschland, denn – das vergessen wir nicht – Israel hat überhaupt diese Auswanderung ermöglicht, und ich fand damals, dass, wenn man auf dem jüdischen Ticket aus der Sowjetunion rauskommt, hat man dem jüdischen Staat gegenüber eine moralische Verpflichtung. Die hat man, aber auf der anderen Seite hat Galinski sehr vernünftig und strategisch denkend gesagt, wir Juden in Deutschland sind eine so kleine Minigruppe, dass wir ein Menschenreservoir brauchen, und ohne diese strategische Entscheidung gäbe es heute faktisch keine Juden mehr in Deutschland. Heißt: Galinski hatte recht und nicht ich. Eines von vielen Beispielen.

"Diese Menschen sind weniger an deutscher Kultur, sondern an der bedeutenden russischen Kultur orientiert"
Detjen: Lassen Sie mich da mal gerade, weil es ein so interessantes Thema ist, ganz aktuell nachhaken: Die jüdischen Gemeinden haben sich ja dadurch enorm verändert. Sie sind zum Teil, die Gruppe der überlebenden, in Deutschland aufgewachsenen, sozialisierten, zurückgekehrten Juden, zu denen auch Ihre Familie gehört, auf einmal in Minderheitenpositionen geraten, in vielen, wahrscheinlich den meisten jüdischen Gemeinden. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob es wirklich die meisten sind, aber in vielen jedenfalls sind diese russischen Zuwanderer eine Mehrheit geworden. Wie hat sich das verändert?
Wolffsohn: Dramatisch. Also die deutsch-jüdischen Rückkehrer, also deutsche Juden wie die Wolffsohns, meine Eltern und Großeltern – die mütterlichen Großeltern blieben in Israel –, die waren ja auch in der deutsch-jüdischen Gemeinschaft nach 1945 die Minderheit. Rund 80 Prozent der in der Bundesrepublik lebenden Juden, am Ende der alten Bundesrepublik waren es 28.000, waren Überlebende der nationalsozialistischen Vernichtungshölle. Die blieben im wahrsten Sinne des Wortes stecken am östlichsten Punkt des Westens, denn auch im Osten wollten sie nicht bleiben. Erstens, weil die Mehrheit der Juden keine Kommunisten oder Sozialisten waren und zweitens, weil in Osteuropa auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust ein massiver, teils mörderischer Antisemitismus vorhanden war. Also die Mehrzahl der Juden bis zum Ende der alten Bundesrepublik waren osteuropäisch-polnisch-russischer Herkunft – Wolffsohn und Co die Minderheit –, und dann kam der große Zustrom von rund 200.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion ab 1990. Das hat – wie Sie völlig richtig sagen – die Soziologie, die Herkunftsgeografie und auch die Ideologie der Gemeinden verändert. Es fällt auf, dass autoritäre Strukturen gestärkt worden sind. Kein Wunder: Diese Menschen sind geprägt worden vom autoritären, diktatorischen System der Sowjetunion. Diese Menschen sind weniger an deutscher Kultur, sondern an der bedeutenden russischen Kultur orientiert, und was sich in der Zukunft bilden wird, wenn denn diese Juden in den jüdischen Gemeinden bleiben, das ist eine offene Frage. Dann wird es eine völlig neue Mischkultur aus deutsch-jüdischen, ostjüdischen und russischen Elementen geben, was durchaus interessant ist, aber es hat weder in Bezug auf die Kontinuität der Generationen noch der Kulturkontinuität mit dem alten deutschen Judentum etwas zu tun. Also Wolffsohns und Co sterben aus.
Detjen: Lassen Sie uns über diese Wolffsohns noch mal sprechen, diese Vertreter, Repräsentanten des deutschen Judentums, zurückgekehrt in der Nachkriegszeit nach Deutschland in eine Situation, wo Sie hier in einer krassen Minderheit gewesen sind, gleichzeitig angefochten auch aus Israel. Aus Israel gab es immer wieder die Stimmen, man kann als Jude nicht mehr in Deutschland leben. Also ein sehr schwieriges Verhältnis zu Deutschland auch, ein konfliktbeladenes in so vielerlei Hinsicht. Wie haben Sie das in Ihrer Familie erlebt?
Wolffsohn: Also das mit der Kritik stimmt völlig, aber die kam nicht nur aus Israel, die kam eigentlich unisono aus allen diaspora-jüdischen Gemeinden, auch natürlich der größten, der amerikanisch-jüdischen. Wie man das verkraftet hat? Nun, entweder nimmt man Selbstbewusstsein ernst oder nicht und auch Selbstbestimmung. Warum sollten wir uns von wem auch immer vorschreiben lassen, wo und wie und mit wem wir zusammenleben sollten und müssten. Also ich will das gar nicht übermäßig ideologisieren, aber es war, also zumindest für meine Familie, eine Selbstverständlichkeit, und jetzt das wieder in den größeren Zusammenhang. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, Galinski habe ich oft kritisiert, aber Heinz Galinski hat 1950 – wohlgemerkt 1950 –, als die Jewish Agency und andere diaspora-jüdische Organisationen plus die israelische Regierung ein Ultimatum gestellt hatten den in Deutschland lebenden Juden, dass diese innerhalb von sechs Monaten das – Zitat – "Land der Mörder" zu verlassen hätten …, und da stand der kleine Heinz Galinski – er war ja wirklich sehr klein – großartig auf und sagte, wir lassen uns von niemandem vorschreiben, wo wir leben. Wenn ich Demokratie ernst nehme und Selbstbestimmung, also die Werte des Westens, der offenen Gesellschaft schlechthin, kann ich mir das doch nicht vorschreiben lassen.
"Die Distanz gegenüber vermeintlichen oder auch tatsächlichen Autoritäten, das habe ich sozusagen mit der Muttermilch eingesogen."
Der Großvater Karl Wolffsohn, ein Pionier der Filmkultur und ein großes Vorbild
Detjen: Jetzt sind wir schon bei dem Leitmotiv der Wolffsohnschen Familiengeschichte, denn so wie Sie sie erzählen, gibt es da immer wieder diese Typen, diese Wolffsohns, die sagen, warum muss ich mir von irgendjemandem was vorschreiben lassen, und jetzt gehen wir mal zurück auf den Karl Wolffsohn, Ihren Großvater, der eine so große Rolle in Ihrer Biografie spielt. Sie nennen ihn den Überwolffsohn, ein Pionier des deutschen Kinos, Erbauer und Betreiber von großen Filmtheatern. Was muss man über Karl Wolffsohn wissen, um Michael Wolffsohn zu verstehen?
Wolffsohn: Das Bewundern einer halsstarrigen Persönlichkeit, die das, was sie sich vornahm, auch versuchte zu verwirklichen – erstens. Zweitens, die Verbindung von Profit und Ethik. Mein Großvater wurde ein sehr reicher Mann durch die damals ganz neue und massenökonomisch wirksame Filmindustrie. Er war einer der Pioniere der Filmpublizistik. Kino war damals Filmtheater, also das Theater des kleinen Mannes. Das kann man auch an der Soziologie der frühen Kinobesucher erkennen. Dann erfand er sozusagen parallel zum Theaterprogramm das Kino- bzw. Filmprogramm. Auf Seite eins sah man das sich küssende Paar, auf Seite zwei war die Inhaltsangabe, drei, die Namen der Schauspieler und auf Seite vier auch noch ein paar ganz nette Fotos. Die Kinos kamen ja später. Also er fing an mit der Filmpublizistik, erweiterte das auf die wissenschaftliche Erforschung des Kinos. Er hat nämlich ein Filmarchiv angelegt, was Herr Kirch später mit durchaus großem Erfolg – abgesehen von geschäftlichen Misserfolgen, die aus anderen Gründen entstanden – gemacht hat. Also wäre das Dritte Reich nicht gekommen, wäre nicht Herr Kirch der große Sammler von Filmen geworden, sondern das war mein Großvater. Dann hat er das Thema Unterhaltungswirtschaft erweitert in Bezug auf das Kino selbst und hat Kinos betrieben, eröffnet, nicht nur in Berlin: in Essen, die Lichtburg, eines der größten Kinos in Deutschland immer noch. Die Berliner Lichtburg war eines der größten europäischen Kinos. Dann ab 1919 Varietés. Die Scala beispielsweise, die war damals weltberühmt. Der eine oder andere kennt den Film "Cabaret" mit Liza Minnelli, das spielt in dem Milieu. Die Comedian Harmonists haben dort ihre Weltpremiere gefeiert. Also das war schon ein riesiges Unternehmen, aber es war zugleich eben sehr sozial, weil dem Oberschichten- und Mittelschichten-Varieté dann ein Unterschichten-Varieté ergänzend zur Seite gestellt worden ist mit dem gleichen hochqualitativen Programm zu bezahlbaren Preisen mit Umsatz. Das Großvarieté hatte 3.000 Sitzplätze, die Kinos waren auch groß. Also Knete durch Masse sozusagen. Er hat sich von niemandem etwas sagen lassen.
Detjen: In dem Buch, in dieser Familienbiografie kommt immer wieder der Begriff der Wolffsohnschen Gene vor. Sie schreiben da an einer Stelle auch ganz explizit, ob es sich dabei um bestimmte – ich zitiere jetzt – jüdische Gene handelt, die die deutsche Nation im Jahr 2010 im Zusammenhang mit der Debatte über Thilo Sarrazins Buch "Deutschland schafft sich ab" so erregten. Sei dahingestellt, genetisch oder nicht, die meisten Wolffsohns sind von wem und was auch immer darauf programmiert, Unrecht nicht zu erdulden. Das ist so der Geist, der diese Familienerzählung durchzieht, aber ich habe mich gefragt – jetzt will ich es doch noch mal genauer wissen, Gene dahingestellt oder nicht –, was genau programmiert da eigentlich, wie funktionieren solche Familienprägungen? Sie nehmen ja auch Teil da dran, indem Sie eine Familiengeschichte erzählen und damit etwas programmieren für diese Erzählung.

Wolffsohn: Also das mit der Genetik ist natürlich auch wieder Ironie und soll ein bisschen auch zum Nachdenken anregen, aber entscheidend ist, ich bin kein Naturwissenschaftler, der bemessen will, ist das genetisch oder ist das umweltgeprägt. Fakt ist, dass in unsere Familie – und das kann ich auch leicht in die jüdische Geschichte und jüdische Identität einordnen – nie bereit war sich zu unterwerfen, weder Individuen noch Kollektiven, und dieses Beispiel wurde mir vorgelebt von meinen beiden Großvätern, von meiner Mutter, und das war die Prägung, die ich bekommen habe. Die kann ich, wie gesagt, in die jüdische Tradition einordnen. Ich denke hier vor allem an die "Sprüche der Väter". Das ist ein Abschnitt des Talmud. Empfehle ich jedem, der jüdische Ethik kennenlernen will. "Sprüche der Väter" gibt es auch in deutscher Übersetzung. Also die Distanz gegenüber vermeintlichen oder auch tatsächlichen Autoritäten, das habe ich sozusagen mit der Muttermilch eingesogen, und das ist kein Wolffsohnsches Privileg, und das sind keine genetischen Fragen, sondern es hängt tatsächlich von dem jeweiligen Vorbild, Beispiel, egal wie Sie das nennen wollen, ab.
"Die Dominanz des Matriarchats ist ganz eindeutig"
Detjen: Stichwort Muttermilch: Sie haben gerade gesagt, die "Sprüche der Väter" und auch in dieser Familiengeschichte sind es sehr stark die Väter, die Großväter, die Onkel, –
Wolffsohn: Aber die Mutter auch.
Detjen: – die eine sehr dominante Rolle spielen, und die Frage ist natürlich an der Stelle, welche Rolle spielen die Mütter.
Wolffsohn: Also in der jüdischen Familie natürlich eine ganz starke, wobei hier auch wiederum sehr interessant ist, jetzt genderpolitisch völlig inkorrekt, was ich sage, aber ich beschreibe die jüdische Familiensoziologie und Ideologie: auf der einen Seite ist religiös völlig klar die Dominanz des Mannes. Das sehen Sie beispielsweise am orthodoxen Gottesdienst noch heute, nicht den Reform-, liberalen Gottesdienst: Männlein und Weiblein sind nicht nur getrennt, sondern es kann ein gemeinschaftlicher Gottesdienst nur stattfinden, orthodox-jüdisch, wenn zehn Männer zusammenkommen. Also diese männliche Dominanz ist ganz eindeutig. Faktisch, in Bezug auf die Familiensoziologie, ist das Matriarchat sozusagen unumstritten. Der Mann hat dann der Regie oder den Anordnungen der Ehefrau zu folgen, und das gilt erst recht für die jüdischen Kinder. Also "Ödipussi" ist sozusagen die nichtjüdische Variante, aber die jüdische Wirklichkeit, ohne sie zu karikieren, wie das in "Ödipussi" unter nichtjüdischen Vorzeichen von Loriot geschehen ist, die Dominanz des Matriarchats ist ganz eindeutig.

"Ich habe zahlreiche Morddrohungen bekommen als Reaktion auf die Tatsache, dass ich durch den damaligen, wohlgemerkt: Verteidigungsminister Peter Struck praktisch für vogelfrei erklärt worden bin."
Der jüdische Professor an der Bundeswehr-Universität, der sich mit fast jedem anlegt
Detjen: Das war also 1980, zunächst Bundeswehr-Universität in Hamburg, und dann schon ein Jahr später bis zur Emeritierung 2012 die Bundeswehr-Universität in München, an der Sie Geschichte gelehrt haben. Sie schildern das selber ganz offen und sagen, das ist eigentlich kein Platz, wo man als Wissenschaftler ist, wenn man in der wissenschaftlichen Community verehrter Großhistoriker werden will. Was hat Sie dort verbunden mit dieser Universität, was hat es bedeutet für Sie, dass Sie dort deutsche Soldaten ausgebildet und unterrichtet haben?
Wolffsohn: Also da gibt es viele Antworten. Ich will versuchen sie zu bündeln. Erstens, um mit dem letzten anzufangen, warum vor Soldaten: Wer die deutsche Militärgeschichte kennt, bis 1945 weiß, dass das – Anführungszeichen – "Militärhandwerk" – Ausführungszeichen – der deutschen Offiziere und Soldaten Weltspitze gewesen ist, aber moralisch war es nicht zuletzt im Dritten Reich eine Katastrophe. Auch in der Weimarer Republik: Stichwort Staat dem Staate, der Dünkel des preußischen Militärs über das Zivile schlechthin. Die preußischen Reformer des frühen 19. Jahrhunderts sind diesbezüglich eher die Ausnahme gewesen als die Regel. Kurzum, das hat mich gereizt. Ich bin ja 1970 willentlich und wissentlich nach Deutschland zurück, in ein neues Deutschland, in die Bundesrepublik Deutschland, wohlwissend, dass das jüdisch-historisch nicht unbedingt konsensfähig gewesen ist, um es zurückhaltend zu formulieren. Wenn ich also nach Deutschland zurückkomme, begreife ich mich als Individuum, als Teil des neuen Deutschlands. Beitragen, und zwar auf Augenhöhe, nicht moralisch qua Geburt überlegen, sondern Ärmel hochkrempeln und mitprägen und zwar an einer kritischen Stelle, gerade angesichts der deutschen Militärgeschichte. Die Bundeswehr-Universitäten sind ja ein deutsch-militärhistorisch, gesellschaftshistorisch ganz bedeutender Fortschritt gewesen. Der Bürger in Uniform, das wird heute noch so dahergeredet. Das ist ein revolutionärer Wandel.
Detjen: Der Vater von Thomas de Maizière hat diesen Begriff geprägt, der inneren Führung. Baudissin.
Wolffsohn: Ja, Baudissin natürlich noch mehr, richtig, aber viele auch … Gerd Schmückle, mit dem ich später dann persönlich befreundet gewesen bin. Jedenfalls fand ich, das ist eine Herausforderung. Gut, Geschichtsseminare und Vorlesungen kann man überall halten, aber mit dieser zusätzlichen Herausforderung wollte ich mich beschäftigen. Dann hat der akademische Arbeitsmarkt das gesteuert, und ich habe diesen Marktmechanismus dann gerne Folge geleistet. Das wiederum hat die alte und neue Rechte vom ersten bis zum letzten Tag an meiner Bundeswehr-Universität immer gestört. Da hieß es, wie kann ein Jude, der in der israelischen Armee gedient hat, deutsche Soldaten unterrichten, sprich vergiften.
Detjen: Die neue Rechte sagen Sie. Von wem haben Sie das gehört?
Wolffsohn: Das kann ich genau zeigen. Nationalzeitung im Jahre 1981...
Detjen: Das war ja eher die alte sozusagen…
Wolffsohn: Genau, das ist die alte miese Rechte, und bei den neuen Rechten ist das auch der Fall, wobei man in Bezug auf die neue Rechte sehr differenzieren muss. Also nehmen Sie Frau Petry, für die ich natürlich nicht gestimmt habe, also deren Partei, aber deren proisraelischen Bekundungen sind aufrichtig. Das wurde von vielen bezweifelt, aber auch jetzt nach ihrem faktischen Austritt aus der AfD, klipp und klar, also Positionen bezüglich der israelischen Politik, die deutlich über das hinausgehen, was ich auch akzeptiere, aber das kann man nicht bestreiten. Die neue Rechte ist diesbezüglich …
Detjen: Also Sie wollen darauf hinweisen, dass die neue Rechte sich nicht mehr durch den klassischen Antisemitismus auszeichnet.
Wolffsohn: Mit Sicherheit nicht, sondern die neue Rechte wird mehrheitlich durch Distanz, Feindschaft, Aggression gegenüber dem Islam gekennzeichnet. Ob das sympathischer ist, steht auf einem anderen Blatt, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das automatisch antisemitisch ist. Natürlich gibt es diese antisemitischen Strömungen gewaltig in der AfD. Denken Sie an Baden-Württemberg, wo die Fraktion im Landtag faktisch gespalten ist gegenüber eindeutig antisemitischen Äußerungen, die also bis zu diesem Schwachsinn gehen, jüdische Weltherrschaft und ähnliches. Das ist richtig. Also mit anderen Worten, diese Kritik kam von der alten und neuen Rechten, aber diese Kritik kam eben auch von links mir gegenüber. Die Linke in ihren diversen Schattierungen ist alles andere als positiv getrimmt und gestimmt gegenüber der Bundeswehr. Das ist bekannt.
Interviews mit Michael Wolffsohn im Deutschlandfunk
Michael Wolffsohn über biblisches Erzählen Jüdisch-christliche Symmetrie
Historiker Michael Wolffsohn "Die meisten Nationalstaaten sind eine Totgeburt"
Historiker Wolffsohn Über die Wiedereinführung der Wehrpflicht nachdenken
Wolffsohn: Die Spielregeln der Politik gelten für alle
Michael Wolffsohn über biblisches Erzählen Jüdisch-christliche Symmetrie
Historiker Michael Wolffsohn "Die meisten Nationalstaaten sind eine Totgeburt"
Historiker Wolffsohn Über die Wiedereinführung der Wehrpflicht nachdenken
Wolffsohn: Die Spielregeln der Politik gelten für alle
Die Auseinandersetzung Wolffsohn gegen Struck
Detjen: Ihre Geschichte als Lehrer an der Bundeswehr-Universität kann man natürlich als eine Geschichte von Publizistik lesen. Ein gutes Dutzend Bücher haben Sie veröffentlicht zu ganz verschiedenen Themen. Man kann Sie aber auch sehr Wolffsohnsch in Ihrem Sinn als eine Streitgeschichte lesen, und so erzählen Sie sie ja auch zum Teil, denn das ist immer wieder eine Geschichte in Kapiteln. Der Hochschullehrer Wolffsohn, Professor gegen oberste Vorgesetzte, gegen Verteidigungsminister, nicht eins, nicht zwei, wenn ich es richtig gezählt habe: Fünf Kapitel beschäftigen sich mit diesem auch in der Öffentlichkeit ausgetragenen Auseinandersetzungen, die Sie mit Minister hatten. Volker Rühe, Peter Struck, Joschka Fischer, Gutenberg, Thomas de Maizière. Da blitzt viel Streitlust auf, und wenn man das jetzt mal zusammennimmt: Sie sind da nicht ohne Blessuren davongekommen, tragen das aber auch mit einem – schildere ich das richtig – gewissen Stolz in der Familientradition?
Wolffsohn: Also die Blessuren sehe ich nicht.
Detjen: Schildern Sie zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit dem damaligen Verteidigungsminister Peter Struck, wo Sie schildern, was diese Anfechtungen in der Öffentlichkeit auch für die Familie bedeutet haben, bis zum Personenschutz.
Wolffsohn: Richtig, ja, aber ich habe mich behauptet, und ich habe die Unterstützung, weil Sie Personenschutz nennen, nicht zuletzt und vor allem der bayrischen Polizei bekommen, zahlreiche Morddrohungen als Reaktion auf die Tatsache, dass ich durch den damaligen, wohlgemerkt, Verteidigungsminister Peter Struck praktisch für vogelfrei erklärt worden bin. Das ist keine sehr lustige Situation, aber im Rückblick würde ich sagen, dass wir uns da nichts geschenkt haben, dass ich aber inhaltlich obsiegt habe. Das Entscheidende dabei ist, er konnte mich nicht klein kriegen. Das entscheidende Kriterium ist der innere Kompass, nicht, was sagt A, B oder C, und nicht die Tatsache, dass wenn, wie geschehen, meine Frau und ich in Konzerten oder ins Theater gehen, in Pausen regelrecht körperlich gemieden werden von Leuten, die früher nichts Dringenderes zu tun hatten als einem Hallo zu sagen, ja, wäre es falsch …
"Zwischen Recht und Gerechtigkeit muss unterschieden werden"
Detjen: Jetzt muss man mal aufklären, worum es ging, wenn wir diese Auseinandersetzung rausnehmen. Es ging am Anfang dieser Auseinandersetzung Wolffsohn gegen Struck an der Spitze, aber dann eben wirklich eine breite öffentliche Auseinandersetzung, stand ein Interview, das Sie 2004 im Fernsehen in einer Sendung von Sandra Maischberger gegeben haben und – korrigieren Sie mich, wenn ich es nicht richtig zusammenfasse – in der Sie gesagt haben, paraphrasiert, in bestimmten Ausnahmesituationen kann Folter beim Verhör von Terroristen legitim sein. Das war der Begriff, den Sie verwendet haben und den Sie dann verteidigt haben.

Wolffsohn: Sie sind ja nicht nur Historiker, sondern auch was richtiges studiert sozusagen, also Jurist, und Sie wissen, dass es einen dramatischen Unterschied zwischen Legitimität und Legalität gibt, und nicht alles, was legitim ist, ist dann auch legal – Punkt eins. Also zwischen Recht und Gerechtigkeit, was auch immer Gerechtigkeit ist, muss unterschieden werden. Zweitens habe ich nicht gesagt, man solle foltern. Das wurde mir unterstellt, aber Sie als Journalist wissen doch genau, dass nicht alles, was man gesagt hat, auch so wahrgenommen wird. Peter Struck hat mir im privaten Gespräch, zu dem er mich eingeladen hat, nicht zitierte, wie er öffentlich behauptete, auch zugestanden, dass er und seinesgleichen politisch sozusagen mit mir alte Rechnungen begleichen wollten. Das sind im Grunde genommen atmosphärisch-politisch die alten Rechnungen der 68er gewesen. Er war ja in der politischen Generation ja auch ein 68er plus, minus, ich auch, und Freunde und Gegner der 68er haben sozusagen den Geruch des anderen schon wahrgenommen als Provokation, und das wirkte nach lange Zeit.
Detjen: Es war ja eine Zeit, also das war alles noch überschattet von den Anschlägen auf Nine-Eleven. In der Rechtswissenschaft wurde drüber diskutiert, ob man bestimmte strafrechtliche Maßstäbe verändern muss – Feindstrafrecht war so ein Begriff, der da kursierte. Es gab ein Buch von dem Staatsrechtler Depenheuer, das da in dem Zusammenhang viel für Diskussionen sorgte, der Bundestag debattierte über das Luftsicherheitsgesetz, wo es um die Frage ging, darf man in Ausnahmesituationen Zivilflugzeuge abschießen, wenn die von Terroristen entführt sind. Also die Sorge war ja – und das war die Kulisse, vor der diese Auseinandersetzung sich abspielte –, dass da etwas ins Rutschen kommt im Rechtsstaat, dass sich da fundamental was verändert, was bestimmte Leute ja eingefordert haben, gesagt haben, wir müssen Grundbegriffe ganz anders definieren, anders denken in diesem 21. Jahrhundert, in dem wir mit neuen Bedrohungslagen konfrontiert sind. Wie sehen Sie das im Rückblick?
Wolffsohn: Nach wie vor. Ich habe gedacht, nachgedacht, und noch einmal: Nicht alles, was gedacht werden kann, soll, muss, darf gemacht werden. Was ich persönlich dann empfehle ist eben nicht, in diesem konkreten Falle zu foltern damals, aber ich muss darüber nachdenken, denn wenn eine neue Situation entsteht, kann ich auch nicht mit den alten Methoden automatisch weitermachen. Also das ständige Denken, Nachdenken, auch das selbstkritische Nachdenken, das habe ich nicht durch eigenes Verdienst, sondern das ist meine Prägung, und diese Prägung ist nicht zuletzt Ergebnis des bundesdeutschen, damals Westberliner Erziehungssystems gewesen. Das waren nicht nur Phrasen, die uns beigebracht worden sind, sondern die wurden, zumindest an meiner Schule, Walter-Rathenau-Schule – ein sehr gutes Grunewalder Gymnasium – nicht nur dem Worte nach gepredigt, sondern das wurde auch vom Großteil der Lehrerschaft so gelebt. Nur in der öffentlichen Diskussion – wem sage ich das, Herr Detjen – wissen Sie, dass wir Vereinfachungen haben, dass Rechnungen beglichen werden müssen, das ist ein politischer Prozess. Mein Fehler bestand darin, dass ich öffentlich nachgedacht habe in einem Massenmedium, und das ist sozusagen ein Widerspruch in sich selbst. Das würde ich in dieser Form heute nicht mehr machen, aber auf der anderen Seite ist doch kennzeichnend, dass die intellektuelle Situation in diesem Lande deshalb so langweilig ist, und ich sage, sie ist langweilig, weil immer politisch korrekt gedacht wird – was kann ich auch sagen, was ich denke. Nein, ich sage, was ich denke, aber ich will nicht – ich wiederhole mich absichtlich – auch gemacht haben, was ich gedacht habe.
"Zieht die Leute, die Analphabeten sind, aus, dann stehen Sie in den Unterhosen da. Nein, sie stehen nackt da."
Keine Angst vom Gegner der Demokratie; der Diskurs braucht weder Grenzen noch Wächter
Detjen: Diese Frage, wie führen wir öffentliche Diskussionen in erregten Zeiten, in denen wir sehen, wie Risse durch die Gesellschaft gehen, die wirft ja die Frage auf, wo sind Grenzen eines öffentlichen Diskurses. Wir haben sie in Deutschland sehr stark gezogen. Es gibt bestimmte Grenzen, strafrechtlich abgesichert, was die Leugnung des Holocausts zum Beispiel angeht, die Grenzen des öffentlichen Diskurses markieren, und jetzt kommt Michael Wolffsohn und sagt hier nicht zum ersten Mal, da fehlt es in Deutschland an Offenheit, auch an Streitlust, gerade was den medialen Diskurs, den wir auch hier …, wo wir jetzt gerade dran teilnehmen.
Wolffsohn: Nein, nein, den wissenschaftlichen … Nein, nein, nicht nur. Machen Sie nicht zu viel Selbstkritik des Journalismus.
"Dass der Holocaust ein Faktum ist, ist doch unumstritten"
Detjen: Also ich zitiere Ihre Kritik.
Wolffsohn: Ja, ja, aber das ist ein allgemeines Kennzeichen der deutschen Gesellschaft. Nehmen Sie den Straftatbestand der Holocaustleugnung. Dass der Holocaust ein Faktum ist, ist doch unumstritten, und wenn irgendein Depp das sagt, ja, kann ich …
Detjen: Sie würden den Straftatbestand abschaffen?

Wolffsohn: Da bin ich inzwischen nicht ganz so sicher, denn die Leugnung des Holocaust bezieht sich ja eigentlich nicht auf das Faktum, das unbestreitbar ist, sondern mit der Leugnung des Holocaust soll gesagt werden, Leute, das ist ja gar nicht so schlimm, und das ist im Grunde genommen indirekt oder fast direkt auch die Aufforderung zum Mord und zum Massenmord. Das ist ein anderes Phänomen, aber die Leugnung als solche, die ist so absurd. Ich kann Absurditäten nicht strafrechtlich verfolgen im Grunde genommen.
"Die religionshistorischen Aussagen von Herrn Glaser kann ich nicht ernst nehmen"
Detjen: Der Kandidat der AfD für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten Albrecht Glaser ist umstritten, weil er sagt, für den Islam, der selber keine Religionsfreiheit gewähre anderen Religionen, dürfe deswegen auch in Deutschland keine Religionsfreiheit gelten. Das kann mit Mitteln parlamentarischer Regeln diskutiert werden im Bundestag. Sind das Themen, die da gesetzt werden, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden sollten? Denn da galten natürlich in der Tat Diskursgrenzen. Wir haben nicht darüber gesprochen, ob für den Islam in Deutschland Religionsfreiheit gelten sollte oder nicht. Das war ein Selbstverständnis.
Wolffsohn: Die religionshistorischen Aussagen von Herrn Glaser kann ich nicht ernst nehmen. Das ist nur ein politisches Signal.
Detjen: Das ist eine normative Aussage.
Wolffsohn: Eine normative Aussage könnte genauso sein, die Erde wäre viereckig, und dann wären wir zwar bei politisch weniger Heiklem, aber im Grunde genommen ist das genauso absurd. So, diese Themen sind aber in der Öffentlichkeit da. Wir können Sie nicht ausklammern, und wir müssen uns auseinandersetzen. Die Tatsache, dass wir sagen, nein, der kann nicht das Amt A, B oder C annehmen, zeigt doch unsere eigene Unsicherheit. Nein, ich fühle mich da nicht unsicher. Ich kann diese Diskussion führen. Verstehen Sie mich nicht falsch, dass ich sage, nur ich. Viele andere können das, aber das muss diskutiert werden. Das heißt, wir sind – also offenbar wir Demokraten – offenbar so furchtsam wie der Karnickel vor der Schlange, dass uns keine Argumente einfallen. Wir haben auch keine, weil die meisten sich über Religion gar nicht auskennen. Da wird bramarbasiert über Christentum, Judentum, Islam, ganz wurscht, völlig ahnungslos. Plötzlich spielt nämlich Religion hier eine Rolle, aber wir müssen diese Themen diskutieren, und das zeigt eine Ängstlichkeit. Ich sage, unsre Demokratie ist stark. Wir haben auch Leute, die durchaus in der Lage sind, diesen Disput über den Charakter des Islam, des Judentums, Christentums, welche Themen auch immer, in dieser breitgebildeten, auch teilweise tiefgebildeten bundesdeutschen Gesellschaft … und dann haben wir eine Analphabeten-Diskussion, und diese Analphabeten-Diskussion wollen wir verhindern. Nein, zieht die Leute, die Analphabeten sind, aus, dann stehen sie in den Unterhosen da. Nein, sie stehen nackt da, und das soll mir zeigen, des Kaisers neue Kleider. Dieser Kaiser hat keine Kleider an, der ist nackt, und das können wir zeigen. Dieses mangelnde Selbstbewusstsein in der deutschen Demokratie, in der Intellektualität dieses Landes, ich kann das einfach nicht nachvollziehen.
"Die Menschen tauschen die Wohnungsschlüssel aus, wenn sie in den Urlaub gehen, und egal, ob das ein Muslim ist oder ein Christ oder ein Jude, das funktioniert."
Ein Herzensprojekt: die Gartenstadt Atlantic in Berlin; picobello leben, auch wenn Nicht-ganz-so-gut-Verdiener
Detjen: Scharfe Biegung am Ende des Gesprächs. Wir haben schon über die Gartenstadt Atlantic gesprochen, eine Mustersiedlung am Berliner Gesundbrunnen, also im Nordosten Berlins. Erklären Sie zunächst, was ist eine Gartenstadt, und was ist die Gartenstadt Atlantic.
Wolffsohn: Die Gartenstadtidee ist im späten 19. Jahrhundert in Großbritannien entwickelt worden als Reaktion auf das städtische Elend, genauer gesagt: das Elend der Unterschichten, der proletarischen Unterschichten in den Großstädten. Es fehlte an Luft, Licht, Sonne, und daher die englische Krankheit, sprich Rachitis, und daher auch kein Wunder, dass in England nun das Alternativkonzept zuerst entwickelt worden ist, dass man kleine Siedlungen an den Stadtrand setzte mit kleinen Gartenelementen. Sonnig, weil Mangel an Sonne auch gesundheitsschädlich ist und so weiter. Diese reformarchitektonische oder städtebauliche Konzeption ist in den 20er-Jahren in Deutschland und Westeuropa realisiert worden, meistens genossenschaftlich oder öffentlich finanziert. Die Gartenstadt Atlantic – auch hier eine der wenigen Ausnahmen; in München gibt es die Borstei; hier und da auch andere Ausnahmen – wurde privat finanziert von einem Freund meines Großvaters –

Detjen: Karl Wolffsohn, über den wir schon gesprochen haben.
Wolffsohn: – der Karl Wolffsohn, genau –, ein Freund von ihm, die Familie Ullstein und einem hochinteressanten Sozialdemokraten, Albert Südekum, der einer der Lieblingsfeinde von Wladimir Iljitsch Lenin war. Südekum war nämlich ein revisionistischer Sozialdemokrat, der im Ersten Weltkrieg für die Kriegskredite gestimmt hat und gegen die kommunistischen Abweichler dann 1919 folgende gewesen ist. Also Lenin prägte den Begriff des "Südekumismus" – das ist so wie "Sozialfaschismus" gewesen, also was ganz Schlimmes. So, das war also die Gruppe, die um Karl Wolffsohn die Gartenstadt Atlantic konzipiert und realisiert hat, also Luft, Licht, Sonne, sprich Gesundheit, sozialpolitisch ganz stark konzipiert, bezahlbare Mieten, und noch draufgesetzt das Sahnehäubchen – und das ist die große Ausnahme auch in den reformarchitektonischen Siedlungen der 20er-Jahre –: Kultur und Kultur mit Kino. So, das ist die Grundidee gewesen.
"Ich wollte anknüpfen an das ursprüngliche Konzept"
Detjen: Diese Gartenstadt Atlantic – bewirtschaftet dann in der Nachkriegszeit eher lieblos von Ihrem Vater, Ihrem Onkel – kommt dann nach dem Tod Ihres Vaters in die Hände von Michael Wolffsohn und seiner Frau Rita Wolffsohn und Sie sanieren das und beleben es neu. Was hat Sie da motiviert, was war Ihre Vision, die da am Anfang dahinterstand?
Wolffsohn: Ich wollte anknüpfen an das ursprüngliche Konzept, das mich fasziniert hat, auf das ich aber aufmerksam gemacht worden bin durch meinen Schwager, was das städtebauliche Konzept betrifft, mein Schwager Jörg Braun-Feldweg, der Architekt ist und meine Frau und mich auf dieses Juwel als Juwel aufmerksam gemacht hat.
Detjen: Das muss man kurz sagen: Wer den Namen Braun-Feldweg hört und sich in der deutschen Designgeschichte auskennt, der stößt dann wiederum auf Ihren Schwiegervater, auf den Vater Ihrer Frau Rita Wolffsohn.
Wolffsohn: Richtig. Wilhelm Braun-Feldweg.
Detjen: Braun-Feldweg, einer der großen Designer der Nachkriegszeit.
Wolffsohn: Genau, und das reizte uns natürlich auch, denn die Gartenstadt Atlantic stand und steht unter Denkmalschutz und ist also auch bauhistorisch und ästhetisch hochinteressant. Das würde zu weit führen, das im Einzelnen zu erklären. Also das war ein Motiv. Das zweite Motiv ist die Pietät. Wie gesagt, ich betrachte mich als Teil der Generationenkette. Mein Großvater hat das mitkonzipiert, finanziert und betrieben. Er kam in Gestapo-, sogenannte Schutzhaft, weil 1938 die Nationalsozialisten die Gartenstadt Atlantic rauben wollten zum Nulltarif, und das fand mein Großvater nicht so prickelnd. Er hat sich dem widersetzt und Belohnung – in Anführungszeichen – kam er – in Anführungszeichen – in Schutzhaft, wo er dazu gebracht wurde, wie auch immer, die Gartenstadt Atlantic sogenannten Ariern zu übertragen zum Nulltarif. Das hatte er in zwölf Jahren von 1949 bis 1962 – 1957 starb er – mit meinem Vater gemeinsam erkämpft, zurückerkämpft. Also da sprach auch die Pietät eine Rolle. Deutsch-jüdische Geschichte. Dann einer meiner Lieblingsgegner oder Hauptgegner war Ignatz Bubis, der bekannt war für Sanierungen der unfreundlichen Art und der nicht besonders mieternahen Art. Also da besteht und bestand die, wenn Sie so wollen, kollektive jüdische Verpflichtung zu zeigen, dieses eine Beispiel kann nicht dazu führen, dass man jüdische Immobilienbesitzer insgesamt verunglimpft. Hier besteht die Verantwortung des Individuums gegenüber dem Kollektiv, dem jüdischen ebenso wie dem deutschen Kollektiv gegenüber. Und dann war das eine großartige Aufgabe, die gelungen ist.
"Man kann sehr wohl Kapitalismus mit Ethik verbinden"
Detjen: Diese Aufgabe – das muss man noch mal sagen – hat der Universitätslehrer Michael Wolffsohn und seine Frau angenommen. Sie haben geradezu irrwitzig Schulden aufgenommen, um das zu sanieren, diese Gebäude. Wer heute dort hinkommt sieht ein architektonisches Juwel, aber sieht auch ein tolles soziales Biotop. Da ist eine ganz gemischte Wohnbevölkerung. Es gibt Lehrwerkstätten für Schulkinder, für Jugendliche aus der Umgebung, die dort hinkommen. Erzählen Sie kurz am Ende der Sendung, was jemand sehen kann, der in Berlin zum Gesundbrunnen fährt und sich dann die Gartenstadt Atlantic anschaut.
Wolffsohn: Was er sehen wird: Er wird Häuser sehen, die schmuck aussehen, die architektonisch interessant sind und nicht zuletzt deswegen unter Denkmalschutz stehen. Er wird sehen dass diese Anlage tagtäglich durch ein großartiges Team, das sich Arme und Beine ausreißt für die Mieter, picobello sauber ist. Das, was die Lieblinge der Berliner auf den Straßen hinterlassen als "mh mh mh", das wird zweimal täglich weggeräumt. Also es wird gehegt und gepflegt, denn wenn Mieter sich wohlfühlen, dann achten sie darauf, dass alles weiter picobello bleibt. Also mit anderen Worten, wir haben also auch hier auf das wechselseitige Interesse gesetzt, und jetzt komme ich wieder auf die Generationenkette zurück. Profit – da ist nicht viel Profit zu machen einstweilen – vielleicht bei meinen Enkeln oder Urenkeln –, aber Profit und Ethik, Wirtschaft und Ethik, das habe ich von meinem Großvater gelernt, und das ist übrigens Teil der jüdischen Wirtschaftsgeschichte, und daher auch mein nie vorhandener Antikapitalismus. Man kann sehr wohl Kapitalismus mit Ethik verbinden.
"Unser Leitmotiv war, eine Mischung zu finden"
Detjen: Ein ethischer Profit. Die Gartenstadt Atlantic lag lange in einem toten Eck, eingemauert dann faktisch in einer Ecke von Westberlin, heute muss man am Ende dieser Sendung fragen: Sind Wohnungen frei?
Wolffsohn: Nein, keine einzige. Es gibt da eine Warteschlange natürlich, aber bei uns wird nicht nach Herkunft, Religion oder was auch immer ausgewählt, sondern die Mieter müssen in das Gesamte passen. Es gibt kein einziges Haus, wo Sie also nur türkische, nur deutsche, nur schwarze, nur weiße, nur gelbe Mieter finden, sondern unser Leitmotiv war … Am Anfang hatten wir dafür lange zusätzliche Leerzeiten in Kauf zu nehmen, dass wir eine Mischung erreichen wollten, denn wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Lebensformen friedlich miteinander und nicht nur nebeneinander leben wollen, müssen Sie sich im Alltag erleben, und das ist viel wirksamer als Phrasendrescherei im Bezug auf Integration. Ich kann unseren Hörern nur sagen, erfreulicherweise hat sich das bewährt. Die Menschen tauschen die Wohnungsschlüssel aus, wenn sie in den Urlaub gehen, und egal, ob das ein Muslim ist oder ein Christ oder ein Jude, das funktioniert, ohne Phrase.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.