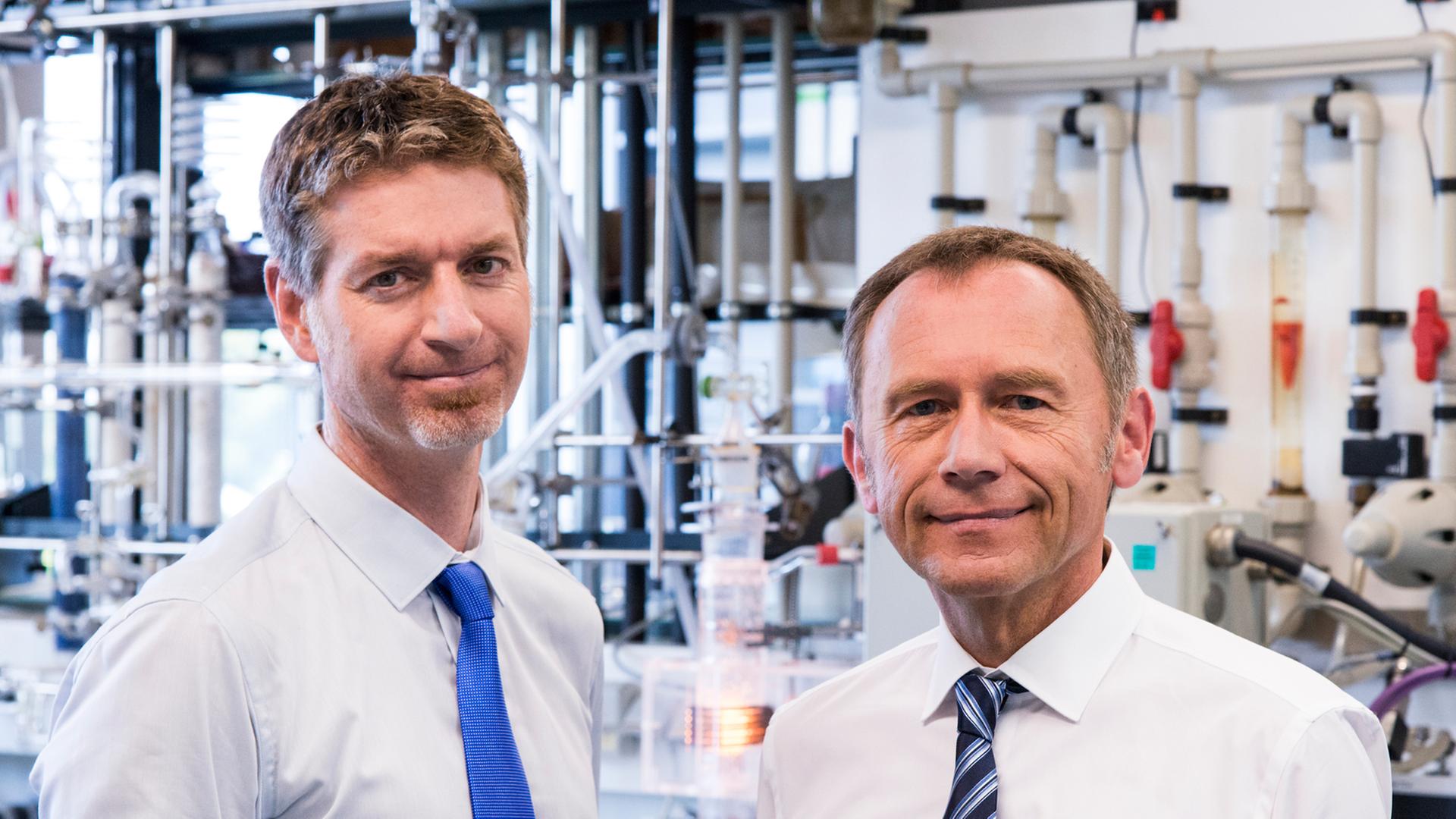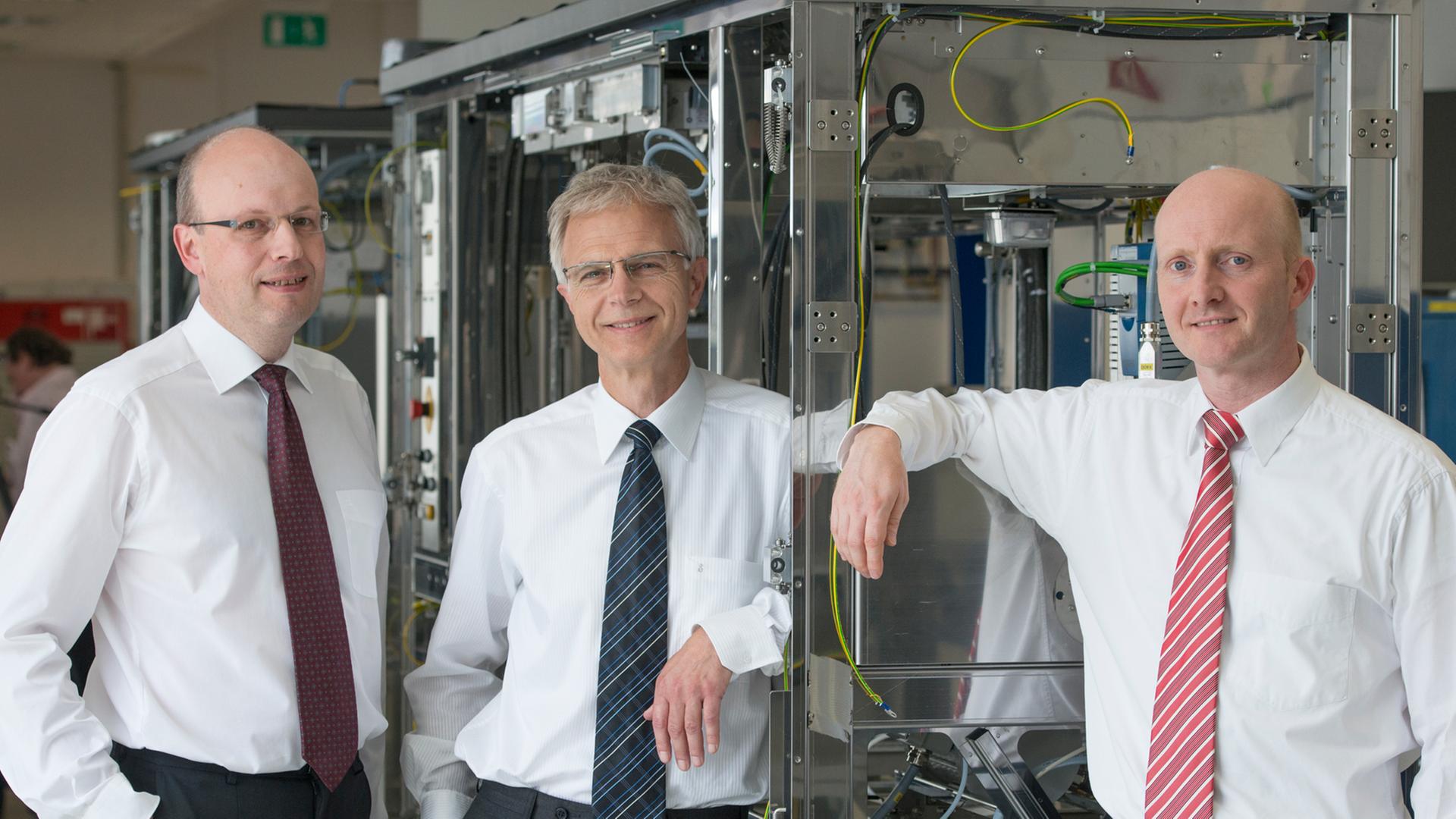James Bond liegt gefesselt auf einer Platte aus Gold. Ein Laserstrahl bohrt langsam, aber kontinuierlich einen Spalt in die Goldplatte - der Laser kommt Bond immer näher und soll ihn töten. Der Bösewicht Goldfinger steht triumphierend daneben. Im James-Bond-Film aus dem Jahr 1964 ist deutlich zu sehen, was Laserexperten heute zu vermeiden versuchen: Dort, wo der Laserstrahl auf das Gold trifft, schmilzt das Material und hinterlässt an den Rändern des Schnitts einen kleinen Wulst aus weggeschmolzenem Gold. Die heutige Lasertechnik ermöglicht hingegen auch sehr präzise Schnitte, ohne dass sich Ränder bilden.
Jens König: "Wir gehen nicht über, wie es bisher üblich war: Ich erhitze irgendetwas, dann schmilzt das langsam und dann verdampft es, so wie man es aus dem Kochtopf kennt. Sondern, wir haben einen ganz anderen Effekt, den nennt man Phasenexplosion, 'phase explosion'. Ich hüpfe in einen Bereich der Thermodynamik hinein und dort reagiert das Material ganz anders als bisher: Es wird förmlich weggesprengt in einer kleinen Explosion."
Jens König von der Firma Bosch in Schwieberdingen bei Stuttgart forscht seit elf Jahren daran, wie man die Lasertechnik für die industrielle Produktion verbessern kann. Zusammen mit Kollegen von der Universität in Jena und dem Laserhersteller TRUMPF in Schramberg im Schwarzwald hat König die Lasertechnik so optimiert, dass das Licht inzwischen in Form extrem kurzer Pulse aus der Lichtquelle strömt. Die Forscher sprechen daher auch von Ultrakurzpulslasern. "Ultrakurz" heißt: Die Lichtpulse sind kürzer als zehn Picosekunden. Denkt man sich die Entfernung von der Erde bis zum Mond als Dauer von einer Sekunde, so wäre einer dieser Lichtpulse etwa drei Millimeter lang. Nur weil die Pulse so kurz sind, ist es möglich, dass das bearbeitete Material nicht schmilzt, sondern abgetragen wird. Zur Veranschaulichung haben die Forscher einen feinen Schriftzug auf einen Streichholzkopf gelasert, ohne dass das Streichholz dabei entflammte.
"Wir arbeiten momentan an ungefähr zehn neuen Produkten, wo wir diese Technik zum Einsatz bringen wollen, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wirklich von der Industrietechnik und Hydraulik über die Elektronik und Mikrosystemtechnik, ganz klar natürlich auch viele Anwendungen im Automobilbereich",
erklärt Jens König. Konkret wird die Ultrakurzpulslasertechnik zum Beispiel für die sogenannte Benzindirekteinspritzung in Automotoren eingesetzt. Dazu werden unterschiedlich große Löcher in einen Ventilkopf gelasert. Diese Löcher können einen kleineren Durchmesser als ein Haar haben und sorgen dafür, dass sich das Benzin gleichmäßig verteilt und an die Stellen gelangt, wo es gut verbrennen kann. Motoren mit so einer direkten Benzineinspritzung verbrauchen aktuell rund 15 Prozent weniger Kraftstoff als ihre Vorläufer - das heißt, es wird bei 100 Kilometern Fahrt etwa ein Liter Benzin gespart.
Die Lasertechnik eignet sich für alle Materialien von Kunststoff bis Diamant. Sehr harte Handydisplays können damit ebenso bearbeitet werden wie sensible medizinische Implantate.
Angesichts der sehr feinen Bearbeitung oft kleiner Materialien erscheint der Ultrakurzpulslaser, den die Forscher in Schwieberdingen benutzen, ganz schön groß: Er hat das Format zweier großer Kühlschränke.
"Hier sieht man jetzt ein Lasersystem der Firma TRUMPF, der hat 100 Watt mittlerer Leistung. Und da kommen 800.000 Impulse pro Sekunde aus dem Gerät heraus."
Der Lichtstrahl wird, bevor er auf das Material trifft, verstärkt und über mehrere Spiegel geleitet, sodass er den entsprechenden Schnitt oder die Gravur wie gewünscht ausführen kann. Aufgebaut ist das gesamte Lasersystem auf dicken Granitblöcken, die vor Stößen und Temperaturschwankungen schützen.
Mit dieser Anlage haben die Forscher für Präsentationszwecke sogar schon eine Weltkarte auf den Kopf einer Strecknadel gelasert. Solche Kunststücke eignen sich zwar nicht für die industrielle Anwendung - dafür aber zum Staunen.