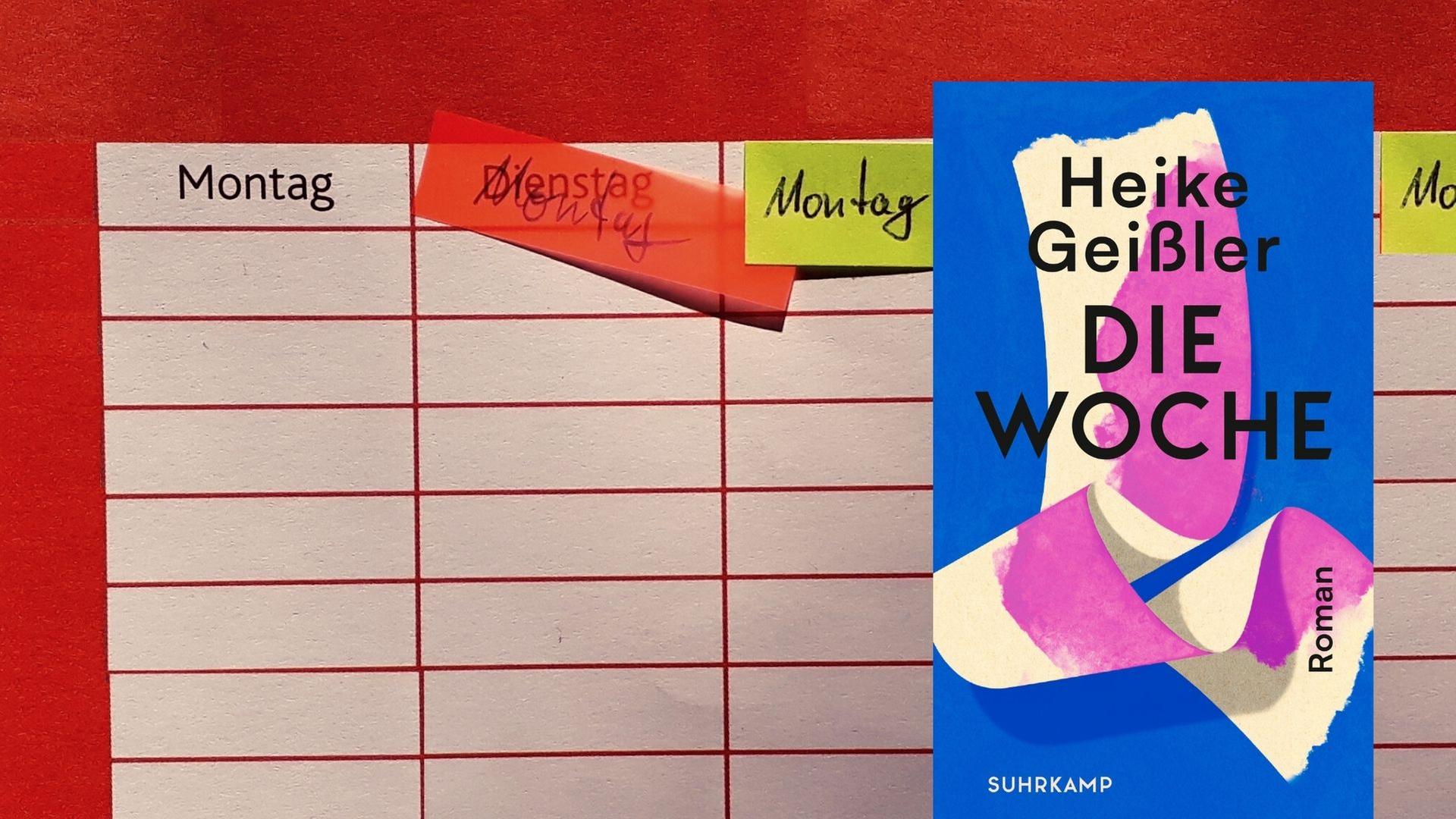
Man könnte den Inhalt dieses Buches so zusammenfassen: Eine vierzigjährige Frau, Arbeiterkind und Kind der DDR, verheiratet, Mutter zweier Söhne im Schulalter, erfährt an ihrem Wohnort Leipzig die Gentrifizierung ihres Stadtteils und die Vertreibung aus ihrer Wohnung, die Invasion von Investoren und das Zerstörungswerk der Baumaßnahmen. Sie erlebt die allwöchentlichen Pegida-Legida-Aufmärsche, die Attacken gegen Flüchtlinge in Freital und Freiberg und die rechten Exzesse in Chemnitz. Sie beobachtet den alltäglichen Krieg, alltägliche Verelendung, alltägliche Gleichgültigkeit. Sie wehrt sich dagegen und ist doch Teil davon.
„Die Politik sorgt dafür, dass alles, was wir je gelernt haben, und alles, was wir unseren Kindern beibringen, ad absurdum geführt ist, dass wir nun getrost allen die Hilfe verwehren (...) können, weil wir nicht mehr wissen, wie wir das Gebot zu helfen innerhalb eines Staates aufrechterhalten können, wenn es an seinen Grenzen außer Kraft gesetzt ist.
Wir würden es ja nie zugeben, aber wir haben der Welt aus Erschöpfung und Überforderung die Liebe entzogen.
Wir schauen der Welt nicht mehr zu.
Wir hören der Welt nicht mehr zu.
Wir gehen mit Tatsachen um, wir gehen an Tatsachen vorbei und zucken ratlos die Schultern.“
Wir würden es ja nie zugeben, aber wir haben der Welt aus Erschöpfung und Überforderung die Liebe entzogen.
Wir schauen der Welt nicht mehr zu.
Wir hören der Welt nicht mehr zu.
Wir gehen mit Tatsachen um, wir gehen an Tatsachen vorbei und zucken ratlos die Schultern.“
Die Zeit spielt verrückt
Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, das Geschehen zu charakterisieren. In einer anderen Version leben zwei proletarische Prinzessinnen, die Ich-Erzählerin und eine andere namens Constanze, zusammen mit den Kindern in einem Schloss, das im Gegensatz zu vielen DDR-Immobilien glücklicherweise nicht von alten Familienerben übernommen wurde. Doch sie werden von Riesen bedroht und belästigt, die in ihrer Straße ein Karussell aufgebaut haben, in Schwung gehalten von Show- und Gefechtslärm, Bildschirmnachrichten, Durchhalteparolen, Applaus – ein fürchterliches Dauerspektakel. Der Tod nistet sich im Haus der Prinzessinnen ein, um endlich auszuruhen. Regelmäßig springt Kasper vom Dach, und immer wieder meldet sich hoffnungsvoll ein unsichtbares, noch ungezeugtes Kind und verspricht Rettung aus allem Unheil, vorausgesetzt, es wird auf die Welt gebracht. Doch nicht nur die Welt ist in diesem Märchen aus den Fugen geraten, auch die Zeit spielt verrückt. Die Woche verlässt die übliche Reihenfolge der Tage und wartet an den unpassendsten Stellen mit Montagen auf.
„Wir kommen also aus einer Reihe von Montagen, wir kommen aus Jahren und Monaten und Tagen der Verdichtung. Wir kommen aus einer Zumutung und Unmöglichkeit. (...)
Dann müssen wir eben in eine andere Richtung gehen. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen, so ein, äh – was ist das hier eigentlich?
Das ist also noch ein Montag.
Man kann es mit den Zumutungen auch übertreiben.
Ich würde sagen, sagt Constanze, mit den Zumutungen wird immer übertrieben.“
Dann müssen wir eben in eine andere Richtung gehen. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen, so ein, äh – was ist das hier eigentlich?
Das ist also noch ein Montag.
Man kann es mit den Zumutungen auch übertreiben.
Ich würde sagen, sagt Constanze, mit den Zumutungen wird immer übertrieben.“
Damit sind wir bei der dritten Möglichkeit, Heike Geißlers Roman „Die Woche“ zu beschreiben: anhand der Lektüreerfahrung, die er bereithält. Gemessen an den hartnäckig überdauernden Kriterien, was ein Roman sei, ist schon diese Gattungsbezeichnung eine Offensive gegen herrschende Kategorien und Lesegewohnheiten. Es fehlen der griffige Plot, die nachvollziehbare Entwicklung und eine ordnende Erzählerfigur, und wer darüber hinaus flüssige Lesbarkeit verlangt, wird von einer untragbaren Zumutung reden. Dem würde die Autorin allerdings mit ihrer Figur Constanze entgegnen, dass mit den Zumutungen immer übertrieben werde, ja werden müsse. Geißler versucht eine Neudefinition, eine Demonstration dessen, was literarisches Engagement heute bedeuten kann, ja buchstäblich eine Gegendemonstration. Während ihre Ich-Figur auf der Straße das Recht auf Platz, das Recht auf Stadt, das Recht auf Verfügung gegen die rechten Krieger und die „besorgten Bürger“ verteidigt, wendet sich die Schriftstellerin gegen die Muster konventioneller Schreibstrategien:
„Am Rand des Krieges sitzt der Tod und sagt: Mir reicht’s.
Am Rand des Krieges sitzt der schönste Roman von allen und will mit keinem Storytelling mehr etwas zu tun haben: You know, lass mal gut sein. (...)
Am Rand des Krieges steht Kasper, der Kasper auf dem Dach, und wird bald wieder vom Dach springen oder fallen, um dann erneut zu springen oder zu fallen.
Am Rand des Krieges bittet das Unsichtbare Kind um Einlass in die Welt und sagt: Die Voraussetzungen sind ungünstig, aber wann waren sie das nicht?“
Am Rand des Krieges sitzt der schönste Roman von allen und will mit keinem Storytelling mehr etwas zu tun haben: You know, lass mal gut sein. (...)
Am Rand des Krieges steht Kasper, der Kasper auf dem Dach, und wird bald wieder vom Dach springen oder fallen, um dann erneut zu springen oder zu fallen.
Am Rand des Krieges bittet das Unsichtbare Kind um Einlass in die Welt und sagt: Die Voraussetzungen sind ungünstig, aber wann waren sie das nicht?“
Widerständige Form
Das Experiment dieses Romans besteht darin, dem Widerstand, von dem er handelt, eine Form zu geben – als poetischer Protest gegen die durch Gewöhnung betäubte, durch Gehorsam entstellte, aus Angst willfährige Wahrnehmung der Gegenwart, unserer Wirklichkeit. Heike Geißler ersetzt die Fiktion einer individuellen Erzählerin durch ein Wir – nicht etwa ein Kollektiv, das die „richtige Seite“ repräsentieren soll, sondern ein dialogisches, schwankendes, aus dem Ich und seinem begleitenden Widerpart Constanze bestehendes Wir. Dieser kleine Chor kommentiert die herrschende Unordnung, sammelt Vorschläge, Klagen, Widersprüche, bündelt Erfahrungen, destilliert Fragen aus der Ratlosigkeit.
„Leute wie wir halten Ausschau nach besseren Gesprächen.
Leute wie wir müssen den Blick freikriegen.
Also ja, wir arbeiten daran, oder was tun wir eigentlich die ganze Zeit? Was sollen wir denn noch alles tun?“
Leute wie wir müssen den Blick freikriegen.
Also ja, wir arbeiten daran, oder was tun wir eigentlich die ganze Zeit? Was sollen wir denn noch alles tun?“
Constanze, die an einer Stelle ihre Tätigkeit als Produktionsassistentin beschreibt, übernimmt hier die Rolle einer Assistentin, einer Unterstützerin in der Arbeit des Textes. Ab und zu greift sie Gedanken und Beobachtungen auf und entwickelt daraus Seminarideen, von einem Seminar mit dem Titel „Für die Katz – Status quo und Zukunft einer Handlungsweise“ bis zu einem Intensivkurs in der Kunst des Absagens. Wie die Erzählinstanz, so ist auch die literarische Realität zwiespältig und gebrochen. Der Behauptung einer kohärenten Wirklichkeit, mehr noch: jedem Gestus des Bescheidwissens begegnet der Roman mit einem Bekenntnis zum Zweifel, zum inneren Widerspruch, zum Paradox:
„Wir können lieben und können nicht lieben.
Wir verfügen über Geld und verfügen nicht über Geld. Es ist auf jeden Fall beides richtig.“
Wir verfügen über Geld und verfügen nicht über Geld. Es ist auf jeden Fall beides richtig.“
Vergiftete Maulwürfe, rechte Aufmärsche
Welche Handlung spielt sich nun auf diese Weise über dreihundert Seiten ab? Erzählt wird von einem vergeblichen Kampf und einem Kampf gegen die Vergeblichkeit. Vom Ringen um Empfindlichkeit und Ungehorsam, bei dem die alltäglichen Beschädigungen ebenso ernst genommen werden wie die Grausamkeiten außerhalb des Blickfelds. Oder ist es unerheblich, wenn eine Gruppe Opernbesucher den Motor ihres Geländewagens aufheulen lässt, nur so zum Spaß, um die Kinder zu erschrecken? Wenn der Nachbar im Garten Mäuse absticht und Maulwürfe vergiftet? Erzählt wird von den wiederholten Anläufen gegen die Wiederholung der Montage, gegen die Aufrüstung der Stadt mit Polizei und Absperrungen, gegen die verlogenen Montagsdemonstrationen und ihren Diebstahl an den Symbolen des Widerstands. Ohne Pegida, AfD, Björn Höcke & Co. zu nennen, wird von dem Aufmarsch in Chemnitz berichtet, bei dem weiße Rosen als Embleme von Ausländerhatz und falscher Trauer missbraucht wurden. Erzählt wird von einem zwischen Entsetzen und Geduld, Auflehnung und Ohnmacht, Aktion und Resignation schwankenden Zustand. Und immer wieder von der eigenen Bravheit:
„Mein alter Gehorsam ist mein ganzer Besitz. Gehorsam, Scham, Angst, Enge.
Die Aussteuerkiste der proletarischen Prinzessin, sagt Constanze.“
Die Aussteuerkiste der proletarischen Prinzessin, sagt Constanze.“
Ein lineares Geschehen ergibt sich daraus nicht. Statt ordentliche Ingenieursarbeit zu leisten und aus Erzählstandpunkt und Perspektive, Figurenkonstellation und Handlungsverlauf die Statik eines stabilen Romangebäudes zu errechnen, setzt die Autorin aus Unmengen von Puzzleteilen ein Bild von der Heillosigkeit unserer Gegenwart und vom Widerstand gegen die Heillosigkeit zusammen. Mit dieser kunstvollen Bricolage setzt Geißler die Arbeit fort, die sie in diversen Publikations- und Ausstellungsprojekten mit Texten, Fotos, Performances, Video- und Audioinstallationen verfolgt. Sie kombiniert die Unmittelbarkeit konkreter Episoden, die Diektheit von surrealen Szenen, Angst- und Wunschbildern mit Gedankenarbeit, unterstützt durch Zitate von Gewährsleuten aus politischer Philosophie und Poesie, bildender Kunst, Situationismus und Anarchismus. Das ist alles andere als unsinnlich. Ein simpler Alltagsaugenblick kann mit ikonischer Intensität auf den Betrachter zurückschauen:
„Im Hintergrund der Eingang zur Osthalle des Bahnhofs. Im Vordergrund links der Punk mit dem Armstumpf, rechts die junge Bettlerin, in einem Buch lesend, hinter sich zwei Krücken in Türkis. Der Punk tänzelt herum, ein Bein angewinkelt in der Luft, das andere gebeugt, aber fest auf der Erde. Hinter dem Mädchen mit den Krücken wartet der Einbeinige im Rollstuhl darauf, dass jemand etwas in seinen geleerten Kaffeebecher wirft, den er auf dem rechten, unbenutzten Tritt des Rollstuhls abgestellt hat. Eine alte Frau kommt auf die Halle zu. Sie hat einen starken Buckel, fast geht sie ganz nach unten gekrümmt, der Kopf hängt Richtung Füße. Mit zwei Tüten, aus denen leere Plastikflaschen ragen, nähert sie sich dem Bahnhof. Dies ist, schreiben wir, eine wahre Geschichte.“
Recht auf Empfindlichkeit
Und Geißler versteht es, wahre Geschichten zu erzählen, ohne in die Klischeefalle zu tappen. Wie ist es, wenn eine junge Frau, die nie das Neinsagen gelernt hat, einer scheinbar erotisch eindeutigen Situation nur mit Scham und Lügen entkommt? Warum ertragen Berliner Partygastgeber keine Anspielung auf das Thema Suizid? Und nebenbei, was hat dort das jüngste Buch von Thilo Sarrazin neben den frisch gekauften Karl Marx-Bänden zu suchen? Wie erklärt sich die peinliche Sehnsucht der Ich-Erzählerin beim Besuch der Buchmesse nach einer freundlichen Geste von Seiten der rechten Wortführer, die da so manierlich am Antaios-Stand plaudern?
Und woher kommt die verfluchte Nettigkeit, mit der sie dem Berlinale-Direktor bei seiner Ansprache widerspruchslos einen jovialen Scherz über Frauenrechte durchgehen lässt? Immer wieder fällt sich die Stimme der Erzählerin selbst mit Fragen und Relativierungen ins Wort. Die herzzerreißende Geschichte von der Krankheit eines ihrer Söhne und der Geburt des anderen endet mit einer brüsken Antipathosformel: „Huch, (...) jetzt haben wir uns aber verplaudert.“ Der Bericht von einem traumatischen Kindheitserlebnis, bei dem ein Betrunkener aus dem Bus fiel oder gar gestoßen wurde und mit dem Kopf auf den Bordstein knallte, wird dagegen mit einer scharfen Vorwärtsverteidigung kommentiert:
„Meine Empfindlichkeit ist keine Schwachstelle. Man kann sich mit einer Anspielung darauf nicht über mich erheben. Gleich ist Empfindlichkeit gar keine Kategorie mehr, sondern ein smarter Ausgangspunkt.“
Nein, die Verletzlichkeit dieser Erzählstimme ist keine Attitüde. Die Weigerung, sich das Recht auf Erschütterung nehmen zu lassen, geht einher mit einer fast ängstlichen Vermeidung sentimentaler Gefühlsäußerungen und die Klage über die Verhältnisse kann stets auf die Sprecherin zurückfallen. Sie ist selbst Teil der Widersprüche, in denen sich Empörung und Verzagtheit, Wut und Hilflosigkeit durchkreuzen, neutralisieren oder in den sinnlosen Wunsch nach Eindeutigkeit münden:
„Ja, sagt Constanze, und wenn es nun lodern würde, das ganze Zerwürfnis, die ganze Erosion. Wenn es laut knallen würde, wenn es nun direkt vor aller Augen in der Mitte des Marktplatzes Tote gäbe, dann wäre es sichtbarer. Wenn wir nun einfach tot umfielen. Aus aktuellem Anlass. Aus Anlass der Gegenwart. Wäre das anschaulicher? Wäre das hilfreich?“
Musivisches Verfahren
So finden Klugheit und Witz, bittere Realsatire und tödlicher Ernst zu einem reflektierten und zugleich spielerischen Ausdruck, der weder in Diskursabstraktion noch in billige Sozialkritik oder gar Rührseligkeit abdriftet. Genau das haben allerdings die Jurymitglieder des Klagenfurter Bachmann-Wettbewerbs behauptet, als sie einem Auszug aus „Die Woche“ mit frappierender Ignoranz mal Konventionalität, mal Unlesbarkeit vorwarfen.
Man konstatierte „Betroffenheitslyrik“ und platte Zeitkritik. Dann wieder vermisste man Antworten und Verständlichkeit für ein „allgemeines Publikum“, fühlte sich emotional nicht hineingezogen und beklagte einen Mangel an „auktorialer Souveränität“. Kurz, man forderte den autoritären Gestus störungsfreier Leseverführung. Die Autorin erprobt dagegen eine Literatur, die für die Darstellung unserer - in Arno Schmidts Worten - „löchrigen Gegenwart“ musivische, also mosaikartige Verfahren anwendet. Solche Verfahren sind beileibe nichts Neues; nach Schmidts eher später Datierung setzten sie mit Lewis Carroll ein. Und tatsächlich erinnert das Vexierspiel von dokumentarischer Zeitgenossenschaft, Märchenwelt und intellektuellem Kommentar an die Aporien von Alice im feindlichen Wunderland.
„Wir schnüffeln nach einem entscheidenden Coup, der alles retten könnte, ach ja, retten, aber wir haben keine Ahnung, wie dieser Coup aufzuspüren sein könnte. (...)
Wir versuchen, die Kuh vom Eis zu holen.
Schau, die schöne Kuh.
Kaum nähern wir uns, explodiert die Kuh und entblößt einen Flammenwerfer. Das Eis ist natürlich auch hin.“
Wir versuchen, die Kuh vom Eis zu holen.
Schau, die schöne Kuh.
Kaum nähern wir uns, explodiert die Kuh und entblößt einen Flammenwerfer. Das Eis ist natürlich auch hin.“
Ähnlich wie Carrolls Alice, die dauernd in der Sackgasse der Sprachlogik landet und mit Witz und Tapferkeit nach einem Ausweg aus der bedrohlichen Traumwelt sucht, unternimmt Geißlers Erzählerinnenduo die ausschweifende Anstrengung, sich einen Reim auf die ungereimten Verhältnisse zu machen, in die sie hineingeraten sind – und das mit den Mitteln einer Sprache, die Lebensnähe mit Phantastik, mündliche Leichtigkeit mit theoretischer Durchdringung verbindet.
Zumutbare Zumutung
An diesem mutigen Versuch lässt sich manches bekritteln. Mal wirkt die rotzig-trotzige Eloquenz manieriert, mal läuft die subversive Albernheit leer. Skeptiker des Sprachwandels wie die Rezensentin mögen sich an der Menge an Anglizismen stören und nebenbei bitter bedauern, dass, wie zu befürchten, der Genderstern Einzug in die Literatur hält. Aber das sind geringe Einwände. Schwerer wiegt, dass der auf buchstäblich epische Breite angelegte Text eine Summe von Ausschnitten ergibt, die als einzelne Elemente immer wieder beleben und erhellen, dem Leser aber in ihrer Aneinanderreihung keine selbsttätige Reise, keine Mitarbeit erlauben. Man folgt den Assoziationen wie am Nasenring, ohne Chance, einen eigenen Horizont zu entwickeln. Der Zusammenhalt, den der Ablauf der durch die eingeschobenen Montagen auf sechzehn Tage und Kapitel verlängerten Woche suggeriert, schafft keinen Phantasieraum. Die Abrundung am Ende erscheint wie eine nachgetragene, rechtfertigende Erläuterung:
„Wir wollen nicht verschweigen, dass die Entwicklungen dieser Woche auch eine Art Rettung waren. Uns wurde durch die feindlichen Parolen und die Notwendigkeit, dagegen zu protestieren, einige Tage lang ein Sinn gegeben, den wir dringend brauchten. (...)
Wir hätten dennoch auf diese Sinnstiftung, diese vermeintliche Rettung von vornherein verzichten können. (...) Wir hatten uns schon längst wieder an die Solidarität geschmiegt und sie nicht mehr als Relikt aus unserer Kindheit empfunden, nicht mehr als totes Wort, sondern als eine Handlung der Liebe, aus Empathie und Notwendigkeit.“
Wir hätten dennoch auf diese Sinnstiftung, diese vermeintliche Rettung von vornherein verzichten können. (...) Wir hatten uns schon längst wieder an die Solidarität geschmiegt und sie nicht mehr als Relikt aus unserer Kindheit empfunden, nicht mehr als totes Wort, sondern als eine Handlung der Liebe, aus Empathie und Notwendigkeit.“
Das ist als Rahmung für ein Mosaik zu dick, als Schluss einer Geschichte zu dünn. Und so ist dieser Text weit eher ein Essay, eine umfassende Selbstverständigung in finsteren Zeiten, als der Roman, der er zu sein erklärt – und durchaus hätte werden können: Man denke an all die offenen epischen Erzählweisen jenseits des bloßen Storytelling, die vielen Werke ohne, wie es im Text spöttisch heißt, „machtvolle Erzählerin“ – von Duras bis Perec, von Handke bis Espedal. Indem das Buch darauf verzichtet, eine Geschichte zu erzählen, ist es also in der Tat eine Zumutung. Doch diese Zumutung ist zumutbar – und sie ist folgerichtig, weil Geißler von Zumutungen spricht und die Ratlosigkeit gegenüber diesen Zumutungen nicht leugnet, sondern hervorkehrt. Das unterscheidet „Die Woche“ etwa von den programmatischen Essays einer Monika Rinck, die zwar auf den ersten Blick verwandte Züge tragen, mit ihrer cool designten Rhetorik aber eher eine Art Wellness für müde Bourgeois-Bohèmiens abgeben. Und die poetisch-politische Prosa Dorothee Elmigers, die sich ebenfalls zum Vergleich anbietet, neigt mittlerweile zur bloßen Kulturtheorie. „Die Woche“ hingegen zeigt bei aller sprachlichen Raffinesse und Gedankenschärfe eine geradezu altmodische, angreifbare Eigenschaft, nämlich Aufrichtigkeit:
„Und die das hier schreibt, der ist das Herz noch warm und der Kopf noch wirr.“
Dieses „Noch“ enthält die ganze Verzweiflung angesichts einer zusehends unbewohnbaren, von mörderischen Akteuren und Institutionen beherrschten Welt – und damit eine Empfindlichkeit, die dringend nötig ist, auch wenn sie ans Leben geht:
„Wir resignieren nie gänzlich.
Wir sind nicht konsequent genug.
Der einzige Vorteil unserer permanenten Unsicherheit ist, dass wir keines unserer Gefühle und Bedürfnisse und keine unserer Meinungen und Entscheidungen für glaubwürdig und angemessen halten.
Das ist, sagt Constanze, der Grund, warum wir noch leben.“
Wir sind nicht konsequent genug.
Der einzige Vorteil unserer permanenten Unsicherheit ist, dass wir keines unserer Gefühle und Bedürfnisse und keine unserer Meinungen und Entscheidungen für glaubwürdig und angemessen halten.
Das ist, sagt Constanze, der Grund, warum wir noch leben.“
Heike Geißler: „Die Woche“
Suhrkamp Verlag, Berlin.
316 Seiten, 24 Euro.
Suhrkamp Verlag, Berlin.
316 Seiten, 24 Euro.

