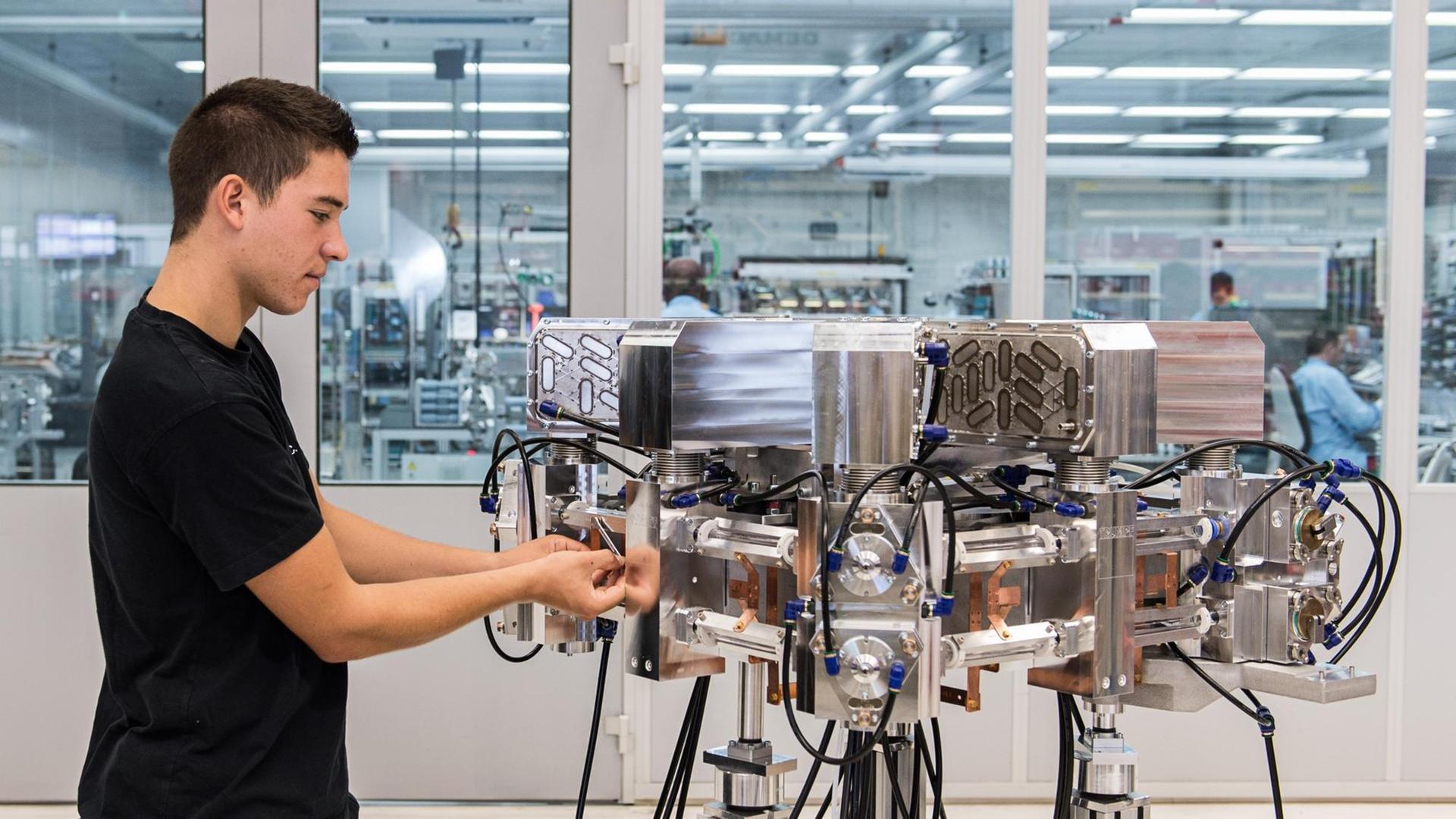Es muss einen Grund geben, warum ausgerechnet viele IT-Pioniere aus dem Silicon Valley zu den Verfechtern eines bedingungslosen Grundeinkommens gehören. Ist es wirklich so, dass Menschen, die nicht unbedingt arbeiten müssen, um zu leben, kreativer sind als andere? Oder trauen die Start-up-Milliardäre ihren eigenen Geschäftsmodellen nicht – und ahnen schon, dass sie mit ihren virtuellen Welten niemals für jenen Wohlstand sorgen können, an den sich die Menschen seit Jahrzehnten gewöhnt haben?
Dies wäre dann ein Beleg für Robert Gordons These: Jene Phase großer technologischer Errungenschaften, die bis in die 70er-Jahre hinein reichte und für breiten Wohlstand sorgte, ist zu Ende, und es wäre klug, sich auf langfristig kleinere Wachstumsraten einzustellen. Trotz Industrie 4.0, Big Data und der großen Digitalisierung der Gesellschaft. Auch wenn die Helden des Silicon Valley etwas anderes behaupten. Gordon nennt sie daher "Techno-Optimisten":
"Sie ignorieren sowohl das langsame Produktivitätswachstum wie auch die Kraft der Gegenwinde. Stattdessen prognostizieren sie eine Zukunft mit spektakulär schnellerem Wachstum, das auf einem exponentiellen Anstieg der künstlichen Intelligenz basiert."
Gordon aber erwartet keine guten Zeiten, auch die künstliche Intelligenz werde uns nicht retten. Der Ökonom von der Northwestern University in Chicago hat ein 760 Seiten schweres Buch vorgelegt, und wer mag, kann es durchaus auch als eine Art groß angelegte amerikanische Wirtschaftsgeschichte lesen. Gordon arbeitet chronologisch, und gerade die Beschreibungen aus einem alten, längst vergangenen Amerika lange vor Facebook und Google sind lesenswert. Es sind Geschichten aus einem Land der Pferdekarren, der holprigen Straßen, einem Land ohne fließend Wasser, aus einer Gesellschaft, in der vor allem Frauen den Tag damit verbringen, schmutziges Wasser gegen sauberes zu tauschen, zu waschen und zu kochen. Ein junges Land an der Schwelle, in dem zunächst weder Wachstum noch Wohlstand eine zentrale Rolle spielen. Noch nicht.
"Bearbeitete Nahrungsmittel waren nicht verfügbar, frisches Fleisch war nicht sicher, also bestand das Essen vor allem aus gepökeltem Schweinefleisch und stärkehaltigen Nahrungsmitteln."
Was, wenn irgendwie schon alles erfunden ist?
Dann ging sie los, die lange Phase des großen Wohlstands. Lange bevor aus Industriegesellschaften Dienstleistungs- und Kommunikationsgesellschaften wurden, war der Kapitalismus vor allem eines: eine gigantische Wachstumsschleuder.
"Das Jahr 1870 markierte den Aufbruch des modernen Amerikas. Über sechs Jahrzehnte lang wurde jeder Teil des Lebens revolutioniert. Bis 1929 wurde das städtische Amerika elektrifiziert. Pferde verschwanden aus den Straßen der Städte, und 90 Prozent der Haushalte waren motorisiert. 1929 hatten die Haushalte Unterhaltungsangebote, die weit weg waren von dem, was man sich 1870 vorstellen konnte: Musik, Radio, Kino."
Rund 100 Jahre später stockt der Wachstumsmotor – irgendwie ist jetzt alles erfunden, hat alles schon seine Wirkung entfaltet. In den 90er-Jahren und um die Jahrtausendwende kommt es noch einmal zu kräftigen Produktivitätsschüben; das Internet und die Mail werden zu Massenwerkzeugen. Aber es reicht nicht. Der Traum von der großen, reicher werdenden Dienstleistungsgesellschaft erfüllt sich nicht, es fehlen die großen Schübe. Was sind fahrerlose Autos gegen die Dampfmaschine, was ist Facebook gegen die Erfindung des Kühlschranks? Selbst der 3D-Drucker, den viele bereits für das nächste große Ding halten, ist es nicht.
"Der 3D-Drucker ist eine andere Revolution, die von den Techno- Optimisten ins Feld geführt wird. Ihr größter Vorteil ist die Möglichkeit, den Designprozess neuer Produkte zu beschleunigen. ( ... ) So könnte sie zu einem Produktivitätswachstum führen, indem sie für mehr Effizienz sorgt und die Einstiegsbarrieren für neue Unternehmer senkt. Aber dies werden keine Effekte sein, die wir in der der gesamten Wirtschaft spüren werden."
Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft auf dramatische Weise, aber sie sorgt nicht für Wachstum und Wohlstand wie andere Industrien in den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Es beginnt schon damit, dass am Ende mehr Menschen durch Computer und Roboter an ihrem Arbeitsplatz ersetzt werden könnten als neue Jobs geschaffen werden.
Gordons Thesen werden durch aktuelle Debatten nicht nur befeuert, sondern auch belegt. Für die Taxi-App Uber sollen nur 6.500 Menschen in fester Anstellung arbeiten, der Wert des Fahrdienstes aus Kalifornien aber wird auf 60 bis 70 Milliarden Euro geschätzt. Für den Autohersteller BMW arbeiten weltweit 122.000 Menschen – sein Börsenwert liegt aber "nur" bei 47 Milliarden Euro. Uber hat also nur wenig Personal – ist aber als Firma angeblich mehr wert als große Traditionskonzerne.
Nicht nur die Geschäftsmodelle der neuen IT-Konzerne sind virtuell – auch ihre Bewertung ist es. Zum Wohlstand der Gesellschaften können sie daher nur begrenzt beitragen, weil sie – angesichts ihrer gesellschaftlichen Bedeutung - doch nur wenige Arbeitsplätze schaffen, die Menschen zu einem nennenswerten sozialen Aufstieg verhelfen.
"Das Problem, das das Computerzeitalter geschaffen hat, ist nicht Massenarbeitslosigkeit, sondern das allmähliche Verschwinden guter, stabiler Jobs auf den mittleren Ebenen, die nicht nur Robotern und Algorithmen zum Opfer gefallen sind, sondern auch der Globalisierung. Dazu kommt, dass Jobs auf unteren Ebenen geschaffen werden, wo die Löhne niedrig sind. Die allmähliche Verlangsamung wirtschaftlichen Wachstums kombiniert einen enttäuschenden Produktivitätszuwachs im vergangenen Jahrzehnt mit einer ständigen Zunahme von Ungleichheit in den vergangenen drei Jahrzehnten."
In einem letzten kurzen Kapitel wird aus dem Ökonomen Gordon dann der Politiker. Der Autor diskutiert die Politik an Schulen, Universitäten, den Mindestlohn, ein gerechteres Steuersystem. Und die Frage, wie sehr Gesellschaften heute auseinanderdriften. Dazu passen Studien aus diesen Wochen: Bei einem Großteil aller Haushalte stagnieren Realeinkommen oder sind rückläufig. Mini-Jobs, Ich-AGs, befristete Arbeitsverträge. Die Mittelschicht chattet mit Smartphones und präsentiert sich auf Facebook - aber sie bangt um das, was sie seit Jahrzehnten aufgebaut hat.
Robert J. Gordon: "Rise and fall of american growth - The U.S. Standard of Living Since the Civil War"
762 Seiten, Princeton University Press, 39.95 Dollar
762 Seiten, Princeton University Press, 39.95 Dollar