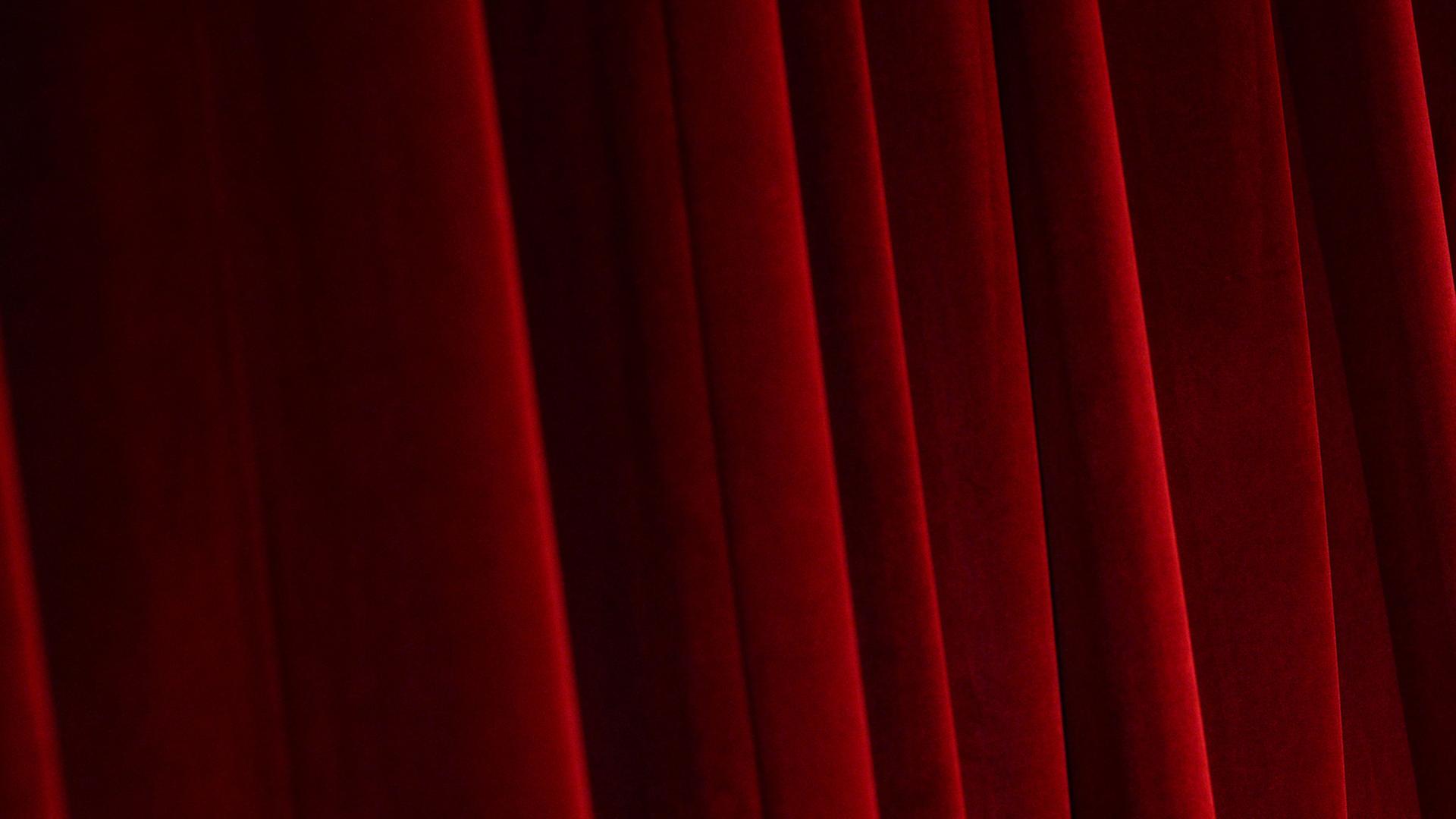Ob verhärmt, depressiv oder erstarrt - jede der drei Schwestern, der Untergeherinnen, ist auf ihre Weise gelähmt von dem Wirklichkeits- und Möglichkeits-Schwund dieses Lebens. Selbst am Namenstag von Irina, der Jüngsten, als mit frischen Blumen, Diwan und Pastetchen alles noch relativ behaglich aussieht, erwachen sie nur für Momente zu einer Art konventionell ritualisierter Lebendigkeit. Ganz wie die Figuren in ihrer Umgebung: Der Schulmann, der sein Wissen wie eine pädagogische Witzfigur prahlerisch denunziert; ein Offizier, der sich in den Selbstverwitzelungen seiner Weltsicht auf einer Art Schrottplatz banalster Philosophie verliert; der Doktor, ein spielsüchtiger Alkoholiker, der trostlos in das Loch seiner leeren Seele starrt.
Schließlich der Bruder, der einer verpassten Traum-Karriere nachjammert und von einer durchsetzungsfähigen Frau gekapert wird, die alles in ihren Augen Überkommene kurzerhand als entbehrlich abschafft, die Reste funktionsfreier Humanität inclusive. Das alles fast beiläufig, geschwätzig und en passant. Sie interessiert sich für die Banalität des Untergehens und sammelt die Ingredienzien dieses schleichenden Vorgangs, Splitter von Kommunikationsprozessen, die an jeder beliebigen Stelle anfangen oder aufhören könnten - ohne je weiterzuführen.
Ohne funktionierenden Dialog erlahmt Handlung
Man muss nicht taub sein wie der alte Diener: Keiner hört dem anderen zu. Da der Dialog nicht mehr funktioniert, erlahmt auch die Handlung, die nur von Außenimpulsen belebt kurz aufflackert: wie der Großbrand, der für Momente erregt - aber nur schwache Gesten von Hilfsbereitschaft auslöst. Und als die "Lebensdroge Regiment" abzieht, bleiben die Schwestern wie abgeschnittene Marionetten zurück, stumm, hilflos aneinander gelehnt, beklemmend, anrührend - aber auch das nur für Momente. Dauerhaft ohne Perspektive. Hoffnungsfrei. Ohne jeden aktualisierenden Gestus gerät diese von großartigen Schauspielern beglaubigte Erfahrung so auch zu einer erschreckenden Gegenwartsanalyse.
In der zweiten Premiere zum Zürcher Spielzeitbeginn, "Bartleby", einer Theateradaption von Melvilles weltbekannter Erzählung, bringt ein sanfter Verweigerer ein wie geschmiert laufendes System ebenso eifriger wie Perspektive-loser Reproduktion zur Auflösung - und geht dabei selbst vor die Hunde. Auch die Regisseurin Mélanie Huber verzichtet auf pathetische Momente und große Gefühle - außer solchen der aberwitzig komischsten Art. Die skurril selbstgefällige Arbeitswelt des Notars und seiner Schreiber, die Ingwerplätzchen-krümelnd und tintenklecksend, korrekturbesessen wie verstaubte Ärmelschoner- und Hosenträgergespenster in den Gestellen der Kanzlei herumgeistern, ist samt der ihr Tun und Nichtstun rhythmisierenden oder äffenden Katzenmusik ebenso unernst wie virtuos - eine schreiend komische Vorhölle Kafkaesker Verwaltungssysteme. Und dann geraten der dezent selbstgefällige Rechtsanwalt und sein auf fragloses Funktionieren angelegtes System aus dem Takt: durch den blassen, rätselhaften Scheiber Bartleby und einen einzigen Satz, der freilich geeignet ist, jede Welt des Funktionierens und der Unterordnung im Kern zu treffen.
Protagonist Bartleby fehlt, ist aber präsent
Die kluge zweite und innovative Idee dieser Aufführung: Sie verzichtet vollständig auf den eigentlichen Protagonisten Bartleby - und lässt ihn dennoch als vollständig präsent erscheinen. Jedes Wort, jeder Blick, alle Gesten und Verrenkungen, Bestürzung und Groll gelten der ominösen Figur, dem still und arbeitsam hinter einem Paravent Verborgen; unsichtbar, und doch vorhanden, ohne das Arbeitsklima nennenswert zu stören - so stellt sich der Chef diese Art von Inklusion am Anfang vor. Mit der durchschlagenden Wirkung von sanfter, ebenso grundloser wie kompromissloser Verweigerung hat er nicht rechnen können. Schlimmer noch: Allmählich fressen sich Partikel des Prinzips Bartleby in das eigene Verhalten. Mit der Welt des Reproduzierens gerät auch der Bühnenaufbau aus den Fugen, das Antiprinzip vervielfacht sich - und alle rationalen Erklärungsversuche für dieses albtraumartige Gespenst bleiben Spekulation. An diesen beiden Abenden zeigt das Theater, dass es, wie kaum eine andere Institution fähig ist, Lücken zuzulassen, Ambivalenzen virtuos zu inszenieren und Fragen zu stellen, statt sie zu beantworten.