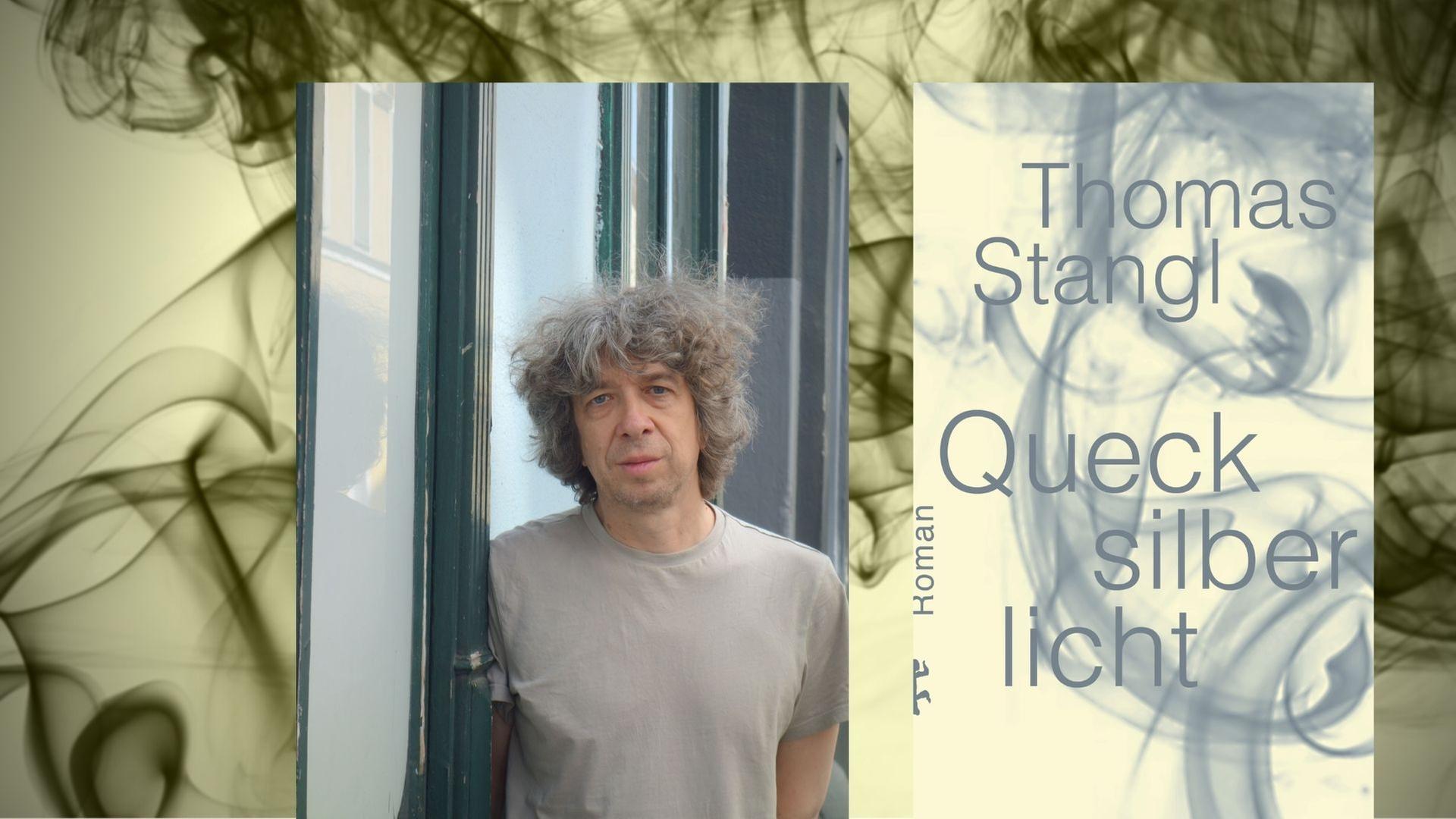
Quecksilber kann steigen und fallen, und manchmal steckt eine große Unruhe darin. Unberechenbar sind die Kügelchen, die beim Zerbrechen eines Thermometers auseinanderspringen. Das Quecksilberlicht, das der Roman von Thomas Stangl im Titel führt, kennt die Unruhe, aber auch das träge Fließen großer Ströme. Fette Sterne hüllt es in fadenscheinigen Glanz, es ist
„ein giftiges quecksilbernes Leuchten, das in den Sätzen wohnt und mit den Sätzen stirbt.“
„ein giftiges quecksilbernes Leuchten, das in den Sätzen wohnt und mit den Sätzen stirbt.“
Aus dem Zimmer, in dem der Autor schreibt, fällt der Blick auf einen Wiener Hinterhof, in dem einmal eine kleine Synagoge gestanden hat. Sie wurde 1938 in Brand gesetzt und ist verschwunden. Der Autor baut sie in seinem Roman für ein paar Zeilen wieder auf. Seine Mutter war 1938 sieben Jahre alt, in der Familienüberlieferung sind die Worte aufbewahrt, in denen ein Bekannter ihrer älteren Schwester fröhlich davon berichtet, wie er Juden mit vorgehaltener Waffe in den Tod hat springen lassen.
Durchbrochene Linien
Der Autor kennt die Muster, in die er seine Figuren einzeichnen könnte. Aber er scheut die Vertrautheit, die diese Muster mit sich bringen, und so schreibt er den Familienroman über seine Großmütter und deren Herkunftswelten nicht. Aber er verstreut seine Eltern und Vorfahren über den Roman: die „linke“, in die kommunistische Bewegung, und die „rechte“, in den Nationalsozialismus hineinragende Familiengeschichte, er markiert ihre Schauplätze im IX. Bezirk Wiens, unweit von Schlachthof, Viehmarkt und Gaswerk.
Er porträtiert sich selbst, den Enkel, der an die Bücher, ans Lesen und ans Schreiben geraten ist. In seinem Buch gibt es statt einer verlässlich voranschreitenden Erzählung nur durchbrochene Linien, plötzliche Querverbindungen zwischen Figuren weit entfernter Schauplätze und Zeiten. Einmal porträtiert der Autor sich selbst beim Schreiben dieses Buches.
„Ein Buch über alles im Himmel und auf Erden schreiben, aufgesammelte Geschichten und Erfahrungen, ein Buch über chinesische Kaiser, englische Dichterinnen, Großmütter, Nazis, Hinterhöfe, das Feuer und die Leere, die Toten und ihr Geschrei, die Literatur und London und mich und sich selbst. Über das Leben und den Tod, von beiden Seiten her, aus dem Innern der Gruft, übers Bett gebeugt, aus den Seiten der Bücher heraus, unter dem stinkenden Himmel. Ich hole mir ein Bier aus dem Kühlschrank.“
Auf den chinesischen Kaiser Quin Shiuhangdi, der durch eine Bücherverbrennung die Vergangenheit auslöschen wollte und die große Mauer erbauen ließ, ist Thomas Stangl durch einen Essay von Jorge Luis Borges gestoßen. Dieser Kaiser geistert als eine Figur unbeschränkter Macht und Opfer der eigenen Souveränität durch den Roman, er stirbt an dem Quecksilber, das ihm Unsterblichkeit sichern soll.
Ein großes Arsenal an Figuren
Mit seinem Mausoleum, seinen zahllosen Opfern, seinen Kanzlern und Philosophen hätte er eine Erzählung von Kafka oder Borges ganz für sich. In diesem Roman muss er sich damit bescheiden, eine Nebenfigur zu bleiben. Im Stimmengewirr der ersten Person Singular, der oft von Absatz zu Absatz wechselnden Figuren, die durch das „Ich“ gleiten, kommen die englischen Dichterinnen aus dem 19. Jahrhundert häufiger zu Wort, und nicht nur sie allein.
An die Seite von Emily Brontë, Charlotte Brontë und Anne Brontë treten der Bruder Patrick Branwell, der erfolglose Künstler, und der Vater, der Pfarrer in Haworth, Yorkshire, dazu die älteren toten Schwestern Maria und Elizabeth, ein ganzer Chor von Gespenstern.
Es gibt einige Kollektivbiographien über die Brontë-Schwestern und die Phantasiewelten, die sie von Kindheit an entwerfen. In Thomas Stangls Roman werden die Leben nicht auserzählt. Er entführt sie der Literaturgeschichte, holt sie hinein in die Geschichte der eigenen Kindheit, spiegelt seinen Weg zur Autorschaft in den Umschlagspunkten, an denen in Yorkshire das Leben ins Schreiben überging. Er umgibt die Schwestern mit ihren Romanschatten, den Figuren aus „Wuthering Heights“, „Jane Eyre“ oder „Agnes Grey“ und lässt den Bruder Branwell aus dem Hintergrund hervortreten, stattet ihn mit einer reichen Innenwelt aus.
Als Zeuge der Autorschaft seiner Schwestern, die er als Maler und Zeichner ins Bild setzt, der Chronist des Schreckens, der Krankheiten und niedergehenden Lebenskurven im Haus des Pfarrers, auch der eigenen Lebenskurve. Den unberühmten Branwell, den Gescheiterten, den Trinker holt Thomas Stangls Ich-Erzähler besonders nah an sich heran.
„Ich schreibe, so wie Branwell, Zeitungen ganz für mich allein. Ich fülle sie mit Fußball und Skiergebnissen, Branwell mit Kriegs und Kolonialabenteuern und halb verdauter Zeitgeschichte (die Greuel der Französischen Revolution, der Held Wellington). Bei mir tauchen allerdings auch Cowboys, Revolverhelden, Indianer auf. Ich bin acht oder neun, er ist schon zwölf. Mit seinen Schwestern und immer öfter alleine verfasst Branwell Sonderaus gaben des Blackwood Magazine, sonderbare Sonderausgaben: July 1829 Branwell’s Blackwood Magazine / P B Cheif Genius // 1829 July / Cheif Glass Town. // Printed and sold / by / Searg. Tree &c &c &c.“
Die Stimme des Satans
Der chinesische Kaiser stirbt. Die Großmütter sterben. Die Brontë-Schwestern sterben. Es gibt viele Sterbeszenen in diesem Roman. Die ausführlichste hat Thomas Stangl Branwell gewidmet. Der Sohn lebt und stirbt im Zimmer seines Vaters, der aus der Stimme des Sohnes die des Satans herauszuhören glaubt. Auch die toten Schwestern sind dabei. Emily, Charlotte und Anne werden ihn überleben.
„Der Satan, der Pastor, seine Schwestern und er selbst, sie stehen im Kreis um sein Bett und schauen ihm zu, Anne, die Kleinste, schreibt alles auf. Als sollte die Scham ihn überleben.“
Wer unordentliche, in durchbrochenen Linien erzählte, von Reflexionen durchsetzte Romane nicht scheut, wird in diesem Roman viel über die Bergung von Erinnerungen in Literatur, über die Innenansichten von Schriftstellerexistenzen und über den Autor Thomas Stangl erfahren. Er hätte allerdings besser daran getan, Branwell Brontë das Zitat des letzten Satzes aus Franz Kafkas „Prozess“ zu ersparen. „Als sollte die Scham ihn überleben“ – eine so pompöse Grablegung passt zu dem Sohn und Bruder, der hier stirbt, nicht.
Thomas Stangl: "Quecksilberlicht"
Verlag Matthes & Seitz, Berlin
267 Seiten, 25 Euro.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin
267 Seiten, 25 Euro.

