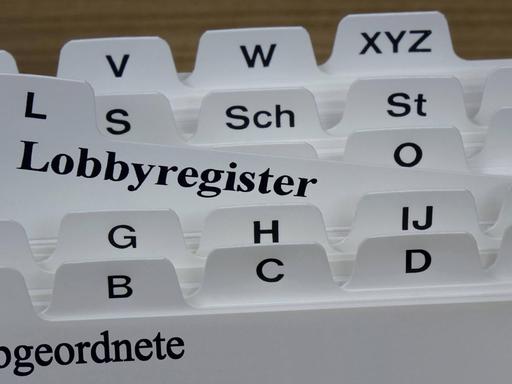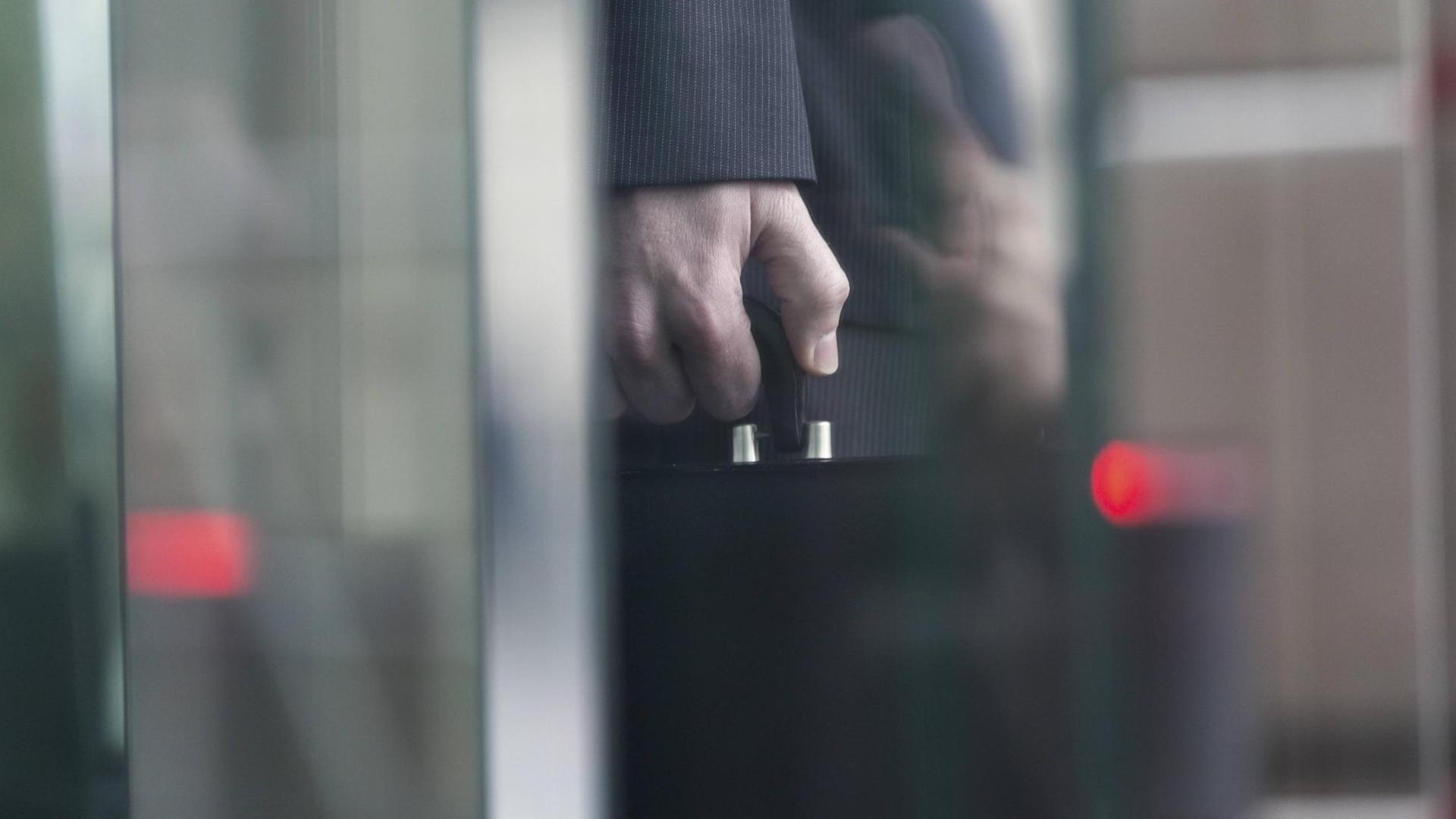
Egal ob Finanzbranche, Wirtschaft oder Autoindustrie: Sie alle versuchen mit Millionenaufwand und Hunderten Lobbyisten, Einfluss auf Gesetze im Bundestag zu nehmen. Das ist nicht illegal, war aber lange sehr intransparent. Immer wieder forderten deshalb nicht nur Korruptionsexpertinnen und -experten, sondern auch Politikerinnen und Politiker strengere Vorgaben für Lobbiysten.
Dass es eines Lobbyregisters bedarf, zeigte beispielsweise im März 2021 die Maskenaffäre der beiden Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) und Georg Nüßlein (CSU) sowie des bayerischen Landtagsabgeordneten und ehemaligen bayerischen Justizministers Alfred Sauter (CSU). Sie sollen sich während der Corona-Pandemie bei der Beschaffung von Masken persönlich bereichert haben, indem sie Ankäufe vermittelt und dafür Provisionen erhalten haben. Der Bundesgerichtshof sah den Vorwurf der Bestechlichkeit bei Nüßlein und Sauter nicht erfüllt. Auch Löbel durfte seine Provision behalten.
Den entscheidenden Schub für die Schaffung eines Lobbyregisters lieferte aber bereits 2020 die Causa Philipp Amthor. Der CDU-Politiker hatte für das US-Unternehmen "Augustus Intelligence" lobbyiert und im Gegenzug Aktienoptionen erhalten. Seit dem 1. Januar 2022 ist nun das Lobbyregister in Kraft. Dort muss sich eintragen, wer "Interessenvertretung betreibt, die nach dem Lobbyregistergesetz eintragungspflichtig ist". Wie das genau aussieht und welche Strafen bei Verstößen drohen: ein Überblick.
Wie funktioniert das Lobbyregister?
Das Lobbyregister wird seit Anfang 2022 auf der Internetseite des Deutschen Bundestags geführt. Dort müssen sich Lobbyisten in eine Datenbank eintragen. Das gilt für alle, die Kontakt zu Abgeordneten, deren Mitarbeitern, Fraktionen und der Bundesregierung aufnehmen. Ausnahmen gibt es für Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände - sie müssen sich laut Gesetz nicht ins Lobbyregister eintragen, können das aber freiwillig tun.
Abgefragt werden unter anderem Auftraggeber der Lobbyisten, Themenfelder sowie der personelle und finanzielle Aufwand ihrer Lobbytätigkeit bei Bundestag und Bundesregierung. Sie sind verpflichtet, sich an einen vorgegebenen Verhaltenskodex zu halten. Alle Einzelheiten regelt ein Handbuch.
Ob die Einträge der Lobbyisten stimmen, überprüft die Bundestagsverwaltung. Acht Mitarbeiter (Stand Januar 2023) des Referats ZR 6 kümmern sich darum. In einer schriftlichen Antwort auf eine ARD-Anfrage heißt es:
"Um ein möglichst hohes Maß an Integrität und Authentizität des Lobbyregisters sicherzustellen, prüft die Register-führende Stelle alle neu-veröffentlichten oder vollständig aktualisierten Registereinträge in einem aufwendigen Verfahren akribisch auf Plausibilität und Widerspruchsfreiheit."
Wer eine Angabe – vorsätzlich oder fahrlässig – nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert, handelt nach dem Lobbyregister-Gesetz ordnungswidrig und muss mit Geldbußen von bis zu 50.000 Euro rechnen.
Was ist Lobbying?
Als Lobbying wird die Vertretung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Interessen gegenüber der Politik verstanden. Sie ist als solche legitimer Bestandteil von Demokratie. Lobbyisten versuchen, im Sinne ihrer eigenen Interessen oder der ihrer Kunden beratend auf Gesetzgebungsverfahren einzuwirken - in öffentlichen Anhörungen, zu denen Vertreter von Interessengruppen eingeladen werden, um ihre Stellungnahmen abzugeben, aber auch abseits der Öffentlichkeit. Lobbyisten können Unternehmen sein, Verbände, Institutionen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen.
Der Deutsche Bundestag vergibt auch Hausausweise an Lobbyorganisationen, damit diese an Sitzungen und Terminen teilnehmen und ihre Anliegen vorbringen können. Im Januar 2022 wurden diese "Zugangs- und Verhaltensregeln" reformiert. Seitdem darf einen Ausweis nur noch beantragen, wer von der Registrierungspflicht im Lobbyregister befreit ist. Das sind Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände und die Kirche. Laut der Organisation "Abgeordnetenwatch" nutzen diverse Akteure diese Option im vergangenen Jahr für sich. So hätten auch Verbände der Immobilien- und Rüstungslobby einen Hausausweis für den Bundestag erhalten, weil sie von der Bundestagsverwaltung als Arbeitgeberverbände eingestuft worden seien.
Dass Lobbyismus nicht grundsätzlich schlecht oder anrüchig ist, meinen auch Expertinnen und Experten. So werde die Expertise von Lobbyisten in der Politik gebraucht, sagte die ehemalige Wirtschaftsjournalistin und aktuelle Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung, Elisabeth Niejahr, im Deutschlandfunk Kultur im Juni 2020. "Wir wollen ja auch in den Ministerien nicht nur Juristen haben, die gar nicht wissen, wie ihre Gesetze in der Praxis wirken." Lobbyarbeit müsse aber maximal transparent gemacht werden, so Niejahr.
Welche Branchen sind besonders aktiv beim Lobbying?
Nach einer Auswertung der Bürgerbewegung "Finanzwende" vom Januar 2023 ist keine andere Branche unter den 100 finanzstärksten Lobbyakteuren so stark vertreten wie die Finanzbranche. Das gehe aus dem öffentlich einsehbaren Lobbyregister des Bundestags hervor, erklärte der Verein. Demnach sind 11 der 100 Lobbyakteure mit den größten Budgets Banken, Versicherungsunternehmen und Investmentgesellschaften.
Die im öffentlichen Auftreten ebenfalls mächtige Autobranche war zum Zeitpunkt der Auswertung mit sechs Einträgen unter den 100 finanzstärksten Lobbyisten vertreten, der Energiesektor mit neun Einträgen. Zusammen geben die Top-10-Konzerne und -Verbände der Finanzlobby der Auswertung von Finanzwende zufolge im Jahr mehr als 42,5 Millionen Euro für Kontaktpflege und den Versuch der Beeinflussung von Politik aus.
Spitzenreiter bei den Lobbyausgaben ist laut der Bürgerbewegung "Finanzwende" der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Er vertritt die Interessen von Versicherungsunternehmen und investierte 2021 dafür rund 15 Millionen Euro. Bis zu 150 Lobbyisten waren für den GDV tätig.
Worum geht es beim "exekutiven Fußabdruck"?
Der "exekutive Fußabdruck" soll die Bundesregierung verpflichten, offenzulegen, wer konkret wie an einem Gesetzestext mitgewirkt hat. Das fordert die Organisation "Lobbycontrol" schon lange. Die meisten Gesetzentwürfe würden in den Ministerien geschrieben, weshalb für Unternehmen und Verbände dort also der beste Ansatzpunkt sei, Bedenken zu artikulieren oder gar ganze Formulierungen zu platzieren, argumentiert "Lobbycontrol".
SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem Koalitionsvertrag eine Nachschärfung des von der Vorgängerregierung eingeführten Lobbyregisters vorgenommen - dabei soll es auch um einen "exekutiven Fußabdruck" gehen. Bislang ist das jedoch noch nicht angestoßen.
Welche Transparenzregeln gab oder gibt es in Deutschland?
- Verbändeliste: Von 1972 bis Ende 2021 führte der Deutsche Bundestag eine öffentliche Verbändeliste, in die sich Verbände eintragen konnten, die gegenüber Bundestag und Bundesrat Interessen vertraten. Mit der Registrierung waren aber keine Rechte und auch keine Pflichte verbunden.
- Abgeordnetengesetz: Für Bundestagsabgeordnete gilt das Abgeordnetengesetz, in dem geregelt ist, welche Nebentätigkeiten und -einkünfte angezeigt werden müssen. Als unzulässig ist darin explizit die Annahme von Geld oder von geldwerten Zuwendungen genannt, die nur deshalb gewährt werden, weil dafür die Vertretung und Durchsetzung der Interessen des Leistenden im Bundestag erwartet wird. Abgeordnetenbestechung ist auch laut Strafgesetzbuch eine Straftat – für Mandatsträger ebenso wie für diejenigen, die versuchen, diese zu bestechen.
- Karenzzeiten: Seit 2015 gibt es auch eine Karenzzeit-Regelung für den Wechsel von der Politik in die Wirtschaft. Das Gesetz sieht für amtierende oder ehemalige Mitglieder der Bundesregierung eine Anzeigepflicht vor, wenn sie beabsichtigen, innerhalb von 18 Monaten nach ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung einer Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes nachzugehen. Die angestrebte neue Beschäftigung kann für ein Jahr untersagt werden, maximal für 18 Monate. "Lobbypedia", ein durch den Verein "Lobbycontrol" finanziertes Online-Lexikon, sammelt alle Fälle ab 2005, in denen Kanzler, Ministerinnen, Staatssekretäre und Abteilungsleiterinnen die Seiten gewechselt haben.
Quellen: Björn Dake, Lobbycontrol, dpa, nv, nsh