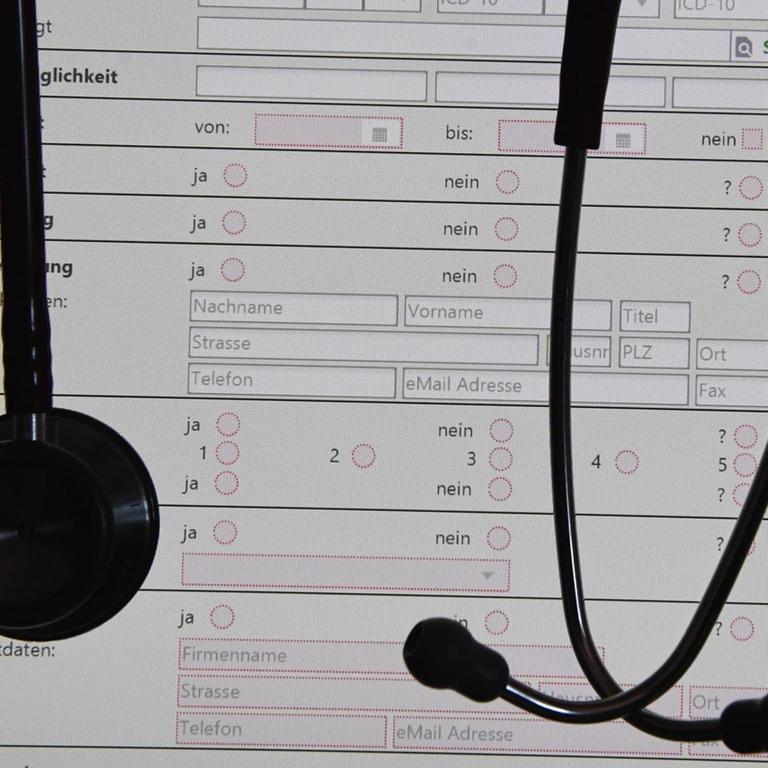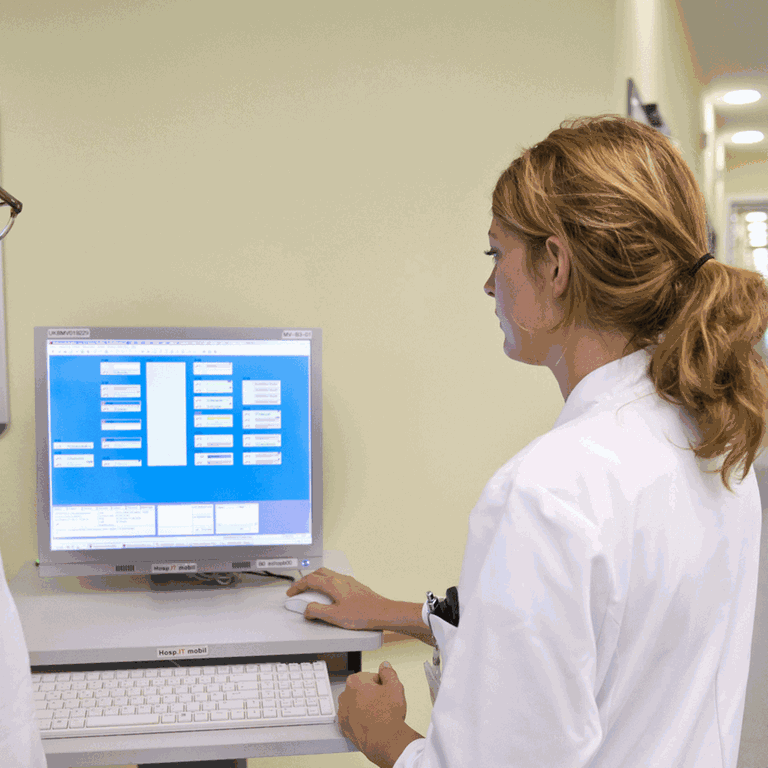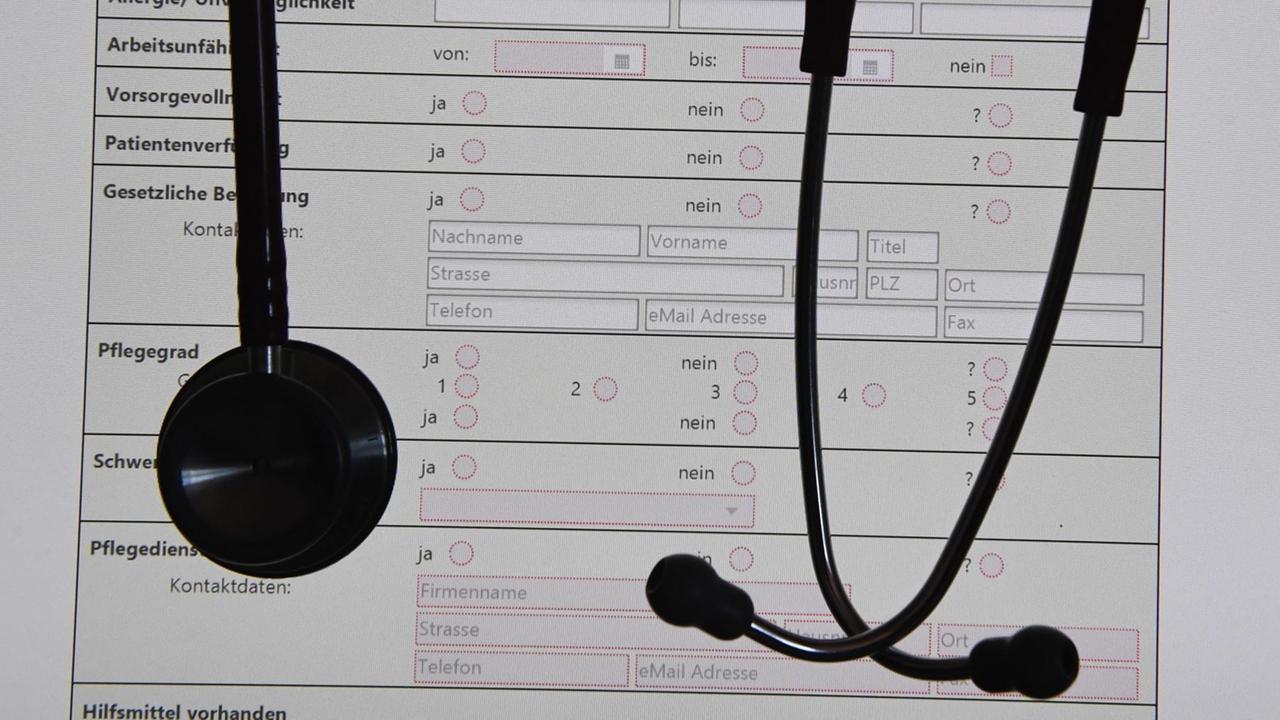"Also in das Lesegerät muss ich meinen Arztausweis reinschieben, dann muss ich einen sechsstelligen PIN eingeben."- Andreas Lipécz ist das, was man einen technikaffinen Arzt nennen kann. Er ist im Vorstand eines der ältesten Arztnetze in Deutschland. Im Norden Nürnbergs sind darin mehr als 130 Mediziner in 65 Praxen zusammengeschlossen. Auch auf den Start der Elektronischen Patientenakte ist Lipécz vorbereitet.
Der Hausarzt weiß, was zu tun ist, wenn ein Patient seine Daten in der Praxis über einen so genannten Konnektor gemeinsam mit dem Arzt eingeben und sortieren möchte: "Dann muss der Patient seine Chipkarte einschieben, muss ebenfalls einen sechsstelligen PIN eingeben. Dann darf ich irgendwelche Dinge machen. Und wenn ich dann aber etwas abspeichere, dann muss ich einen zweiten sechsstelligen PIN angeben, der quasi meine Signatur ist."
Mit Beginn dieses Jahres ist ein Vorhaben Wirklichkeit geworden, das bis ins Jahr 2003 zurückreicht: Eine Zusammenstellung wichtiger Gesundheitsdaten – von einem Notfall-Datensatz, in dem zum Beispiel lebensbedrohliche Allergien verzeichnet sind, bis zu einem digitalen Impfpass. Eine elektronische Patientenakte könnte Leben retten und Milliardensummen sparen, so versprach es die SPD-Politikerin Ulla Schmidt, als sie das Projekt als damalige Gesundheitsministerin auf den Weg brachte.
Ein Gesetz mit langer Vorlaufzeit
Seitdem hat die Führung des Ministeriums vier Mal gewechselt. Der amtierende Ressortchef Jens Spahn von der CDU zeigte sich im Sommer 2020 bei der Vorstellung des Gesetzes zuversichtlich, dass in der deutschen Gesundheitsversorgung eine neue Ära beginnt:
"Wo die Zeiten vorbei sind, wo man selbst im Kopf haben musste, welche Medikamente man jeden Tag nimmt. Die Zeiten vorbei sind, wo man selbst die Röntgenbilder oder MRT-Bilder mitbringen musste auf CD-ROM oder im großen Umschlag. Die Zeiten vorbei sind, wo es am Ende immer auf Papier Rezepte gibt, sondern die gibt es in Zukunft eben als elektronische Rezepte, als E-Rezepte. Und all das macht für die Patienten und für alle, die sie behandeln, den Alltag leichter. Und das – und das ist das Entscheidende – bei höchstem Datenschutz."
"Wo die Zeiten vorbei sind, wo man selbst im Kopf haben musste, welche Medikamente man jeden Tag nimmt. Die Zeiten vorbei sind, wo man selbst die Röntgenbilder oder MRT-Bilder mitbringen musste auf CD-ROM oder im großen Umschlag. Die Zeiten vorbei sind, wo es am Ende immer auf Papier Rezepte gibt, sondern die gibt es in Zukunft eben als elektronische Rezepte, als E-Rezepte. Und all das macht für die Patienten und für alle, die sie behandeln, den Alltag leichter. Und das – und das ist das Entscheidende – bei höchstem Datenschutz."
Auch viele der gesetzlichen und privaten Krankenversicherer waren in den vergangenen Jahren überzeugt, dass die Patienten die Möglichkeit einfordern, Daten digital speichern zu können. Sie haben deswegen angefangen, mit Software-Unternehmen eigene Lösungen zu entwickeln. Diese freiwilligen Angebote tragen allerdings nicht den Namen Elektronische Patientenakte, sondern Elektronische Gesundheitsakte. Die Privatversicherer Allianz, Gothaer und Barmenia bieten gemeinsam mit rund 20 gesetzlichen Kassen ihren zusammen rund 18 Millionen Versicherten eine App mit dem Namen Vivy an. Die größte bundesweite Kasse, die Techniker Krankenkasse, hat für ihre fast elf Millionen Versicherten eine Gesundheitsakte namens TK-Safe im Angebot.

Wenn man Ärztinnen und Ärzte fragt, ob ihre Patienten diese Angebote ihrer Versicherer nutzen, bekommt man allerdings oft die gleiche Antwort, die der Nürnberger Hausarzt Andreas Lipécz gibt: "Also erstaunlicherweise hatte ich da noch niemanden, der danach gefragt hat, dass er da irgendwie Befunde rein haben wollte oder mir da drin Befunde gezeigt hat."
Tatsächlich beziffert etwa die Allianz Private Krankenversicherung die Zahl der Kunden, die die Gesundheitsakte Vivy nutzen, auf mehrere Tausend. Bei 600.000 Voll-Versicherten entspricht das einem Anteil von rund einem Prozent. Die Techniker Krankenkasse berichtet über rund 250.000 Nutzer ihres Angebots namens TK-Safe – das sind gut zwei Prozent der knapp elf Millionen Versicherten der TK.
Tatsächlich beziffert etwa die Allianz Private Krankenversicherung die Zahl der Kunden, die die Gesundheitsakte Vivy nutzen, auf mehrere Tausend. Bei 600.000 Voll-Versicherten entspricht das einem Anteil von rund einem Prozent. Die Techniker Krankenkasse berichtet über rund 250.000 Nutzer ihres Angebots namens TK-Safe – das sind gut zwei Prozent der knapp elf Millionen Versicherten der TK.
Die Sprecherin der Kasse, Silvia Wirth, hofft, dass das Projekt neuen Rückenwind bekommt, wenn es mit Beginn dieses Jahres für Kassen und Ärzte Pflicht wird, mit Elektronischen Patientenakten zu arbeiten. Allerdings warnt sie vor zu großen Erwartungen: "Also für unsere Versicherten ändert sich zunächst nicht so viel. Denn es ist ja so, dass es nicht der Big Bang ab dem 1. Januar ist, sondern, dass die Patientenakte so gedacht ist, dass es ein iterativer Prozess ist, und die Funktionen nach und nach kommen werden."
Langsame Datenharmonisierung
Ein iterativer Prozess, also ein Prozess, in dem sich schrittweise etwas ändert, ist die Elektronische Patientenakte in der Tat. Zunächst müssen alle gesetzlichen Kassen ihren Versicherten eine App für Smartphone oder Tablet anbieten, mit der sie Gesundheitsdaten sammeln können: "Das bedeutet, Sie haben automatisch eine Übersicht über ihre verordneten Medikamente, über Arztbesuche, über Behandlung, Krankenhausaufenthalte oder Impfungen. Sie können also einfach nachschauen: Wann war ich das letzte Mal beim Zahnarzt oder wann habe ich zum letzten Mal ein Antibiotikum genommen."
Solche Informationen einzutragen, ist aber zunächst Aufgabe der Patienten. Dass auch Ärztinnen und Ärzte die Elektronische Patientenakte bestücken, und untereinander Daten ihrer Patienten austauschen, soll zunächst nur in einem Probebetrieb in ausgewählten Praxen in Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen getestet werden. Erst ab Anfang Juli sollen alle Kassenärzte und -psychotherapeuten verpflichtend an die so genannte Telematik-Infrastruktur angeschlossen sein. Dieses mit besonders hohen Sicherheitsstandards ausgestattete Datennetz ermöglicht es, Daten aus der Patientenakte abzurufen und in sie einzutragen oder elektronische Rezepte auszutauschen. Ab dem Jahr 2022 folgen weitere Funktionen wie etwa ein digitales Zahnbonusheft, in dem dokumentiert wird, ob Patienten die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen haben.

Auch der Mutterpass, das Kontrollheft für Kinder-Früherkennungsuntersuchungen und der Impfpass sollen ab 2022 digital genutzt werden können. Nach Ansicht der Sprecherin der TK Silvia Wirth ist das überfällig: "Ich denke, es ist anachronistisch, dass wir einfacher beim Onlineshopping schauen können, wann unsere Lieferung da ist, was wir als Letztes bestellt haben, als dass es möglich ist, dass wir unsere Gesundheitsdaten sicher und zentral gespeichert haben und auch entsprechend nachschauen können, und über alle Daten verfügen."
Dafür, dass es bei der Einführung der Elektronischen Patientenakte zu jahrelangen Verzögerungen gekommen ist, gibt es viele Gründe. Zunächst sollten Verbände von Ärzten, Krankenkassen, Apothekern und Kliniken das Projekt im Auftrag der Bundesregierung voranbringen. Doch in der Gesellschaft namens Gematik, die die Verbände dafür einrichteten, gab es ständig Konflikte und Blockaden. Die wollte Bundesgesundheitsminister Spahn beenden, indem er Mitte 2019 den Staatsanteil in der Gematik auf eine Mehrheit aufstockte.
Dafür, dass es bei der Einführung der Elektronischen Patientenakte zu jahrelangen Verzögerungen gekommen ist, gibt es viele Gründe. Zunächst sollten Verbände von Ärzten, Krankenkassen, Apothekern und Kliniken das Projekt im Auftrag der Bundesregierung voranbringen. Doch in der Gesellschaft namens Gematik, die die Verbände dafür einrichteten, gab es ständig Konflikte und Blockaden. Die wollte Bundesgesundheitsminister Spahn beenden, indem er Mitte 2019 den Staatsanteil in der Gematik auf eine Mehrheit aufstockte.
Nicht per Beschluss beenden konnte die Bundesregierung allerdings die technischen Probleme bei den Firmen, die sich um die Entwicklung der notwendigen Apparate kümmern sollten. Und auch die Diskussionen über die Datensicherheit konnte die Regierung nicht per Beschluss beenden. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber, formulierte im vergangenen Sommer eine Grundsatzkritik an den Zugriffsrechten auf bestimmte Informationen. Kelber, dessen Behörde bundesweit über die Einhaltung von Datenschutzregeln wacht, stört sich vor allem an einem: Versicherte können zum Start der Patientenakte ihre Gesundheitsinformationen nur entweder allen Ärzten zugänglich machen können – oder gar keinem.
"Das hat zur Folge, dass man eben keineswegs mehr frei und individualisiert entscheiden kann, welcher Leistungserbringer, also welcher Arzt zum Beispiel, welche Informationen sieht. Es ist nicht möglich, bestimmte Informationen vor einigen Ärzten zu verbergen, anderen sie zu geben. Damit entsteht eine elektrische Patientenakte, die nicht das Beste für die Versicherten bietet."
"Das hat zur Folge, dass man eben keineswegs mehr frei und individualisiert entscheiden kann, welcher Leistungserbringer, also welcher Arzt zum Beispiel, welche Informationen sieht. Es ist nicht möglich, bestimmte Informationen vor einigen Ärzten zu verbergen, anderen sie zu geben. Damit entsteht eine elektrische Patientenakte, die nicht das Beste für die Versicherten bietet."
Große Bedenken wegen Datensicherheit
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz hatte deswegen noch kurz vor dem Start der Elektronischen Patientenakte schwerwiegende Bedenken: "Ich komme zu dem Ergebnis, dass dieser Vorgang tatsächlich ein Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung ist." Kelber ermahnte deshalb die Krankenkassen im November, dafür zu sorgen, dass bei der Einführung der Patientenakte nicht gegen europäische Regeln zum Datenschutz verstoßen wird. Damit kamen die Kassen aber in ein Dilemma.
Bundestag und Bundesrat haben sie per Gesetz verpflichtet, die Patientenakte auf eine bestimmte Weise einzuführen. Und die technischen Voraussetzungen, um die Zugriffsrechte in der Patientenakte so zu gestalten, wie es nach Ansicht des Bundes-Datenschutzbeauftragten das Europarecht vorsieht, werden erst in etwa einem halben Jahr geschaffen sein. Als Ausweg aus diesem Dilemma haben sich der Datenschutzbeauftragte und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen Ende November darauf geeinigt, dass die Kassen online umfangreiches Info-Material bereitstellen, damit die Versicherten wissen können, worum es geht. Die entsprechende Broschüre umfasst nicht weniger als 21 Din-A-4-Seiten Text.
Es gibt allerdings auch Fachleute, die die Intensität der Bemühungen um den Datenschutz nicht mehr nachvollziehen können: "Im internationalen Vergleich ist Deutschland am restriktivsten, was die Auslegung von Datensicherheit und Datenschutz angeht. Das ist ja beides wichtig, das ist ja überhaupt kein Zweifel, aber die Datenschutz-Grundverordnung gilt ja in allen EU-Mitgliedsländern. Nach unserer Wahrnehmung gibt es kein Land, das sie so eng auslegt wie wir."
Ferdinand Gerlach ist Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt am Main und Vorsitzender des Gesundheits-Sachverständigenrates der Bundesregierung. Im November hat er gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern auf Anregung der Barmer Krankenkasse ein Thesenpapier dazu erstellt, was Deutschland aus der Coronakrise lernen sollte. Für den Chef des Sachverständigenrates gibt es beim Thema Digitalisierung eine klare Erkenntnis: Sie hätte viel helfen können, um die Pandemie besser einzudämmen – etwa wenn die Corona-Warn-App ihren Nutzern wirklich Orientierung bieten würde.
Aber auch, dass es noch keine Elektronische Patientenakte gibt, hält Gerlach für ein Armutszeugnis: "Und ich will dazu sagen: Es ist fahrlässig und ethisch bedenklich, wenn man Daten missbraucht. Aber es ist auch fahrlässig und ethisch bedenklich, wenn man vorhandene Daten nicht bestmöglich nutzt. Wir könnten die Pandemie besser beherrschen, wir könnten auch Krankheiten besser diagnostizieren und behandeln, wenn wir die vorhandenen Daten besser nutzen würden."
Im Dschungel der Versicherungen
Die gleiche Einschätzung hat Boris Augurzky vom RWI-Leibniz-Institut in Essen. Der Gesundheitsökonom sieht Deutschland beim Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens im Vergleich zu anderen Ländern viele Jahre im Rückstand: "Wenn Sie es vergleichen mit Ländern, die da weiter vorangeschritten sind, vor allem im skandinavischen Bereich – Estland, Dänemark – dann haben wir noch einen großen Weg vor uns. Aber wir müssen natürlich mal beginnen."
Er selbst habe in Dänemark erleben können, dass Patienten mit großer Selbstverständlichkeit digitale Gesundheitsakten pflegen, mit denen sie verschiedene Ärzte über ihre Krankengeschichte informieren, erzählt Augurzky. Allerdings sei das Gesundheitssystem etwa in Dänemark weit stärker zentral vom Staat geregelt als hierzulande. Deutschland hat über hundert gesetzliche und rund 50 private Krankenversicherer. Es gibt siebzehn Kassenärztliche Vereinigungen – eine mehr als es Bundesländer gibt, denn Nordrhein-Westfalen hat zwei KVen. Dazu kommt noch die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Es gibt siebzehn Landesärztekammern und die Bundesärztekammer. Es gibt Apothekerkammern und daneben weitere Apothekerverbände, es gibt Krankenhausgesellschaften – und damit ist die Liste der Verbände noch nicht zu Ende, stellt der Gesundheitsökonom Augurzky fest:
"Ich lerne auch ständig noch neue kennen, nach fast 20 Jahren jetzt im Gesundheitswesen. Und da hat jeder so seine eigene Interessenlage. Und für manche davon ist Elektronische Patientenakte eher etwas, was sie nicht möchten. Es gibt auch viele, die sie wollen. Aber es gibt halt auch widerstrebende Interessen. Und deswegen überrascht es mich nicht, wenn es da welche gibt, die sozusagen auf die Bremse treten."
Er selbst habe in Dänemark erleben können, dass Patienten mit großer Selbstverständlichkeit digitale Gesundheitsakten pflegen, mit denen sie verschiedene Ärzte über ihre Krankengeschichte informieren, erzählt Augurzky. Allerdings sei das Gesundheitssystem etwa in Dänemark weit stärker zentral vom Staat geregelt als hierzulande. Deutschland hat über hundert gesetzliche und rund 50 private Krankenversicherer. Es gibt siebzehn Kassenärztliche Vereinigungen – eine mehr als es Bundesländer gibt, denn Nordrhein-Westfalen hat zwei KVen. Dazu kommt noch die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Es gibt siebzehn Landesärztekammern und die Bundesärztekammer. Es gibt Apothekerkammern und daneben weitere Apothekerverbände, es gibt Krankenhausgesellschaften – und damit ist die Liste der Verbände noch nicht zu Ende, stellt der Gesundheitsökonom Augurzky fest:
"Ich lerne auch ständig noch neue kennen, nach fast 20 Jahren jetzt im Gesundheitswesen. Und da hat jeder so seine eigene Interessenlage. Und für manche davon ist Elektronische Patientenakte eher etwas, was sie nicht möchten. Es gibt auch viele, die sie wollen. Aber es gibt halt auch widerstrebende Interessen. Und deswegen überrascht es mich nicht, wenn es da welche gibt, die sozusagen auf die Bremse treten."
Und es werde nicht etwa nur aus Datenschutzbedenken auf die Bremse getreten, glaubt Augurzky. Der Gesundheitsökonom ist sicher, dass vor allem Ärzteverbände und viele einzelne Ärzte, ebenso wie viele Krankenhäuser, einen ganz bestimmten Effekt der Digitalisierung nicht sonderlich schätzen: "Dann haben Sie auch Transparenz über das Versorgungsgeschehen und können dann auch plötzlich mal schauen, welche Versorgungsmaßnahmen was bringen. Und dann können Sie auch gut von schlecht besser unterscheiden. Das ist nicht überall so erwünscht, da hat man im deutschen Gesundheitswesen nicht so den Hang, sich so in diesen, sage ich mal, Qualitätswettbewerb hineinzubegeben."
Ein Qualitätswettbewerb könnte allerdings einiges an Geld sparen, ist sich Augurzky sicher. Wenn von den 300 Milliarden Euro, die jedes Jahr im deutschen Gesundheitswesen bewegt werden, nur zwei Prozent eingespart würden, wären das schon sechs Milliarden Euro. Vor allem aber könnten Patienten besser behandelt werden, sagt Augurzky: "Das heißt dann eben auch: Weniger Fehler entstehen. Ich habe dann ja zum Beispiel auch gerade von multimorbiden Menschen, die verschiedene Krankheiten haben, eine Information vorliegen und kann dann auch erkennen, ob es Komplikationen geben könnte, die man ohne Wissen dieser breiten Information nicht kennen würde."
Der Lipobay-Skandal als Ansporn
Tatsächlich bekamen die Pläne, eine digitale Patientenakte einzuführen, vor allem durch den Lipobay-Skandal vor rund 20 Jahren Schwung. Bei Patienten, die sowohl den von Bayer entwickelten Blutfett-Senker Lipobay einnahmen, als auch bestimmte andere Medikamente, traten in tausenden Fällen schwere Wechselwirkungen auf. Todesfälle wie die durch Lipobay zu verhindern, war eines der Ziele, das sich die damalige Bundesregierung im ersten Gesetz zur Einführung einer Elektronischen Gesundheitskarte im Jahr 2003 gesteckt hatte. Und es sollte allgemein darum gehen, die Versorgung zu verbessern.
Dieses Ziel sei immer noch sehr wichtig, findet der Gesundheitsökonom Boris Augurzky: "Wir könnten dann schauen, welche Behandlungen sind wie erfolgreich und könnten die weniger erfolgreichen runterfahren und die erfolgreichen hochfahren. Und das wird am Ende auch Leben retten." Nicht nur Kosten sparen, sondern die Behandlung verbessern und Leben retten.
Auch der Vorstand der Allianz Privaten Krankenversicherung Daniel Bahr hofft darauf, dass die Elektronische Patientenakte ganz neue Möglichkeiten eröffnet: "Und dann wird es wirklich erst losgehen. Das wird der Booster sein für die Digitalisierung im Gesundheitswesen." Bevor er den Vorstandsposten in der Krankenversicherungssparte der Allianz übernahm, war Bahr von 2011 bis 2013 Bundesgesundheitsminister. Als hauptberuflicher FDP-Politiker konnte er selbst Erfahrungen damit sammeln, wie schwierig es war, die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzubringen. Jetzt aber breche eine ganz neue Phase an, ist er sich sicher:
"Das ist wie mit einer Autobahn: solange die nicht gebaut ist, kann auf der Autobahn auch noch nichts fahren. Aber sobald die Autobahn eröffnet ist, dann wird der Verkehr schon kommen, dann wenn die Leute schon mit ihrem Auto diese Autobahn benutzen und die Vorteile davon sehen, dass sie auf der Autobahn schneller vorankommen vielleicht als es bislang auf der Landstraße der Fall war mit Ampeln."
Für die privaten Krankenversicherer stehen an den Auffahrten zur Gesundheits-Datenautobahn allerdings erst einmal Ampeln, die rotes Licht zeigen. Ihr Branchenverband war 2012 aus der Gesellschaft Gematik, die das Projekt entwickelte, ausgestiegen. Erst im April 2020 sind die Privatversicherer wieder zurückgekehrt. Deshalb konnten sie jahrelang nur von außen zusehen, wie die Elektronische Patientenakte für Kassenpatienten vorbereitet wurde. So ist die Plastik-Chip-Karte, mit der alle gesetzlich Versicherten ausgestattet sind, ein wesentliches Element, um Zugang zur Telematik-Infrastruktur zu bekommen, über die die Patientendaten künftig ausgetauscht werden sollen.
"Das ist wie mit einer Autobahn: solange die nicht gebaut ist, kann auf der Autobahn auch noch nichts fahren. Aber sobald die Autobahn eröffnet ist, dann wird der Verkehr schon kommen, dann wenn die Leute schon mit ihrem Auto diese Autobahn benutzen und die Vorteile davon sehen, dass sie auf der Autobahn schneller vorankommen vielleicht als es bislang auf der Landstraße der Fall war mit Ampeln."
Für die privaten Krankenversicherer stehen an den Auffahrten zur Gesundheits-Datenautobahn allerdings erst einmal Ampeln, die rotes Licht zeigen. Ihr Branchenverband war 2012 aus der Gesellschaft Gematik, die das Projekt entwickelte, ausgestiegen. Erst im April 2020 sind die Privatversicherer wieder zurückgekehrt. Deshalb konnten sie jahrelang nur von außen zusehen, wie die Elektronische Patientenakte für Kassenpatienten vorbereitet wurde. So ist die Plastik-Chip-Karte, mit der alle gesetzlich Versicherten ausgestattet sind, ein wesentliches Element, um Zugang zur Telematik-Infrastruktur zu bekommen, über die die Patientendaten künftig ausgetauscht werden sollen.
Doch Privatversicherte haben keine solchen Karten. Und der Allianz-Vorstand Bahr will sie auch nicht einführen: "Die elektronische Gesundheitskarte ist eigentlich eine veraltete Technologie. Heute hat man keine Karte mehr, heute hat man Applikationen, hat man digitale Lösungen auf dem Smartphone."
Bleibt die Patientenakte unvollständig?
Die Elektronische Patientenakte soll zwar möglichst stark über Smartphones und Tablets verbreitet werden, was auch Privatversicherten einen Zugang ermöglicht. Und die Akte soll in den nächsten Jahren Stück für Stück mit neuen Funktionen ausgestattet werden – Mediziner wie der Nürnberger Hausarzt Andreas Lipécz haben aber die Befürchtung, dass die Patientenakte dabei in vielerlei Hinsicht Stückwerk bleiben wird. Lipécz, der auch im Vorstand eines der größten Arztnetze Deutschlands ist, hat zwar Verständnis dafür, dass das Thema Datenschutz großgeschrieben wird, aber wenn die Patienten jederzeit ganz alleine ohne Rücksprache mit ihren Ärzten ihre Patientenakte verändern können, sieht er die Gefahr, dass wichtige Informationen entfernt werden.
"Das sehe ich vor allem als Hausarzt als Problem. Weil ich ja wirklich unter Umständen die Behandlung von mehreren Ärzten koordinieren muss. Und wenn ich nicht weiß, was der Psychiater für Medikamente verschrieben hat, dann habe ich auch keine Chance, das bei einer eigenen Medikamentenverordnung zu berücksichtigen, geschweige denn das dann noch zu kombinieren mit der Medikamenten-Verordnung von einem Urologen oder irgendwem anders."
Der Arzt könne seine Patienten natürlich immer fragen, ob alle Allergien oder alle Medikamente, die sie nehmen, in der elektronischen Akte vermerkt sind, sagt Lipécz – aber genau das tue er jetzt ja auch schon: "Wofür brauchen wir dann eine Patientenakte? Wenn sie genauso unvollständig bleibt wie das, was ich erfragen kann." Lipécz erwartet deshalb nicht, dass in absehbarer Zeit eine allzu große Zahl seiner Patienten die neue digitale Akte nutzen wird: "Ich würde es auf die Patienten beschränken wollen, wo ich wirklich weiß, dass sie wirklich viele Arzt-Kontakte außer zu ihrem Hausarzt haben. Wo es wirklich sinnvoll ist, damit diese besser zusammenarbeiten können, dass die da reinschauen können auf gemeinsame Daten."
Und obwohl er selbst viele Chancen in der Digitalisierung sieht und auch in seiner Praxis eine eigene App nutzt, um mit seinen Patienten zu kommunizieren, ist Lipécz in einer Hinsicht sehr zurückhaltend. Wirklich intime Informationen vermerkt er nicht in den digitalen Akten, die er in seiner Praxis führt. "Unsere persönlichen Notizen schreiben wir da nicht rein. Das finden wir, ist auch ein Stück weit Datenschutz. Das heißt: Selbst wenn wir gehackt werden sollten – das ganz Intime, Persönliche, daran kommt man nicht dran." Und Lipécz glaubt, dass das viele seiner Kollegen ähnlich halten werden. Deshalb ist er überzeugt: Die Digitalisierung wird immer wichtiger im Gesundheitswesen. Aber auch Karteikarten und Kugelschreiber werden noch lange zum Einsatz kommen.
"Das sehe ich vor allem als Hausarzt als Problem. Weil ich ja wirklich unter Umständen die Behandlung von mehreren Ärzten koordinieren muss. Und wenn ich nicht weiß, was der Psychiater für Medikamente verschrieben hat, dann habe ich auch keine Chance, das bei einer eigenen Medikamentenverordnung zu berücksichtigen, geschweige denn das dann noch zu kombinieren mit der Medikamenten-Verordnung von einem Urologen oder irgendwem anders."
Der Arzt könne seine Patienten natürlich immer fragen, ob alle Allergien oder alle Medikamente, die sie nehmen, in der elektronischen Akte vermerkt sind, sagt Lipécz – aber genau das tue er jetzt ja auch schon: "Wofür brauchen wir dann eine Patientenakte? Wenn sie genauso unvollständig bleibt wie das, was ich erfragen kann." Lipécz erwartet deshalb nicht, dass in absehbarer Zeit eine allzu große Zahl seiner Patienten die neue digitale Akte nutzen wird: "Ich würde es auf die Patienten beschränken wollen, wo ich wirklich weiß, dass sie wirklich viele Arzt-Kontakte außer zu ihrem Hausarzt haben. Wo es wirklich sinnvoll ist, damit diese besser zusammenarbeiten können, dass die da reinschauen können auf gemeinsame Daten."
Und obwohl er selbst viele Chancen in der Digitalisierung sieht und auch in seiner Praxis eine eigene App nutzt, um mit seinen Patienten zu kommunizieren, ist Lipécz in einer Hinsicht sehr zurückhaltend. Wirklich intime Informationen vermerkt er nicht in den digitalen Akten, die er in seiner Praxis führt. "Unsere persönlichen Notizen schreiben wir da nicht rein. Das finden wir, ist auch ein Stück weit Datenschutz. Das heißt: Selbst wenn wir gehackt werden sollten – das ganz Intime, Persönliche, daran kommt man nicht dran." Und Lipécz glaubt, dass das viele seiner Kollegen ähnlich halten werden. Deshalb ist er überzeugt: Die Digitalisierung wird immer wichtiger im Gesundheitswesen. Aber auch Karteikarten und Kugelschreiber werden noch lange zum Einsatz kommen.