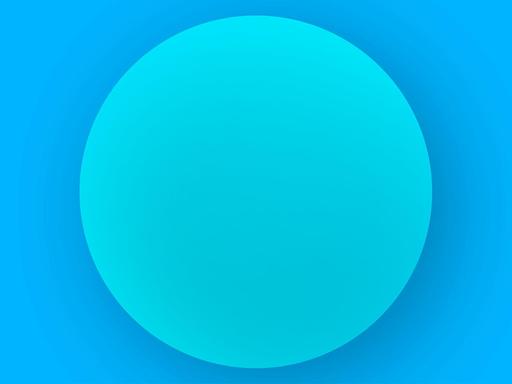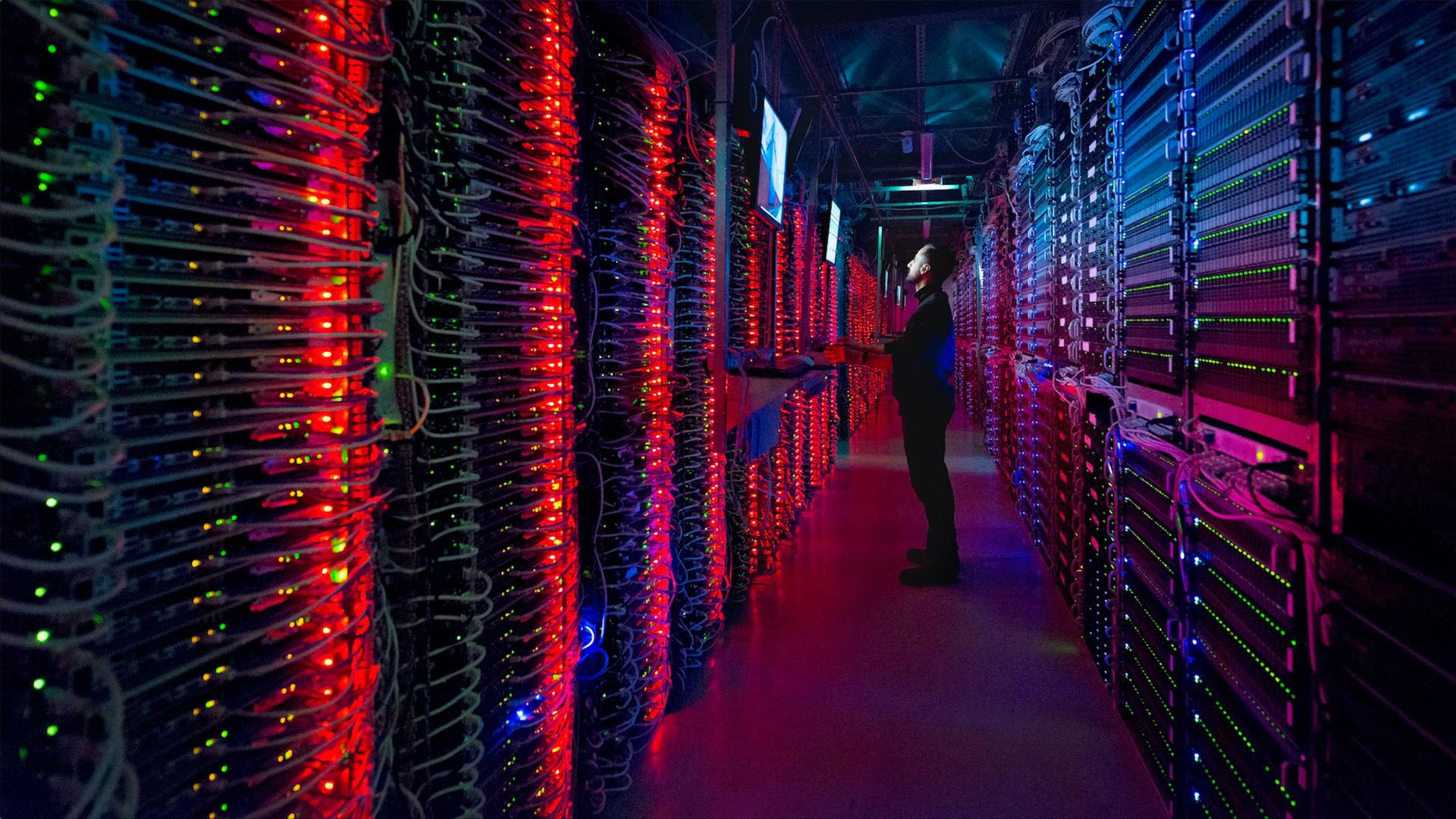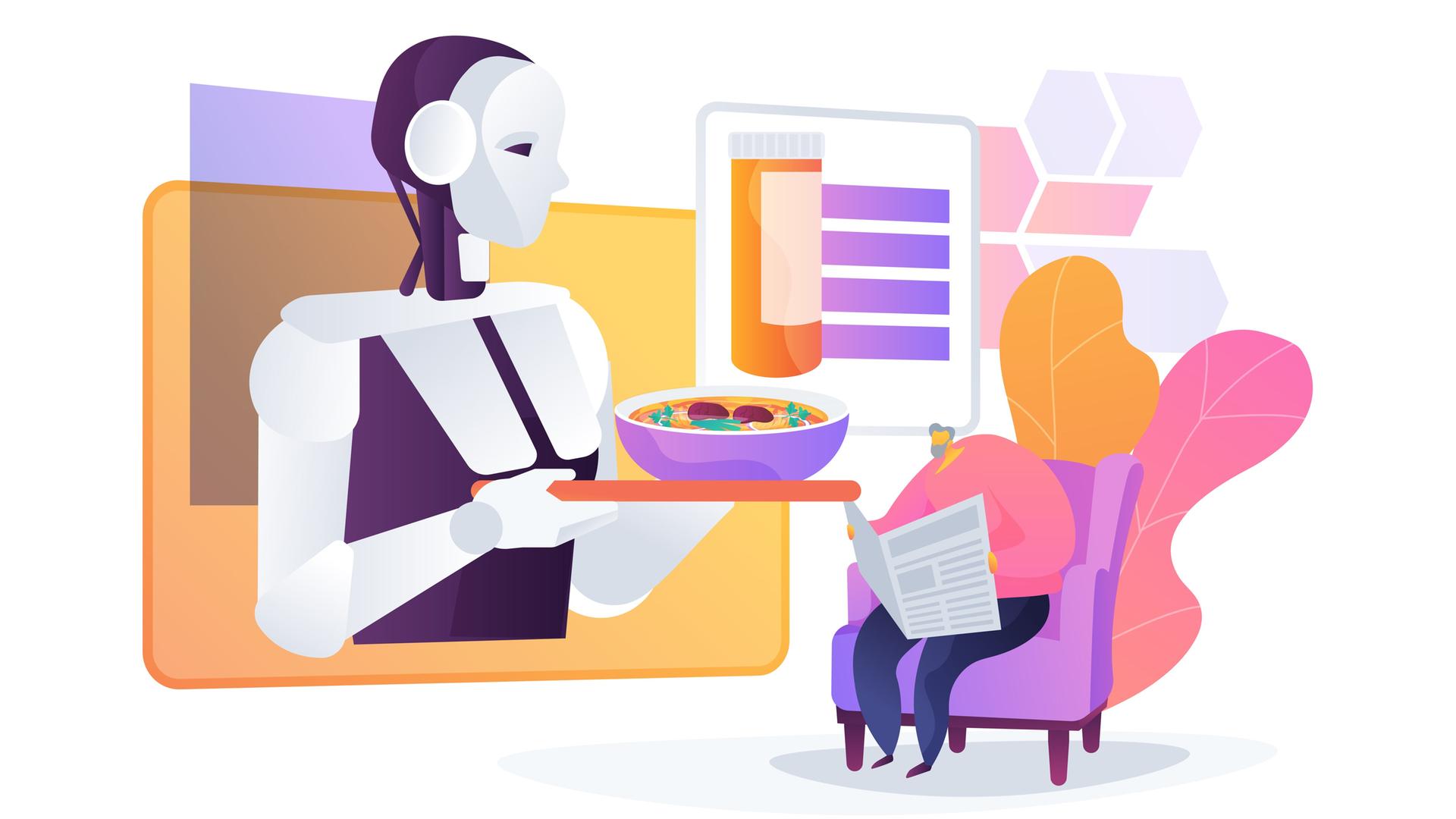Seit dem 1. Oktober 2025 müssen Arztpraxen und Apotheken die elektronische Patientenakte (ePA) nutzen – Versicherte können die ePA hingegen ablehnen. Einige Fachleute und Politiker erhoffen sich von der ePA mehr Effizienz im Gesundheitssystem, Datenschützer und Verbraucherschützer warnen weiterhin vor Risiken.
Inhalt
- Was ist die elektronische Patientenakte?
- Wer kann auf die Daten in der Akte zugreifen?
- Wer bekommt eine elektronische Patientenakte?
- Wie kann man die elektronische Patientenakte ablehnen?
- Wer befürwortet die elektronische Patientenakte und mit welchen Argumenten?
- Welche Kritik gibt es an der elektronischen Patientenakte?
Was ist die elektronische Patientenakte?
Die elektronische Patientenakte (ePA) ist ein persönlicher Datenspeicher, der Patienten ein Leben lang bei Arztbesuchen begleitet. Anders als bisher, wo jede Praxis eigene Akten – oft noch in Papierform – geführt hat, bündelt die ePA Befunde, Blutbilder, Diagnosen, Behandlungsdaten und verschriebene Medikamente zentral an einem digitalen Ort.
Bislang musste der Austausch der Daten zwischen Haus- und Facharztpraxen mühsam organisiert werden. Ein zentrales Dokument, das alle Gesundheitsdaten zusammenführt, gab es nicht. Genau das soll die ePA nun leisten: Ärzte können, nach Zustimmung der Patienten, relevante Informationen einsehen, um Behandlungen besser aufeinander abzustimmen. Unnötige Mehrfachuntersuchungen oder unerwünschte Arzneimittelwechselwirkungen sollen dadurch vermieden werden.
Wer kann auf die Daten in der Akte zugreifen?
Patientinnen und Patienten greifen über eine App, die von ihrer Krankenkasse bereitgestellt wird, auf die ePA zu. Für die Apps braucht es ein modernes Betriebssystem ab Android 10 oder iOS 16. Versicherte brauchen zudem eine sogenannte GesundheitsID, einen digitalen Ausweis für das Gesundheitssytem. Der Weg zur Steuerung der eigenen Akte erfordert schon etwas Einsatz der Versicherten. Wer die Smartphone-Anwendung nicht selbst bedienen will, kann auch andere Menschen damit betrauen.
Ärztinnen, Ärzte und Apotheken erhalten nicht automatisch dauerhaft Zugriff. Wenn man die Versichertenkarte am Anmeldetresen der Praxis einsteckt, bekommen Ärzte ein Zugriffsrecht zum Lesen und Befüllen der ePA für standardmäßig 90 Tage. Die Spanne können Versicherte per App verkürzen und verlängern.
Die ePA ist als patientengeführte Akte gedacht. Das bedeutet nach Einschätzung der Verbraucherschützerin Sabine Wolter allerdings auch mehr Aufwand: „Gerade, wenn ich die Daten selber verwalten möchte über die ePA-App oder ich bestimmen möchte, wer was sieht in der Akte, insbesondere ob ich jetzt bestimmten Ärzten eine Berechtigung gebe, muss ich mich selber darum kümmern.“
Wer bekommt eine elektronische Patientenakte?
Alle gesetzlich Versicherten haben inzwischen automatisch eine E-Akte erhalten. Es sei denn, sie haben aktiv widersprochen. Auch Kinder bekommen eine ePA, wenn die Eltern nicht widersprechen, ab 15 können sie selbst entscheiden. Zum Schutz von Kindern können bestimmte sensible Angaben nicht eingetragen werden.
In der privaten Krankenversicherung (PKV) ist die Einführung der ePA freiwillig. Einige private Krankenversicherer bieten ihren Versicherten die ePA laut PKV-Verband schon an. Bis Ende 2025 soll dann die große Mehrheit der Privatversicherten die ePA nutzen können. Auf der Smartphone-App ihres jeweiligen Versicherers können sie einstellen, welche Einrichtungen auf welche Daten zugreifen dürfen.
Kann man die elektronische Patientenakte ablehnen?
Ja. Es gibt keine Pflicht, die ePA zu nutzen. Wer die elektronische Patientenakte nicht möchte, muss allerdings selbst aktiv werden und dies seiner Krankenkasse mitteilen. Diese Notwendigkeit des aktiven Widerspruchs wird als Opt-out-Verfahren bezeichnet. Alternativ können bestimmte Befunde und Laborwerte auch geschwärzt werden. Die ePA kann man außerdem jederzeit löschen lassen, betonen die Krankenkassen.
Wer befürwortet die elektronische Patientenakte und mit welchen Argumenten?
Schnellere und gezieltere Behandlungen
Einige Fachleute verbinden mit einer großen Verbreitung der ePA vor allem die Hoffnung, dass individuelle Informationen über Patienten schneller abgerufen werden können als bisher. Das könnte im Ernstfall sogar Leben retten, heißt es. Beispielsweise dann, wenn ein Notarzt sofort weiß, dass sich ein Medikament, das er einsetzen will, nicht mit den Tabletten verträgt, die der Patient regelmäßig einnimmt.
Auch generell könnte eine mit relevanten Informationen befüllte E-Akte einen zeitlichen Vorteil beim Beginn der (richtigen) Behandlung bedeuten – verglichen mit der bisherigen Praxis, bei der all diese Daten einzeln von unterschiedlichen Ärzten abgefragt werden müssen.
Die Pläne, eine elektronische Patientenakte einzuführen, bekamen vor allem durch den Lipobay-Skandal kurz nach der Jahrtausendwende Schwung. Bei Patienten, die sowohl den von Bayer entwickelten Blutfettsenker Lipobay einnahmen als auch bestimmte andere Medikamente, traten in Tausenden Fällen schwere Wechselwirkungen auf.
Unnötige Behandlungen vermeiden
Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte mit einem weiteren Argument für die elektronische Patientenakte geworben: „Statt einer Lose-Blatt-Sammlung zu Hause oder einzelnen Befunden in den Praxissystemen verschiedener Praxen haben Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten alle relevanten Dokumente auf einen Blick sicher verfügbar. So können beispielsweise belastende Mehrfachuntersuchungen vermieden werden.“
Gerade im Bereich der Notfallversorgung sei es wichtig, dass die Patientendaten "jederzeit und überall verfügbar" seien, sagt die Gesundheitsexpertin Martina Stamm-Fibich (SPD). Informationen zu Vorerkrankungen und Medikamentenunverträglichkeiten seien mit der Akte schneller verfügbar.
Wenig effiziente Behandlungen identifizieren
Der Gesundheitsökonom Boris Augurzky vom RWI-Leibniz-Institut in Essen erhofft sich durch eine stark verbreitete ePA zudem eine bessere Vergleichbarkeit im Gesundheitswesen: „Dann haben Sie auch Transparenz über das Versorgungsgeschehen und können schauen, welche Versorgungsmaßnahmen was bringen", betont er. Bisher habe das deutsche Gesundheitswesen nicht den Hang zum Qualitätswettbewerb.
Welche Kritik gibt es an der elektronischen Patientenakte?
Datenschützer kritisieren die ePA. In der Akte können persönlichste Informationen gespeichert werden, wie etwa Angaben über psychische Erkrankungen. Ende 2024 deckten die Fachleute des Chaos Computer Clubs (CCC) eine Sicherheitslücke auf. Martin Tschirsich vom CCC sagte, es habe eine Woche gedauert, um Zugangsschlüssel für alle 70 Millionen Akten zu generieren: „Es war erschreckend einfach.“
Laut Ex-Gesundheitsminister Lauterbach wurden die Sicherheitslücken geschlossen, doch Hacker knackten offenbar im Mai 2025 auch den verbesserten ePA-Schutz.
Sicherheitslücken und Informationsdefizite
Vertreter des CCC hatten bereits zuvor Zweifel an der Sicherheit der ePA geäußert. Gegenüber Netzpolitik.org erklärten sie, es handele sich bei den erfolgten Nachbesserungen lediglich um den Versuch einer Schadensbegrenzung bei einem der vielen vom CCC demonstrierten Angriffe.
Thomas Moormann vom Verbraucherzentrale Bundesverband bemängelt, dass jede der 95 Krankenkassen eigene ePA-Apps entwickelt hat, ein hoher Ressourcenaufwand. Außerdem seien Versicherte einseitig informiert worden: Vorteile der ePA wurden hervorgehoben, Risiken kaum erwähnt.
Unklar bleibt, wie Gesundheitsdaten künftig für die Forschung genutzt werden. Zwar sollen die Daten anonymisiert und gemeinwohlorientiert weitergegeben werden, doch Verbraucherschützer fordern eine genauere Definition von „gemeinwohlorientiert“.
Moormann rät daher Versicherten, ihre ePA aktiv zu verwalten. Über die App können Dokumente hochgeladen, gelöscht oder für einzelne Praxen freigegeben werden.
Ohne aktives Eingreifen erhalten Praxen nach Einlesen der Gesundheitskarte 90 Tage Zugriff auf alle Daten. „Ich würde empfehlen, dass man sich damit auseinandersetzt." Das spiele bei chronischen Erkrankungen eine besondere Rolle, besonders wichtig sei dies, "wenn besonders sensible Krankheitsinformationen damit verbunden sind“, so Moormann.
Die Bedienung der App, also wie Versicherte ihre ePA managen können, muss aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands allerdings viel einfacher werden.
Auch Jürgen Windeler, ehemaliger Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), rät Patienten, sich sorgfältig und im Detail darüber informieren, welche Daten sie zur Einsicht freigeben wollen. Dies sei allerdings unter Umständen eine große Herausforderung.
jma, bth, ema, pto