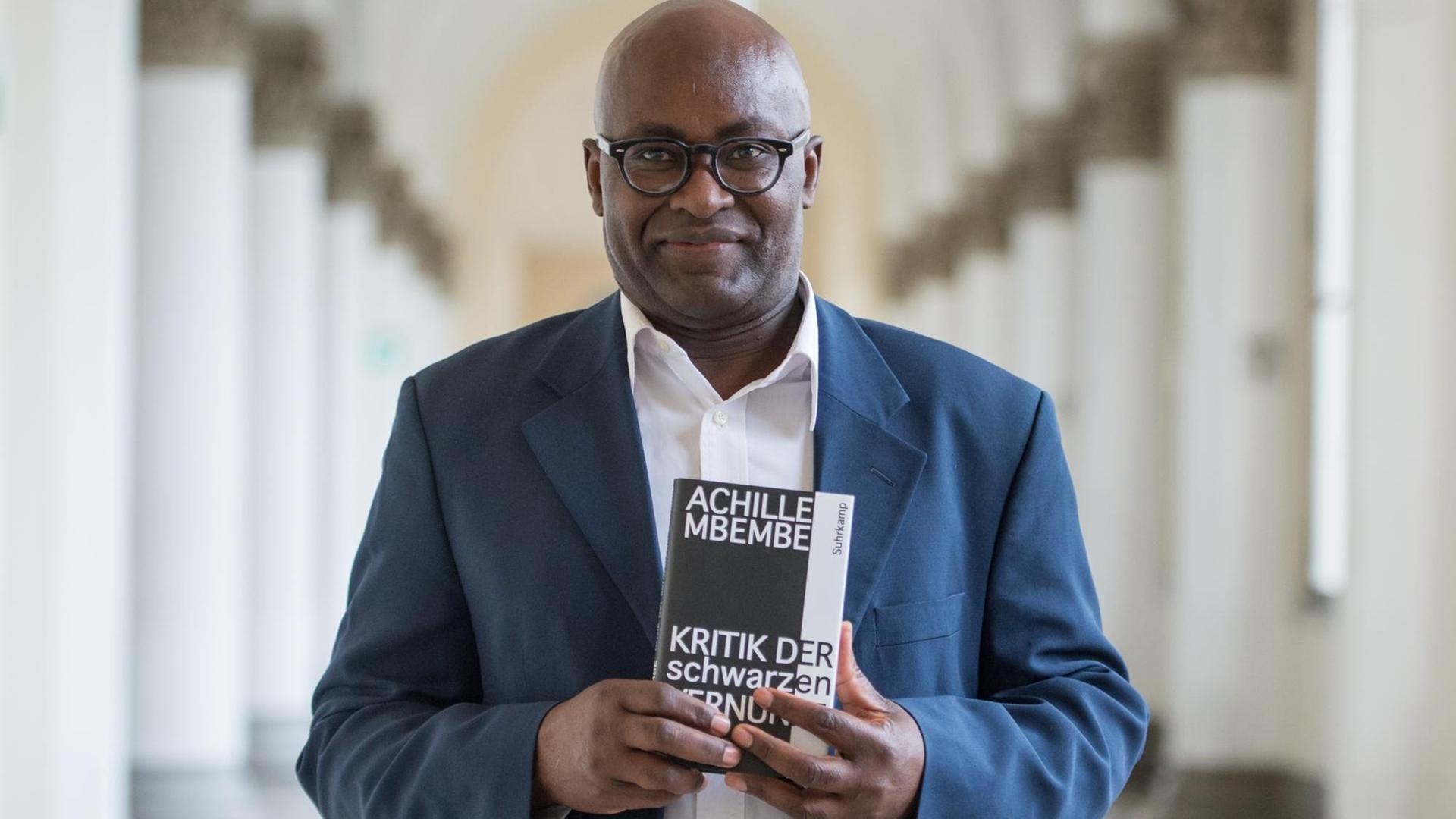Die Rede des Kommissionspräsidenten im Europäischen Parlament hatte es in sich. Die EU-Bürger sollten sich frei zwischen den Mitgliedsländern bewegen können, sagte Jean-Claude Juncker. Der Schengenraum, dem die meisten EU-Staaten angehören, müsse erhalten bleiben.
Die Bedingung dafür: Frontex soll es richten. "Außengrenzen müssen effizienter geschützt werden", so Juncker. Deshalb schlagen wir vor, die Zahl der europäischen Grenzschutzbeamten, die vom europäischen Haushalt finanziert werden, bis zum Jahr 2020 auf 10.000 Grenzschützer zu erhöhen."
Mit anderen Worten: Die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache Frontex soll noch einmal stärker werden. Erst vor zwei Jahren hatte Frontex zusätzliche Kompetenzen erhalten. Seitdem müssen die Mitgliedsstaaten verpflichtend insgesamt 1.500 Beamte für Frontex abstellen. Damit stieg auch der Haushalt der Agentur beträchtlich. 320 Millionen Euro soll er in diesem Jahr umfassen.
Die Bedingung dafür: Frontex soll es richten. "Außengrenzen müssen effizienter geschützt werden", so Juncker. Deshalb schlagen wir vor, die Zahl der europäischen Grenzschutzbeamten, die vom europäischen Haushalt finanziert werden, bis zum Jahr 2020 auf 10.000 Grenzschützer zu erhöhen."
Mit anderen Worten: Die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache Frontex soll noch einmal stärker werden. Erst vor zwei Jahren hatte Frontex zusätzliche Kompetenzen erhalten. Seitdem müssen die Mitgliedsstaaten verpflichtend insgesamt 1.500 Beamte für Frontex abstellen. Damit stieg auch der Haushalt der Agentur beträchtlich. 320 Millionen Euro soll er in diesem Jahr umfassen.
Mehr Kompetenzen für Frontex?
Doch nach dem Plan der EU-Kommission soll es nicht nur mehr Grenzschützer geben. Frontex soll auch neue Zuständigkeiten bekommen: Die Agentur könnte hoheitliche Aufgaben der Mitgliedsstaaten übernehmen und auch auf deren Staatsgebiet selbstständig tätig werden. Das würde bedeuten, dass Frontex etwa eigenständig Patrouillen entsendet oder sogar Pässe abstempelt.
Doch ist der Vorschlag, den Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt, sinnvoll? Einige Länder wie Ungarn pochen auf einen nationalen Grenzschutz und sind deshalb gegen ein erweitertes Mandat für Frontex.
Andere fürchten, dass die Arbeit der Grenzschutzagentur dann noch schwieriger zu kontrollieren wäre. Stefan Keßler vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland findet, dass die Arbeit von Frontex schon jetzt viele Fragen aufwirft:
Doch ist der Vorschlag, den Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt, sinnvoll? Einige Länder wie Ungarn pochen auf einen nationalen Grenzschutz und sind deshalb gegen ein erweitertes Mandat für Frontex.
Andere fürchten, dass die Arbeit der Grenzschutzagentur dann noch schwieriger zu kontrollieren wäre. Stefan Keßler vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland findet, dass die Arbeit von Frontex schon jetzt viele Fragen aufwirft:
"Frontex wird jetzt zur Superagentur, wenn das alles so durchkommt. Anders als manche andere Agenturen unterliegt Frontex faktisch kaum einer wirklichen parlamentarischen Kontrolle."
Keßler ist stellvertretender Vorsitzender des Frontex-Konsultativ-Forums. Die EU hat dieses Gremium vor sechs Jahren geschaffen; ihm gehören Vertreter von Nicht-Regierungsorganisationen an. Aufgabe des Forums ist es, zu prüfen, ob Frontex bei seiner Arbeit die Menschenrechte berücksichtigt. "Das Parlament kann den Exekutivdirektor hin und wieder einladen oder vorladen", so Keßler. "Aber bis auf die Budgethoheit kann das Parlament bei Frontex nicht hineinregieren. Es sitzt auch kein Vertreter oder keine Vertreterin des Parlaments im Verwaltungsrat."
Keßler ist stellvertretender Vorsitzender des Frontex-Konsultativ-Forums. Die EU hat dieses Gremium vor sechs Jahren geschaffen; ihm gehören Vertreter von Nicht-Regierungsorganisationen an. Aufgabe des Forums ist es, zu prüfen, ob Frontex bei seiner Arbeit die Menschenrechte berücksichtigt. "Das Parlament kann den Exekutivdirektor hin und wieder einladen oder vorladen", so Keßler. "Aber bis auf die Budgethoheit kann das Parlament bei Frontex nicht hineinregieren. Es sitzt auch kein Vertreter oder keine Vertreterin des Parlaments im Verwaltungsrat."
Blick hinter die Kulissen
Die Zusammenarbeit mit Frontex sei nicht einfach, sagt Keßler. So pochte das Forum darauf, dass Frontex seine Menschenrechtsstrategie überarbeitet:
"Uns wird immer gesagt: Frontex habe sehr viel zu tun mit den geänderten Anforderungen, mit der nunmehr anstehenden neuen Änderung der Verordnung, und deswegen komme man nicht dazu, sich abschließend mit der Menschenrechtsstrategie zu befassen."
Gerade erst haben sich die Vertreter des Konsultativ-Forums - wie zweimal im Jahr - in Warschau getroffen, in jenem Glaspalast am westlichen Rand der Innenstadt, in dem die Grenzschutzagentur ihren Sitz hat.
Vier Becken mit Springbrunnen säumen den Europa-Platz in Warschau, Steak- und Sushirestaurants locken Familien mit ihren Kindern an. Die wenigsten Passanten wissen hier, welche Institution sich in dem modernen Gebäude befindet.
Gerade erst haben sich die Vertreter des Konsultativ-Forums - wie zweimal im Jahr - in Warschau getroffen, in jenem Glaspalast am westlichen Rand der Innenstadt, in dem die Grenzschutzagentur ihren Sitz hat.
Vier Becken mit Springbrunnen säumen den Europa-Platz in Warschau, Steak- und Sushirestaurants locken Familien mit ihren Kindern an. Die wenigsten Passanten wissen hier, welche Institution sich in dem modernen Gebäude befindet.
Dass Frontex in der polnischen Hauptstadt kaum bemerkt wird, hat zwei Gründe: Die Grenzschutz-Agentur beschäftigt sich vor allem mit Problemen, die weit weg von Warschau liegen - im Mittelmeer und auf dem Balkan. Denn von dort kamen in den vergangenen Jahren die meisten Flüchtlinge in die EU. Der zweite Grund: die zurückhaltende Informationspolitik von Frontex.
Es ist schwer, einen Blick hinter die Kulissen der Grenzschutzagentur zu werfen. Der Deutschlandfunk bemühte sich für diese Sendung über mehrere Monate um einen Besuch in der Warschauer Zentrale und ein Interview mit dem Exekutivdirektor, dem Franzosen Fabrice Leggeri. Gestattet wurde schließlich ein Treffen mit einer Sprecherin.
"Wir sind hier im Situation-Center, das ist eine Art Nervenzentrum von Frontex", erzählt Izabella Cooper, die Sprecherin von Frontex. "Hier laufen die Fäden unserer Operationen zusammen. Außerdem haben wir von hier aus den vollen Überblick über die Situationen an allen Außengrenzen der Europäischen Union. Schauen sie auf die großen Bildschirme da vorne. Der linke zeigt die Situation an den Seegrenzen. Der rechte zeigt die Festlandgrenzen. Die grünen Punkte zeigen, wo seit März Menschengruppen oder Boote daran gehindert wurden, unkontrolliert in die EU zu kommen."
Izabella Cooper deutet auf die Straße von Gibraltar. 35.000 Flüchtlinge kamen in diesem Jahr von Marokko aus über Spanien in die Europäische Union. Das ist mehr als ein Drittel aller Migranten, die 2018 bisher die EU erreichten.

Beobachtung von Flüchtlingsrouten
Izabella Cooper hält ihre Stimme gedämpft, um die acht Mitarbeiter an ihren Computern nicht zu stören. Sie verarbeiten rund um die Uhr Informationen, die vom Grenzschutz und der Polizei in den EU-Mitgliedsländern und Frontex-Mitarbeitern an verschiedenen Grenzen geliefert werden. Die Informationen fließen in das gemeinsame Grenzüberwachungssystem Eurosur ein.
Eurosur erfasst selbst ein gestohlenes Auto, das an einer Grenze entdeckt wird. Versucht jemand, mit einem gefälschten Pass in die EU einzureisen, wird dies ebenfalls gespeichert.
Die meisten anderen Mitarbeiter der Frontex-Zentrale in Warschau - etwa 600 sind es insgesamt - beschäftigen sich mit Datenauswertung und Lageanalyse. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die sogenannte Risikoeinschätzung: Es geht darum, Flüchtlingsrouten zu beobachten und zu beurteilen.
Eurosur erfasst selbst ein gestohlenes Auto, das an einer Grenze entdeckt wird. Versucht jemand, mit einem gefälschten Pass in die EU einzureisen, wird dies ebenfalls gespeichert.
Die meisten anderen Mitarbeiter der Frontex-Zentrale in Warschau - etwa 600 sind es insgesamt - beschäftigen sich mit Datenauswertung und Lageanalyse. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die sogenannte Risikoeinschätzung: Es geht darum, Flüchtlingsrouten zu beobachten und zu beurteilen.
"Auf dieser Grundlage machen wir einen Plan. Wir schauen uns zum Beispiel die Kapazitäten in Spanien an, wie viele Flugzeuge und Schiffe sie dort haben", erklärt Frontex-Sprecherin Izabella Cooper. "Wenn das nicht ausreicht, bieten wir Unterstützung an. Dann sagt zum Beispiel Finnland: Wir können euch in diesem oder jenem Monat ein Flugzeug geben."
Zum Vorschlag der EU-Kommission, die Kompetenzen von Frontex deutlich zu erweitern, äußert sich Izabella Cooper nicht. Das sei eine politische Entscheidung, die nicht in Warschau getroffen werde.
In die Schlagzeilen geriet Frontex in der Vergangenheit vor allem wegen der Einsätze im Mittelmeer. Unter dem Namen Triton setzt die Agentur dort seit November 2014 Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber ein. Anders als die frühere italienische Mission Mare Nostrum ist das vorrangige Ziel die Grenzsicherung - nicht die Rettung von Flüchtlingen in Seenot.

Frontex in den Schlagzeilen
Der Frontex-Aktionsradius war zunächst beschränkt auf 30 Seemeilen vor der europäischen Außengrenze. Sechs Schiffe, vier Flugzeuge und ein Hubschrauber sollten für die EU-Mitgliedsländer die Küsten überwachen, während man die kostspielige Rettung von Schiffbrüchigen auf dem offenen Meer allen Schiffen überlassen wollte, die im Mittelmeer unterwegs sind. Die damalige italienische Verteidigungsministerin Renata Poletti formulierte es 2014 so:
"Jedes x-beliebige Schiff, das auf hoher See einen Hilferuf bekommt, muss diesem folgen. Insofern ändern sich bei der Triton-Mission jetzt die Regeln. Schiffe, die sich in der Nähe eines Notfalls befinden, müssen sofort eingreifen, da gibt es keine Ausnahme."
Doch diese Regelung hatte zur Folge, dass die Zahl der Todesopfer im Mittelmeer stieg. Immer mehr Handelsschiffe mussten Flüchtlinge aus Schlauchbooten bergen, dabei kamen immer wieder Menschen ums Leben, weil die riesigen Container- und Tankschiffe nicht geeignet sind für solche Rettungseinsätze.
Zur Operation Triton wurde deshalb die Mission Sophia gestellt, die zwar offiziell nur den Menschenschleppern das Handwerk legen soll, de facto aber vor allem Menschen aus Seenot rettet – mehr als 250.000 seit Anfang 2016. Die Grenzschutzmission Triton wurde Anfang des Jahres umbenannt in Operation Themis, mit weitergehenden Befugnissen.
Doch diese Regelung hatte zur Folge, dass die Zahl der Todesopfer im Mittelmeer stieg. Immer mehr Handelsschiffe mussten Flüchtlinge aus Schlauchbooten bergen, dabei kamen immer wieder Menschen ums Leben, weil die riesigen Container- und Tankschiffe nicht geeignet sind für solche Rettungseinsätze.
Zur Operation Triton wurde deshalb die Mission Sophia gestellt, die zwar offiziell nur den Menschenschleppern das Handwerk legen soll, de facto aber vor allem Menschen aus Seenot rettet – mehr als 250.000 seit Anfang 2016. Die Grenzschutzmission Triton wurde Anfang des Jahres umbenannt in Operation Themis, mit weitergehenden Befugnissen.
Zu den Zielen gehören nach wie vor die Verfolgung von Schlepperorganisationen in Libyen und die Ausbildung libyscher Marinesoldaten. Es soll auch eine eigene libysche Küstenwacht aufgebaut werden, die dank erheblicher europäischer Zuschüsse die Küstengewässer kontrollieren und Flüchtlingsboote an der Überfahrt nach Europa hindern soll. Die Statistik von Frontex weist bislang 551 zerstörte Flüchtlingsboote und 151 festgenommene Menschenschmuggler auf.
Kritiker etwa in Menschenrechtsorganisationen halten diese Zahlen allerdings für falsch. Sie gehen davon aus, dass Migranten als Schmuggler festgenommen und sogar verurteilt werden, weil sie Flüchtlingsboote auf Anweisung der libyschen Schleuser Richtung Europa gesteuert haben.
Die Hintermänner sitzen sicher in ihren libyschen Verstecken, unerreichbar für die Grenzwächter von Frontex. Stefan Keßler vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst:

"Frontex versichert uns relativ glaubwürdig, im Augenblick hätten die lediglich eine Beamtin oder einen Beamten in Tunesien, in Tunis, sitzen, der versuchen würde, irgendwelche belastbaren Kontakte nach Libyen hinein zu entwickeln. Ich habe den großen Eindruck, dass die ganzen Material- und vielleicht auch Waffenlieferungen an libysche Akteure an Frontex vorbeilaufen."
Wieder mehr Tote im Mittelmeer
Frontex überwacht auch die sogenannten Hotspots, also die Registrierzentren für Flüchtlinge im Schengenraum. Hier werden gerettete Migranten identifiziert und ihre Fingerabdrücke in die EU-Datenbanken eingespeist. Immer wieder gibt es Kritik an der Vorgehensweise der Grenzwächter. Migranten berichteten, schon bei der Erstbefragung seien die Weichen gestellt worden für die spätere Ablehnung ihrer Asylanträge.
Frontex-Mitarbeiter sollen die nationalen Grenzbeamten in ihrer Arbeit unterstützen, gleichzeitig aber auch einen Auftrag der EU erfüllen: nämlich Flüchtlinge von Europa fernhalten. Als immer mehr Migranten über Libyen kamen und das Risiko von Unglücken auf hoher See wuchs, wurden immer mehr freiwillige Hilfsorganisationen mit ihren Schiffen aktiv: Sie fuhren im Mittelmeer und retteten dort Menschen aus seeuntauglichen Flüchtlingsbooten.
Diese Hilfseinsätze waren der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex, die die EU-Mission Triton und später Themis finanziert und koordiniert, ein Dorn im Auge. In einem internen Papier, das vor zwei Jahren der "Financial Times" zugespielt wurde, beschuldigte Frontex die privaten Retter, den Migrantenstrom zu verstärken, also de facto den Schleusern in Libyen in die Hände zu spielen. Gabriele Eminente arbeitet für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen:
Frontex-Mitarbeiter sollen die nationalen Grenzbeamten in ihrer Arbeit unterstützen, gleichzeitig aber auch einen Auftrag der EU erfüllen: nämlich Flüchtlinge von Europa fernhalten. Als immer mehr Migranten über Libyen kamen und das Risiko von Unglücken auf hoher See wuchs, wurden immer mehr freiwillige Hilfsorganisationen mit ihren Schiffen aktiv: Sie fuhren im Mittelmeer und retteten dort Menschen aus seeuntauglichen Flüchtlingsbooten.
Diese Hilfseinsätze waren der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex, die die EU-Mission Triton und später Themis finanziert und koordiniert, ein Dorn im Auge. In einem internen Papier, das vor zwei Jahren der "Financial Times" zugespielt wurde, beschuldigte Frontex die privaten Retter, den Migrantenstrom zu verstärken, also de facto den Schleusern in Libyen in die Hände zu spielen. Gabriele Eminente arbeitet für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen:
"Das waren politische Gründe, auf europäischer Ebene. Es ist kein Zufall, dass alle diese Vorwürfe der vergangenen Monate Mitte Dezember 2016 aufgekommen sind, als die "Financial Times" Teile aus einem internen Papier von Frontex zitierte mit den Vorwürfen, wir seien ein Pull-Faktor, würden also Leute anlocken. Diese Vorwürfe haben dann in vielen Ländern, auch in Italien, ein breites Echo gefunden, speziell als Wahlen anstanden."
Einige Staatsanwälte in Italien machten sich die Argumente des Frontex-Papiers zu eigen und strengten Ermittlungen an. Der Vorwurf: Beihilfe zu illegaler Einwanderung. Mehrere private Rettungsschiffe in Italien und Malta wurden daraufhin beschlagnahmt.
Es hieß, die humanitären Organisationen hätten gemeinsame Sache mit den Menschenschmugglern in Libyen gemacht. Anderen wurde die Zulassung durch ihren Flaggenstaat entzogen – auch auf Druck der italienischen Regierung. Inzwischen haben praktisch alle privaten Hilfsorganisationen ihre Arbeit eingestellt.
In Italien kommen derzeit wesentlich weniger Flüchtlinge an - etwa 20.000 waren es laut Frontex bis Ende September. Zugleich steigt die Zahl derer, die im Mittelmeer ertrinken: Der Internationalen Organisation für Migration zufolge sind seit Anfang des Jahres mehr als 1.700 Menschen auf der Flucht nach Europa ertrunken. UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi rief dazu auf, die Such- und Rettungskapazitäten im Mittelmeer zu erhöhen.
Einige Staatsanwälte in Italien machten sich die Argumente des Frontex-Papiers zu eigen und strengten Ermittlungen an. Der Vorwurf: Beihilfe zu illegaler Einwanderung. Mehrere private Rettungsschiffe in Italien und Malta wurden daraufhin beschlagnahmt.
Es hieß, die humanitären Organisationen hätten gemeinsame Sache mit den Menschenschmugglern in Libyen gemacht. Anderen wurde die Zulassung durch ihren Flaggenstaat entzogen – auch auf Druck der italienischen Regierung. Inzwischen haben praktisch alle privaten Hilfsorganisationen ihre Arbeit eingestellt.
In Italien kommen derzeit wesentlich weniger Flüchtlinge an - etwa 20.000 waren es laut Frontex bis Ende September. Zugleich steigt die Zahl derer, die im Mittelmeer ertrinken: Der Internationalen Organisation für Migration zufolge sind seit Anfang des Jahres mehr als 1.700 Menschen auf der Flucht nach Europa ertrunken. UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi rief dazu auf, die Such- und Rettungskapazitäten im Mittelmeer zu erhöhen.
Harter Kurs der neuen italienischen Regierung
Die neue italienische Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung unterstützt eine Ausweitung des europäischen Grenzschutzes und eine deutliche finanzielle Aufstockung von Frontex, allerdings nicht so, wie sich das die EU-Kommission vorstellt. Dass die Agentur selbstständig auf italienischem Boden operieren darf, kommt für Rom nicht infrage. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte jüngst beim informellen EU-Gipfel in Salzburg:
"Wir müssen effizient bei den Vereinbarungen über jene Operationen eingreifen, die unter ganz anderen politischen Voraussetzungen getroffen wurden – sowohl was die Operation Sophia oder die weit umfassenderen Frontex-Operationen anbelangt. All das muss unter den veränderten Bedingungen neu formuliert werden, die wir im vergangenen Juni vorgestellt haben."
Eine dieser neuen Bedingungen ist die komplette Schließung italienischer Häfen für gerettete Migranten. Egal, ob sie von italienischen oder Marineeinheiten unter der Führung von Frontex an Bord genommen wurden. Bisher wurden sie ausschließlich in Italien an Land gebracht, dafür hatte die EU großzügige Zugeständnisse bei den italienischen Haushaltsschulden gemacht.
Eine dieser neuen Bedingungen ist die komplette Schließung italienischer Häfen für gerettete Migranten. Egal, ob sie von italienischen oder Marineeinheiten unter der Führung von Frontex an Bord genommen wurden. Bisher wurden sie ausschließlich in Italien an Land gebracht, dafür hatte die EU großzügige Zugeständnisse bei den italienischen Haushaltsschulden gemacht.
Flexibilität bei den Schulden will Vize-Regierungschef Luigi di Maio weiterhin, aber Flüchtlinge bleiben künftig außen vor:

"Wer in Italien anlandet, betritt europäischen Boden. Die EU hat uns aber nicht geholfen. Deshalb werden wir in Zukunft nicht mehr mit der EU verhandeln, sondern mit einzelnen Ländern."
Das dürfte auch bedeuteten, dass Italien Frontex nur noch dann unterstützen wird, wenn die Grenzschutzagentur den neuen italienischen Zielen bei der Migrationspolitik nützt. Dazu gehören geplante Frontex–Einsätze in Nicht-EU-Ländern, wie etwa die Rückführung von Migranten in jene Staaten, mit denen rechtsgültige Abkommen bestehen. Aber auch in Staaten wie Libyen, wo Menschenrechte verletzt werden. Damit, so hofft man in Rom, werde die Flüchtlingsroute nach Italien endlich geschlossen.
Dass die Rückführung von Flüchtlingen nach Libyen gegen geltendes Recht verstößt, akzeptiert die Regierung in Rom nicht. Vielmehr gehe es darum, den Flüchtlingsstrom zu unterbinden, damit keine Menschen mehr ertrinken.
Die Ablehnung in Italien und anderen südlichen EU-Ländern ist ein Grund, warum Experten skeptisch auf den Vorschlag der EU-Kommission blicken. Ein anderer ist, dass Brüssel Frontex zwar stark ausbauen will, dabei aber offenbar nur wenig in den Schutz der Menschenrechte investieren möchte. Die dafür vorgesehenen Institutionen sollen zumindest nicht mehr Mittel erhalten, auch nicht das Konsultativforum.
Das dürfte auch bedeuteten, dass Italien Frontex nur noch dann unterstützen wird, wenn die Grenzschutzagentur den neuen italienischen Zielen bei der Migrationspolitik nützt. Dazu gehören geplante Frontex–Einsätze in Nicht-EU-Ländern, wie etwa die Rückführung von Migranten in jene Staaten, mit denen rechtsgültige Abkommen bestehen. Aber auch in Staaten wie Libyen, wo Menschenrechte verletzt werden. Damit, so hofft man in Rom, werde die Flüchtlingsroute nach Italien endlich geschlossen.
Dass die Rückführung von Flüchtlingen nach Libyen gegen geltendes Recht verstößt, akzeptiert die Regierung in Rom nicht. Vielmehr gehe es darum, den Flüchtlingsstrom zu unterbinden, damit keine Menschen mehr ertrinken.
Die Ablehnung in Italien und anderen südlichen EU-Ländern ist ein Grund, warum Experten skeptisch auf den Vorschlag der EU-Kommission blicken. Ein anderer ist, dass Brüssel Frontex zwar stark ausbauen will, dabei aber offenbar nur wenig in den Schutz der Menschenrechte investieren möchte. Die dafür vorgesehenen Institutionen sollen zumindest nicht mehr Mittel erhalten, auch nicht das Konsultativforum.
Schwierige Zusammenarbeit mit Drittstaaten
Dabei sei es schon jetzt schwer, konkreten Vorwürfen nachzugehen, sagt dessen stellvertretender Vorsitzender Stefan Keßler:
"Bei Vorwürfen von konkreten Menschenrechtsverletzungen wird es für uns immer erheblich problematisch, nachzuvollziehen, wer ist jetzt eigentlich wirklich verantwortlich für den konkreten Fall. Wir haben immer wieder festgestellt, dass die Mitgliedsstaaten gerne die Verantwortung auf Frontex schieben, und umgekehrt Frontex gerne die Verantwortung auf einen Mitgliedsstaat schiebt. Das führt im konkreten Fall natürlich nicht viel weiter."
Für Kritik sorgt auch die geplante Zusammenarbeit mit Drittstaaten - also Ländern außerhalb der Europäischen Union. Dabei werfe der Kontakt von EU-Ländern mit einigen Drittstaaten schon jetzt erhebliche Fragen auf. Frontex scheine es egal zu sein, wie das Partnerland regiert werde, sagt Stefan Keßler:
Für Kritik sorgt auch die geplante Zusammenarbeit mit Drittstaaten - also Ländern außerhalb der Europäischen Union. Dabei werfe der Kontakt von EU-Ländern mit einigen Drittstaaten schon jetzt erhebliche Fragen auf. Frontex scheine es egal zu sein, wie das Partnerland regiert werde, sagt Stefan Keßler:
"Das ist eigentlich mein größeres Problem, wenn wir mal von Libyen weggucken und Ägypten betrachten. Frontex und die Europäische Union versuchen, die Kooperation mit Ägypten auszubauen. Da ist dann natürlich die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass eine europäische Agentur, eine Agentur der Europäischen Union mit einer Militärdiktatur zusammenarbeitet."
Einige Beobachter halten es grundsätzlich für die falsche Strategie, Frontex zu stärken. Das Problem der EU sei derzeit gar nicht so sehr die Kontrolle der Grenzen, meint Gerald Knaus, Vorsitzender der Europäischen Stabilitäts-Initiative ESI, einer Denkfabrik, die sich mit dem Thema Migration beschäftigt:
"Nehmen wir die griechischen Inseln: Wie gehen wir damit um, dass derzeit 3.000 Leute im Monat die griechischen Inseln mit dem Schiff erreichen - und dass es ewig dauert, zu entscheiden, ob sie Schutz brauchen oder nicht. Das heißt, die Leute stauen sich auf den Inseln in den Lagern, die Bedingungen sind beschämend für die EU. Und Rückführungen aus Griechenland in die Türkei sind fast lächerlich. Also wir haben ungefähr 25 Rückführungen im Monat. Und bei all diesen Problemen hilft uns die Tatsache, dass wir dort seit Jahren viel Frontex haben, überhaupt nicht."
Statt in Polizisten zu investieren, solle die EU also eher Asylverfahren und Abschiebungen beschleunigen, meint Knaus. Dass Jean-Claude Juncker und Angela Merkel Frontex aufstocken wollen, hält er für eine populistische Strategie: Es klinge eben gut, besseren Grenzschutz zu versprechen und die Festung Europa auszubauen.
Einige Beobachter halten es grundsätzlich für die falsche Strategie, Frontex zu stärken. Das Problem der EU sei derzeit gar nicht so sehr die Kontrolle der Grenzen, meint Gerald Knaus, Vorsitzender der Europäischen Stabilitäts-Initiative ESI, einer Denkfabrik, die sich mit dem Thema Migration beschäftigt:
"Nehmen wir die griechischen Inseln: Wie gehen wir damit um, dass derzeit 3.000 Leute im Monat die griechischen Inseln mit dem Schiff erreichen - und dass es ewig dauert, zu entscheiden, ob sie Schutz brauchen oder nicht. Das heißt, die Leute stauen sich auf den Inseln in den Lagern, die Bedingungen sind beschämend für die EU. Und Rückführungen aus Griechenland in die Türkei sind fast lächerlich. Also wir haben ungefähr 25 Rückführungen im Monat. Und bei all diesen Problemen hilft uns die Tatsache, dass wir dort seit Jahren viel Frontex haben, überhaupt nicht."
Statt in Polizisten zu investieren, solle die EU also eher Asylverfahren und Abschiebungen beschleunigen, meint Knaus. Dass Jean-Claude Juncker und Angela Merkel Frontex aufstocken wollen, hält er für eine populistische Strategie: Es klinge eben gut, besseren Grenzschutz zu versprechen und die Festung Europa auszubauen.
Das neue Frontex-Konzept dürfte in den kommenden Monaten noch für Diskussionen sorgen.