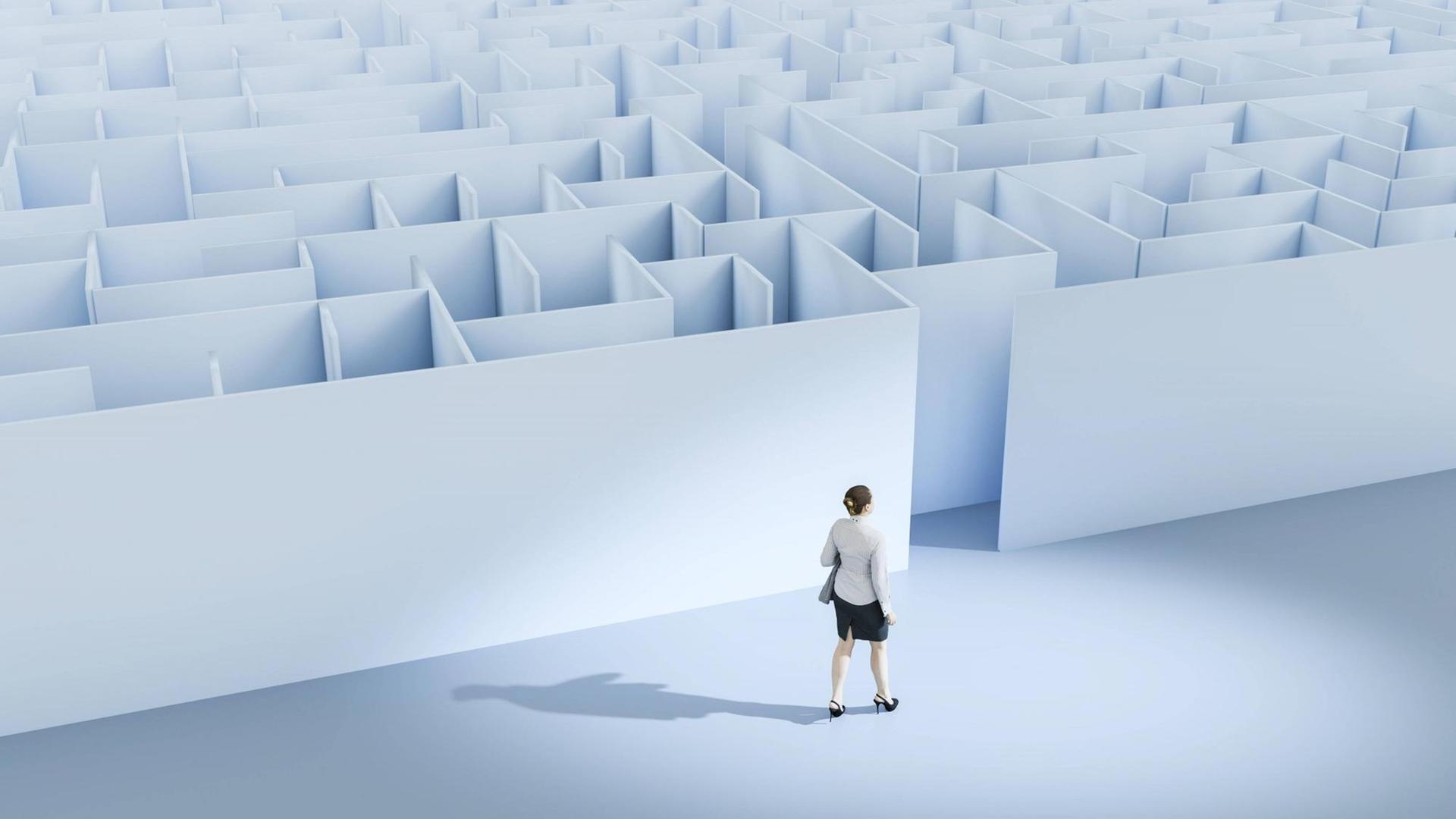Falls sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag in Brüssel auf einen eigenen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten einigen sollten, dann liegt Streit in der Luft. Dann wird das Europäische Parlament auf die Barrikaden gehen, da sind sich die langjährigen Europaabgeordneten von CDU und SPD, Elmar Brok und Martin Schulz, sicher.
"Das ist eine Rückabwicklung von Demokratie, was die Damen und Herren im Europäischen Rat versuchen."
"Ich hoffe, dass dann das Parlament das Rückgrat besitzt, ’Nein‘ zu sagen, denn die Entscheidung, die wir 2014 getroffen haben, dass nur jemand, der von einer Parteienfamilie in Europa als Spitzenkandidat identifiziert worden ist, an die Spitze der Exekutive kommen soll, war ein Demokratisierungsschub."
"Ich hoffe, dass dann das Parlament das Rückgrat besitzt, ’Nein‘ zu sagen, denn die Entscheidung, die wir 2014 getroffen haben, dass nur jemand, der von einer Parteienfamilie in Europa als Spitzenkandidat identifiziert worden ist, an die Spitze der Exekutive kommen soll, war ein Demokratisierungsschub."
Kriterien so undurchsichtig wie Zigarrenrauch
Martin Schulz wurde vor fünf Jahren von den Sozialdemokratischen Parteien Europas als Spitzenkandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten in die Europawahlen geschickt. Schulz verlor die Wahl gegen den Luxemburger Jean-Claude Juncker. Er zählt sich dennoch zu den Gewinnern: Das Wichtigste sei der Wahlkampf gewesen, meint Schulz, und die Tatsache, dass die Wähler über den Kommissionspräsidenten entschieden hätten.
Mehr als 50 Jahre lang waren es die Regierungschefs der Mitgliedsländer, die untereinander aushandelten, wer die Behörde in Brüssel leiten solle. Die Kriterien waren so undurchsichtig wie der Zigarrenrauch, in dem die Herrenrunde in irgendwelchen Kaminzimmern den Chefposten vergab. Doch der öffentliche Druck, wichtige Personalfragen transparenter und demokratischer zu entscheiden, wurde über die Jahre immer stärker. Mit dem Lissabonner Vertrag, der 2009 in Kraft trat, sollte schließlich das Europäische Parlament ein klares Mitspracherecht bekommen. Doch sofort stellten sich einige Regierungschefs quer, auch die Bundesregierung bremste. Und das war das Ergebnis:
Artikel 17, Absatz 7 des Lissabonner Vertrages: "Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor; dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder."
Mehr als 50 Jahre lang waren es die Regierungschefs der Mitgliedsländer, die untereinander aushandelten, wer die Behörde in Brüssel leiten solle. Die Kriterien waren so undurchsichtig wie der Zigarrenrauch, in dem die Herrenrunde in irgendwelchen Kaminzimmern den Chefposten vergab. Doch der öffentliche Druck, wichtige Personalfragen transparenter und demokratischer zu entscheiden, wurde über die Jahre immer stärker. Mit dem Lissabonner Vertrag, der 2009 in Kraft trat, sollte schließlich das Europäische Parlament ein klares Mitspracherecht bekommen. Doch sofort stellten sich einige Regierungschefs quer, auch die Bundesregierung bremste. Und das war das Ergebnis:
Artikel 17, Absatz 7 des Lissabonner Vertrages: "Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor; dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder."

Das klingt so windelweich wie es gemeint war. Von einem Spitzenkandidaten ist da nicht die Rede und auch nicht von einer Kandidatenauswahl durch das Parlament. Das Europaparlament sollte lediglich gefragt werden und am Ende des Auswahlprozesses irgendwie zustimmen, damit das Ganze einen demokratischeren Schein erhält. Doch die Abgeordneten – quer durch fast alle Parteien – erkannten ihre Chance. Eine Europawahl, bei der es um den höchsten Posten in Brüssel geht - damit lassen sich Wähler mobilisieren, damit lässt sich auch der anhaltende Verdacht ausräumen, das Europäische Parlament habe keine Bedeutung.
Das Parlament setzte sich schließlich durch. 2014 ging der Kommissionspräsident zum ersten Mal in der Geschichte der EU aus Wahlen in der gesamten Union hervor.
Das Parlament setzte sich schließlich durch. 2014 ging der Kommissionspräsident zum ersten Mal in der Geschichte der EU aus Wahlen in der gesamten Union hervor.
Macron will zurück zum alten Auswahlverfahren
Aber Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würde das Rad gerne wieder zurückdrehen. Die Wahl des Kommissionspräsidenten sei Sache der Regierungschefs, findet Macron, und steht damit ganz in französischer Tradition, wo alle Macht beim Präsidenten liegt. Diese Haltung präge auch die Einstellung französischer Beamter in Brüssel, erinnert sich die ehemalige EU-Kommissarin Monika Wulf-Mathies von der SPD:
"Weil ja auch in Frankreich das Parlament insgesamt weniger Rechte hat als in Deutschland und in anderen europäischen Demokratien. Das heißt, man nimmt als Franzose in der Kommission und erst recht als französischer Präsident das Europäische Parlament sehr viel weniger wichtig, als wir uns doch angewöhnt haben, dem Europaparlament die Rechte, die es sich erkämpft hat, auch zu geben."
Auch die Regierungen aus Ungarn, Polen und Italien wollen den Einfluss des Europäischen Parlaments und der Kommission wieder zurückdrängen. Ihnen geht die ganze Entwicklung der EU in Richtung einer immer enger vernetzten Union zu weit.
Die Diskussion um die Besetzung der europäischen Spitzenämter reiht sich dabei nahtlos ein in eine Politik des Intergouvernementalismus, also einer zwischenstaatlichen Zusammenarbeit der Regierungen, bei der die europäischen Institutionen EU-Kommission und Europaparlament weitgehend außen vor bleiben.
In der Außenpolitik etwa, in Steuerfragen oder in Teilen der Justizzusammenarbeit haben Parlament und Kommission kaum Mitspracherechte. Deshalb müssen die Entscheidungen der Regierungen in diesen Bereichen im Konsens fallen. Wenn sich die Regierungen einig sind, müssen sie weder die Europäische Kommission noch das Parlament einbinden.
"Weil ja auch in Frankreich das Parlament insgesamt weniger Rechte hat als in Deutschland und in anderen europäischen Demokratien. Das heißt, man nimmt als Franzose in der Kommission und erst recht als französischer Präsident das Europäische Parlament sehr viel weniger wichtig, als wir uns doch angewöhnt haben, dem Europaparlament die Rechte, die es sich erkämpft hat, auch zu geben."
Auch die Regierungen aus Ungarn, Polen und Italien wollen den Einfluss des Europäischen Parlaments und der Kommission wieder zurückdrängen. Ihnen geht die ganze Entwicklung der EU in Richtung einer immer enger vernetzten Union zu weit.
Die Diskussion um die Besetzung der europäischen Spitzenämter reiht sich dabei nahtlos ein in eine Politik des Intergouvernementalismus, also einer zwischenstaatlichen Zusammenarbeit der Regierungen, bei der die europäischen Institutionen EU-Kommission und Europaparlament weitgehend außen vor bleiben.
In der Außenpolitik etwa, in Steuerfragen oder in Teilen der Justizzusammenarbeit haben Parlament und Kommission kaum Mitspracherechte. Deshalb müssen die Entscheidungen der Regierungen in diesen Bereichen im Konsens fallen. Wenn sich die Regierungen einig sind, müssen sie weder die Europäische Kommission noch das Parlament einbinden.
Der Wunsch nach einer ineffizienten EU
Das ist bequem für die Regierungschefs, aber schlecht für Europa, meint der frühere Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz von der SPD:
"Intergouvernemental heißt: Vetorecht jedes einzelnen Landes, und dann steht der Zug still, wenn ein Land nicht mitzieht. Das können Sie an der Steuerpolitik sehen: Diese Gerechtigkeitslücke, dass kleine Leute Steuern zahlen und große Konzerne keine, hat etwas damit zu tun, dass einzelne Länder in der Europäischen Union offen Steueroasen sind. Weil sie aber mit ihrem Vetorecht im Rahmen dieser intergouvernamentalen, also der Regierungszusammenarbeit, zwar unter dem Dach er EU, aber nicht auf der Grundlage des EU-Rechtes, handeln, sondern im Wege von zwischenstaatlichen Vereinbarungen, einzelne Länder sagen können, da machen wir nicht mit."
Italien steht wegen seiner Schuldenpolitik unter Druck, Polen wegen der politischen Übergriffe auf die eigene Justiz und Ungarn müsste nach europäischem Recht eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen aufnehmen. Alle drei Regierungen wünschen sich derzeit eine weniger effiziente EU.
"Intergouvernemental heißt: Vetorecht jedes einzelnen Landes, und dann steht der Zug still, wenn ein Land nicht mitzieht. Das können Sie an der Steuerpolitik sehen: Diese Gerechtigkeitslücke, dass kleine Leute Steuern zahlen und große Konzerne keine, hat etwas damit zu tun, dass einzelne Länder in der Europäischen Union offen Steueroasen sind. Weil sie aber mit ihrem Vetorecht im Rahmen dieser intergouvernamentalen, also der Regierungszusammenarbeit, zwar unter dem Dach er EU, aber nicht auf der Grundlage des EU-Rechtes, handeln, sondern im Wege von zwischenstaatlichen Vereinbarungen, einzelne Länder sagen können, da machen wir nicht mit."
Italien steht wegen seiner Schuldenpolitik unter Druck, Polen wegen der politischen Übergriffe auf die eigene Justiz und Ungarn müsste nach europäischem Recht eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen aufnehmen. Alle drei Regierungen wünschen sich derzeit eine weniger effiziente EU.
Auch andere Regierungen machen sich immer wieder für zwischenstaatliche Lösungen stark. Auch Deutschland erliege immer wieder der Versuchung, kritisiert der ehemalige CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok:
"Wenn Sie Einstimmigkeit nutzen, dann haben Sie keine Sorge, dass Sie überstimmt werden. Und ich halte das für eine Angelegenheit, die von Übel ist. Denn die Frage der Einstimmigkeit bedeutet immer Stillstand, sie bedeutet immer Erpressung durch denjenigen, der nicht mitmachen will."
Einstimmig oder mit Mehrheit, loser Staatenbund oder Bundesstaat, mehr Gemeinsamkeit oder mehr zwischenstaatliche Lösungen - der Streit ist so alt wie die Europäische Union. Die Gründerväter Jean Monnet und Robert Schuman waren überzeugt, dass die Europäische Gemeinschaft nur mit Mehrheitsentscheidungen vorankommt. Aber schon Monnet und Schuman konnten sich nicht durchsetzen. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wurde auf dem Prinzip der Einstimmigkeit aufgebaut. Bei den damals nur sechs Mitgliedsländern funktionierte das anfangs sogar.
1965 kam es zum Showdown. Die Verwaltung der gemeinsamen Agrarpolitik stieß an technische Grenzen. Der damalige EU-Kommissionspräsident Walter Hallstein forderte ein eigenes Budget für die Agrarpolitik und schnellere Abstimmungsregeln. Der Ministerrat sollte das lähmende Konsensprinzip aufgeben und mit Mehrheit entscheiden, verlangte Hallstein. Fünf Regierungen gaben ihm recht. Nur Frankreich sperrte sich. Am 1. Juli 1965 zog Präsident Charles De Gaulle die Notbremse. In einer Fernsehansprache an die Franzosen erklärte der Präsident, die Partnerländer verfolgten ungeheuerliche Pläne.
"Diejenigen, die sich das ausgedacht haben, träumen von einer europäischen Föderation, in der die Staaten ihre Persönlichkeit verlieren würden. Eine Föderation, die von einem technokratischen, staatenlosen und unverantwortlichen Rat regiert würde. Diesem Projekt, das außerhalb jeder Realität steht, stellt Frankreich eine Zusammenarbeit der Staaten gegenüber, die sich wahrscheinlich zu einer Konföderation entwickeln würde. Nur dieser Plan entspricht der Natur der Nationen auf unserem Kontinent."

Schritt für Schritt mehr Demokratie und Transparenz
Die Vorstellung, Frankreich könne in Brüssel überstimmt werden, empfand De Gaulle als eine solche Zumutung, dass er fortan mit der so genannten Politik des leeren Stuhls die gesamte Europäische Politik blockierte. Kein französischer Minister durfte mehr nach Brüssel reisen, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war lahm gelegt, das Projekt Europa stand vor dem Aus.
Erst nach mehr als sechs Monaten, im Januar 1966, erreichte die Luxemburger Regierung als Vermittler den sogenannten Luxemburger Kompromiss: Im Prinzip wird in der Gemeinschaft mit Mehrheit entschieden, aber wenn ein Land "sehr wichtige Interessen" geltend macht, dann wird weiter verhandelt bis ein Konsens gefunden ist. Das rettete die EWG.
Im Kern gilt der Luxemburger Kompromiss bis heute und er ist so etwas wie die Blaupause für jede europäische Weiterentwicklung geworden: Schritt für Schritt mehr Demokratie, mehr Transparenz, aber immer eine Hintertür, damit dieses Europa für die nationalen Regierungen nicht zu anstrengend wird, damit sich dieses Europa nicht zu sehr in die nationale Politik einmischt.
Selbst als die Regierungen 1979 die ersten Wahlen zu einem Europäischen Parlament ansetzten, machten sie gleich wieder einen Schritt zurück. Die frischgewählten Parlamentarier durften diskutieren, aber nichts entscheiden. Ingo Friedrich von der CSU war einer der ersten gewählten Europaabgeordneten:
"Wir mussten nur angehört werden, wenn die Kommission irgendetwas machen wollte oder der Ministerrat. Und dann, so nach zwei, drei Jahren, ist uns folgender Trick eingefallen, dass wir gesagt haben, wir beraten gar nicht, selbst, wenn wir gefragt werden, dann antworten wir nicht. Und dann konnten wir mit diesem Trick sozusagen die Gesetzgebung aufhalten und ein Stück weit beeinflussen."
Erst nach mehr als sechs Monaten, im Januar 1966, erreichte die Luxemburger Regierung als Vermittler den sogenannten Luxemburger Kompromiss: Im Prinzip wird in der Gemeinschaft mit Mehrheit entschieden, aber wenn ein Land "sehr wichtige Interessen" geltend macht, dann wird weiter verhandelt bis ein Konsens gefunden ist. Das rettete die EWG.
Im Kern gilt der Luxemburger Kompromiss bis heute und er ist so etwas wie die Blaupause für jede europäische Weiterentwicklung geworden: Schritt für Schritt mehr Demokratie, mehr Transparenz, aber immer eine Hintertür, damit dieses Europa für die nationalen Regierungen nicht zu anstrengend wird, damit sich dieses Europa nicht zu sehr in die nationale Politik einmischt.
Selbst als die Regierungen 1979 die ersten Wahlen zu einem Europäischen Parlament ansetzten, machten sie gleich wieder einen Schritt zurück. Die frischgewählten Parlamentarier durften diskutieren, aber nichts entscheiden. Ingo Friedrich von der CSU war einer der ersten gewählten Europaabgeordneten:
"Wir mussten nur angehört werden, wenn die Kommission irgendetwas machen wollte oder der Ministerrat. Und dann, so nach zwei, drei Jahren, ist uns folgender Trick eingefallen, dass wir gesagt haben, wir beraten gar nicht, selbst, wenn wir gefragt werden, dann antworten wir nicht. Und dann konnten wir mit diesem Trick sozusagen die Gesetzgebung aufhalten und ein Stück weit beeinflussen."
Mehr als 80 Prozent der Europäischen Gesetzgebung vergemeinschaftet
Das Europaparlament hat sich seine Rechte erkämpft, schrittweise und mit der öffentlichen Meinung im Rücken. Bei jeder Regierungskonferenz, bei jedem neuen europäischen Vertrag bekam das Parlament zusätzliche Mitspracherechte.
Mehr als 80 Prozent der Europäischen Gesetzgebung sind inzwischen vergemeinschaftet. Das heißt, im Ministerrat entscheiden die EU-Regierungen mit Mehrheit, das Europäische Parlament ist an der Entscheidung gleichberechtigt beteiligt und die Europäische Kommission sorgt dafür, dass das neue Gesetz umgesetzt und eingehalten wird. Fast wie in einer ganz normalen Demokratie.
Mehr als 80 Prozent der Europäischen Gesetzgebung sind inzwischen vergemeinschaftet. Das heißt, im Ministerrat entscheiden die EU-Regierungen mit Mehrheit, das Europäische Parlament ist an der Entscheidung gleichberechtigt beteiligt und die Europäische Kommission sorgt dafür, dass das neue Gesetz umgesetzt und eingehalten wird. Fast wie in einer ganz normalen Demokratie.
Aber es gibt eben Ausnahmen, viele Ausnahmen. Vor allem beim Geld ist die Angst der Regierungen, überstimmt zu werden, besonders groß. Bei der Bewältigung der Bankenkrise hat die EU in den letzten zehn Jahren praktisch alle wichtigen Regeln auf zwischenstaatlichem Weg verabschiedet: Die Rettungsschirme für die Banken, die Notprogramme, die verschärften Finanzregeln. Ulrike Guérot ist Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems in Österreich:
"Wir haben haufenweise Vertragsrecht außerhalb der Verträge gemacht, dieses sogenannte Sixpack, Twopack und so weiter. Das ist alles intergouvernemental, das waren alles sozusagen Spaghettiverträge, ein Vertragsgeflecht aus bilateralen Verträgen. Und das ist ja immer noch nicht überführt worden in europäisches Recht, weswegen das europäische Recht inzwischen so unübersichtlich geworden ist, dass man sich ja schon als Spezialistin kaum noch auskennt."

Finanzsektor als nationalstaatliche Insel
Vor der Krise war der gesamte Finanzsektor weitestgehend national organisiert. Mit dem Zusammenbruch der Lehman-Brothers-Bank und der verheerenden Kettenreaktion auf den Finanzmärkten wurde schlagartig klar, wie ohnmächtig nationale Regierungen auf dem Weltmarkt sind. Doch beim anschließenden Aufbau einer europäischen Finanz- und Bankenkontrolle achteten die Finanzminister schon wieder sehr genau darauf, nichts aus der Hand zu geben. Die deutsche Regierung sorgte dafür, dass die neuen Kontrollrechte der Europäischen Kommission weitgehend auf die Krisenstaaten beschränkt wurden. Auf keinen Fall sollte Brüssel Einfluss auf die deutsche Finanzpolitik bekommen.
Einige Mitgliedsstaaten wollen keine mächtige Bankenkontrolle in Brüssel, meint die frühere EU-Kommissarin Monika Wulf-Mathies. Die EU-Kommission dürfe deshalb lediglich die nationalen Bankenkontrolleure koordinieren:
"Dann sagen alle, wir müssen ja auch Herr unserer Entscheidungen bleiben. Die Folge ist aber, dass jedes Land entscheidet, wie streng oder wie konkret sie bestimmte Dinge wahrnehmen wollen, und an den Schnittstellen zwischen den Institutionen der einzelnen Mitgliedsstaaten entstehen gefährliche Lücken, die im Krisenfall dazu führen, dass man nicht optimal reagieren kann."
Die Europäische Union brauche eine effiziente Bankenkontrolle, fordert auch Alexander Stubb von der Europäischen Investitionsbank. Stubb war früher Europaabgeordneter und er war finnischer Ministerpräsident und finnischer Finanzminister. Er kennt die Diskussionen auf EU-Gipfeln und im Ministerrat und versteht, dass einige Regierungen zögern. Länder wie Italien müssten erst ihre Banken solide genug aufstellen, sagt Stubb, bevor die EU einen Teil der Risiken übernehmen könne.
"Wir brauchen für die gemeinsame Währung irgendwann auch eine Wirtschaftsunion. Aber das muss zur rechten Zeit passieren, wenn alles passt. Wenn wir zu früh anfangen, die Risiken zu teilen, könnte das für manche Länder eine Versuchung sein. Wir sehen das gerade in Italien."
Einige Mitgliedsstaaten wollen keine mächtige Bankenkontrolle in Brüssel, meint die frühere EU-Kommissarin Monika Wulf-Mathies. Die EU-Kommission dürfe deshalb lediglich die nationalen Bankenkontrolleure koordinieren:
"Dann sagen alle, wir müssen ja auch Herr unserer Entscheidungen bleiben. Die Folge ist aber, dass jedes Land entscheidet, wie streng oder wie konkret sie bestimmte Dinge wahrnehmen wollen, und an den Schnittstellen zwischen den Institutionen der einzelnen Mitgliedsstaaten entstehen gefährliche Lücken, die im Krisenfall dazu führen, dass man nicht optimal reagieren kann."
Die Europäische Union brauche eine effiziente Bankenkontrolle, fordert auch Alexander Stubb von der Europäischen Investitionsbank. Stubb war früher Europaabgeordneter und er war finnischer Ministerpräsident und finnischer Finanzminister. Er kennt die Diskussionen auf EU-Gipfeln und im Ministerrat und versteht, dass einige Regierungen zögern. Länder wie Italien müssten erst ihre Banken solide genug aufstellen, sagt Stubb, bevor die EU einen Teil der Risiken übernehmen könne.
"Wir brauchen für die gemeinsame Währung irgendwann auch eine Wirtschaftsunion. Aber das muss zur rechten Zeit passieren, wenn alles passt. Wenn wir zu früh anfangen, die Risiken zu teilen, könnte das für manche Länder eine Versuchung sein. Wir sehen das gerade in Italien."
Hochsensible Bereiche: Steuerpolitik und Wirtschaftspolitik
Im Klartext: Politiker wie der italienische Innenminister Matteo Salvini könnten die gemeinsame Risikovorsorge als Einladung für eine unverantwortliche Ausgabenpolitik verstehen. Zudem gebe es eben Politikbereiche, so der finnische Ex-Premierminister Stubb, die stärker national verankert seien und deshalb länger brauchten, um auf europäischer Ebene anzukommen:
"Das sind einfach Bereiche, die sehr eng mit der nationalen Souveränität verknüpft sind. Steuerpolitik zum Beispiel oder Wirtschaftspolitik, das sind sensible Bereiche, wie auch Bildung, viele dieser Themen sind einfach im Kern nationale Themen."
Besonders umstritten ist die Innen- und Rechtspolitik. Auch hier geht es oft um nationale Traditionen und Eigenheiten. Aber Kriminalität macht an den Grenzen nicht halt. Deshalb wurde die Innen- und Rechtspolitik schon vor zehn Jahren im Lissabonner Vertrag zur Gemeinschaftspolitik erklärt. Das bedeutet, dass die EU-Kommission in diesem Bereich Gesetze vorschlagen darf, die dann im Ministerrat und im Europäischen Parlament jeweils mit Mehrheit beschlossen werden können. Im Prinzip.
"Das sind einfach Bereiche, die sehr eng mit der nationalen Souveränität verknüpft sind. Steuerpolitik zum Beispiel oder Wirtschaftspolitik, das sind sensible Bereiche, wie auch Bildung, viele dieser Themen sind einfach im Kern nationale Themen."
Besonders umstritten ist die Innen- und Rechtspolitik. Auch hier geht es oft um nationale Traditionen und Eigenheiten. Aber Kriminalität macht an den Grenzen nicht halt. Deshalb wurde die Innen- und Rechtspolitik schon vor zehn Jahren im Lissabonner Vertrag zur Gemeinschaftspolitik erklärt. Das bedeutet, dass die EU-Kommission in diesem Bereich Gesetze vorschlagen darf, die dann im Ministerrat und im Europäischen Parlament jeweils mit Mehrheit beschlossen werden können. Im Prinzip.

In der Praxis haben die europäischen Regierungen bei Fragen der Innen- und Rechtspolitik über all die Jahre weiterhin an der Einstimmigkeit festgehalten. Eine intergouvernementale Praxis, die nun zurückschlägt.
Denn auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise , als alle Versuche einer gerechteren Verteilung der Flüchtlinge gescheitert waren, wollte man zum letzten Mittel greifen. In einer dramatischen Kampfabstimmung stimmten 20 von 28 EU-Staaten für die Umsiedlung von 120.000 Flüchtlingen vorwiegend aus Italien und Griechenland in die anderen Mitgliedsstaaten. Ungarn, Tschechien, Rumänien und die Slowakei waren strikt dagegen, wurden aber von einer Mehrheit überstimmt.
Denn auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise , als alle Versuche einer gerechteren Verteilung der Flüchtlinge gescheitert waren, wollte man zum letzten Mittel greifen. In einer dramatischen Kampfabstimmung stimmten 20 von 28 EU-Staaten für die Umsiedlung von 120.000 Flüchtlingen vorwiegend aus Italien und Griechenland in die anderen Mitgliedsstaaten. Ungarn, Tschechien, Rumänien und die Slowakei waren strikt dagegen, wurden aber von einer Mehrheit überstimmt.
"Man hat die Mehrheitsentscheidungen nicht genutzt"
Doch die Entscheidung bleibt bislang ohne Folgen. Vor allem Ungarn weigert sich, auch nur einen einzigen Flüchtling aus dem Kontingent aufzunehmen. Die Regierungen, auch die deutsche, hätten sich das selbst zuzuschreiben, sagt Elmar Brok, der viele Jahre lang im Europaparlament für institutionelle Fragen zuständig war.
"Wir müssen feststellen, dass man die Möglichkeiten der Mehrheitsentscheidung im Rat nicht genutzt hat. Das ist ein eigentlich rechtswidriges Verhalten der Innenminister nach 2010. Und jetzt hatte man das einmal bei der Verteilung der Flüchtlinge gemacht und dann wurde das von der betroffenen Seite, die verloren hatte, nicht akzeptiert, weil die sagen, man hat‘s ja früher auch anders gemacht. Das ist Gewohnheitsrecht, doch beim Konsens zu bleiben."
Seit vier Jahren bewegt sich nichts mehr in der Flüchtlingsfrage. Ungarn weigert sich und die anderen Regierungen finden keine Mittel, Budapest zum Einlenken zu bringen. Selbst ein klares Urteil des Europäischen Gerichtshofes gegen Ungarn hat bisher nichts daran geändert. Die Praxis der zwischenstaatlichen Entscheidungen in der Innenpolitik hat sich damit verfestigt.
Europäisches Recht ist das Ergebnis von Machtkämpfen, von Präzedenzfällen, von Gewohnheiten, die sich durchgesetzt haben. Ob die Regierungschefs in den kommenden Tagen den nächsten Kommissionspräsidenten ernennen oder ob das Europäische Parlament sich auf einen der Spitzenkandidaten einigen und ihn auch durchsetzen kann, das wird nicht ohne Auswirkungen auf die europäische Demokratie bleiben. Wenn das Parlament den Machtkampf gewinnt, werden alle künftigen Kommissionspräsidenten aus Europawahlen hervorgehen. Wenn sich die Regierungschefs durchsetzen, werden auch die nächsten EU-Chefs wieder zwischenstaatlich im Hinterzimmer ausgekungelt.
Seit vier Jahren bewegt sich nichts mehr in der Flüchtlingsfrage. Ungarn weigert sich und die anderen Regierungen finden keine Mittel, Budapest zum Einlenken zu bringen. Selbst ein klares Urteil des Europäischen Gerichtshofes gegen Ungarn hat bisher nichts daran geändert. Die Praxis der zwischenstaatlichen Entscheidungen in der Innenpolitik hat sich damit verfestigt.
Europäisches Recht ist das Ergebnis von Machtkämpfen, von Präzedenzfällen, von Gewohnheiten, die sich durchgesetzt haben. Ob die Regierungschefs in den kommenden Tagen den nächsten Kommissionspräsidenten ernennen oder ob das Europäische Parlament sich auf einen der Spitzenkandidaten einigen und ihn auch durchsetzen kann, das wird nicht ohne Auswirkungen auf die europäische Demokratie bleiben. Wenn das Parlament den Machtkampf gewinnt, werden alle künftigen Kommissionspräsidenten aus Europawahlen hervorgehen. Wenn sich die Regierungschefs durchsetzen, werden auch die nächsten EU-Chefs wieder zwischenstaatlich im Hinterzimmer ausgekungelt.