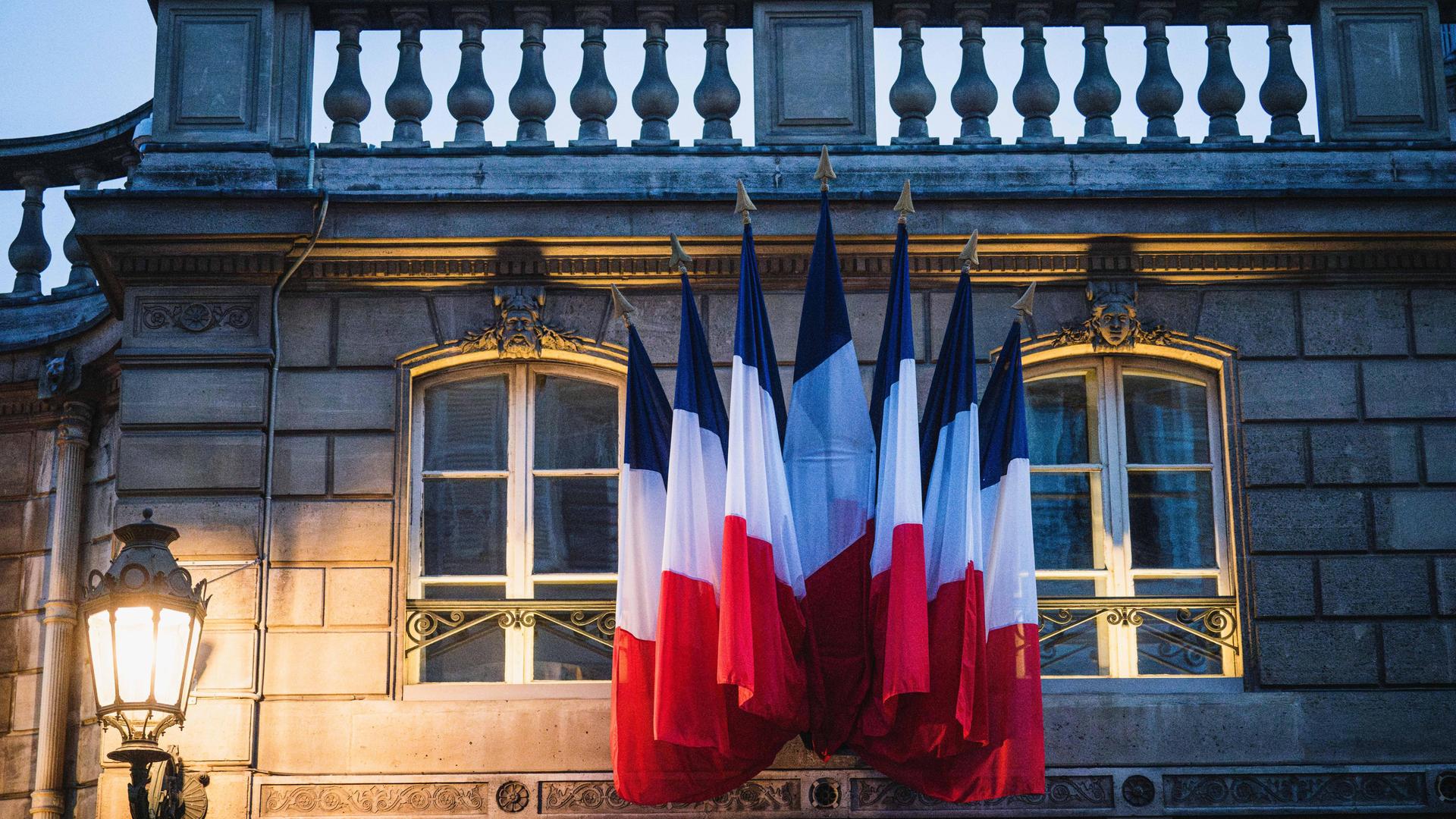Frankreich befindet sich mindestens seit dem Sommer 2024 in einer politischen Krise. Am Wahlabend der Europawahl am 9. Juni 2024 hatte Präsident Emmanuel Macron nach dem Erfolg rechtsextremer Parteien das französische Parlament vorzeitig aufgelöst.
Sein Kalkül ging jedoch nicht auf: Seit der Neuwahl im Sommer 2024 verfügt das Regierungslager in der Nationalversammlung über keine Mehrheit.
Die aktuelle Mitte-rechts-Regierung von Sébastien Lecornu ist die vierte Regierung seit der Wahl. Mitte Oktober 2025 ist Lecornu auf die Opposition zugegangen, indem er die Aussetzung der umstrittenen Rentenreform ankündigte. Ohne drohte ihm schon nach wenigen Tagen im Amt der Sturz – der zweite innerhalb weniger Wochen.
Doch die politische Krise in Frankreich ist noch nicht gelöst. Außerdem droht die Aussetzung der Rentenreform sich negativ auf das ohnehin schon sehr hohe Staatsdefizit auszuwirken.
Welche Gründe hat die politische Krise in Frankreich? Und: Was braucht es jetzt?
Inhalt
- Inwiefern ist Präsident Macron mitverantwortlich für die Krise?
- Welche Rolle spielt das französische politische System?
- Welchen Anteil hat die Rolle des Präsidenten?
- Welche Optionen gibt es für Frankreich außer Neuwahlen?
- Welche Auswirkungen hat die Krise auf Frankreich und auf die EU?
- Wie geht es jetzt weiter?
Inwiefern ist Präsident Macron mitverantwortlich für die Krise?
Der französische Präsident Emmanuel Macron wird von vielen in Frankreich für die unklaren Mehrheitsverhältnisse verantwortlich gemacht – da er die Nationalversammlung aufgelöst hat. Sein Ziel, sein eigenes Lager zu stärken, hat er nicht erreicht: Es ist geschwächt daraus hervorgegangen.
In der Nationalversammlung hat kein politischer Block eine absolute Mehrheit. Deshalb bräuchte es eigentlich Kompromisse – vor allem, um den Haushalt 2026 zu verabschieden. Daran war auch schon die Regierung gescheitert, bevor Lecornu das erste Mal versucht hat, selbst eine zu bilden.
Insgesamt spiele auch der Zuschnitt des Präsidentenamts in Frankreich eine Rolle bei der derzeitigen Krise. Die Verfassung der Fünften Republik sehe „einen im Grunde fast monarchischen Präsidenten“ vor, so Historiker und Frankreich-Experte Leonhard Horowski.
Der französische Präsident werde heute inszeniert wie ein König. So residiere er beispielsweise in den Königspalästen der Zeit vor der Französischen Revolution 1789. Dazu gehörten Dinge wie die Kavallerie, eine Leibgarde und die Gobelins Ludwigs XIV.
Diese Inszenierung produziere sehr viel größere Erwartungen an ihn, als sie an einen technokratischen Bundeskanzler gestellt würden, erläutert Horowski.
Welche Rolle spielt das französische politische System in der aktuellen Krise?
In anderen Ländern seien parteiübergreifende Kompromisse Alltag, so Politologe Dorian Dreuil. Doch in Frankreich müssten die Abgeordneten in der Nationalversammlung das erst lernen. Kompromisse gelten dort oft als kompromittierend.
Allerdings sieht das französische politische System mit dem Mehrheitswahlrecht Kompromisse auch nicht vor: Es ist darauf ausgelegt, dass es eine klare Mehrheit gibt und dass der Präsident oder zumindest die Regierung durchregieren kann. Zu der inzwischen zersplitterten politischen Landschaft scheint dieses politische System aber nicht mehr zu passen.
Diese „Unmöglichkeit, sich politisch über irgendetwas zu einigen“ habe ihre Wurzeln in der Geschichte Frankreichs, erklärt Historiker und Frankreich-Kenner Leonhard Horowski. „Sie finden aufgrund der historischen Entwicklung ganz viele Vertreter der Französischen Republik, die unglaubliche Nostalgie für Revolutionen haben." Es gebe eine Begeisterung, mit der man bestehende Strukturen zum Einsturz bringt.
Welche Optionen gibt es für Frankreich außer Neuwahlen?
Momentan scheint Lecornu ein Scheitern seiner neuen Regierung zumindest vorerst abgewendet zu haben.
Doch für den Fall, dass die Regierung doch erneut gestürzt werden sollte, hatte Präsident Macron bereits vor Lecornus Ankündigung zur Rentenreform Neuwahlen in Aussicht gestellt.
Nach aktuellen Informationen wäre der rechtsnationale Rassemblement National der große Gewinner einer Neuwahl – jedoch möglicherweise auch ohne absolute Mehrheit.
Eine weitere Möglichkeit, um aus einer weiteren krisenhaften politischen Situation herauszukommen, wäre ein Rücktritt von Präsident Macron. Doch das lehnte er zumindest bislang ab. Sein Argument: Die Französinnen und Franzosen hätten ihm ein Mandat bis 2027 gegeben. Zudem sieht er sich als Garant für Stabilität.
Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass Präsident Macron versucht, wechselnde Mehrheiten für seine Projekte zu organisieren.
Welche Auswirkungen hat die Krise auf Frankreich und auf die EU?
Umfragen in Frankreich zeigen, dass das Vertrauen in die Politik des Landes – angesichts mehrerer gescheiterter Regierungen – über Jahre immer schwächer wurde. Laut aktueller Daten vertrauen nur noch 17 Prozent der Menschen im Land Präsident Macron – ein sehr niedriger Wert.
„Hier wird gerade das Gefühl erzeugt, dass die parlamentarische Demokratie in diesem Land nicht funktionieren kann, dass Koalitionen nicht klappen, dass Kompromisse nicht möglich sind“, erklärt Politologe Dorian Dreuil von der linksgerichteten Stiftung Jean Jaurès. Mögliche Folge: „Irgendwann denken die Leute, dass es wohl besser ist, wenn sich die Demokratie auf die Macht einiger weniger Persönlichkeiten stützt.“
Die Ereignisse in der französischen Politik haben aber auch Auswirkungen auf Europa und nicht zuletzt auf Deutschland. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU – zudem die mit den höchsten Schulden – und kann, wenn es weiter bergab geht, die EU und die Eurozone in Mitleidenschaft ziehen.
Sollte letztlich im Zuge der politischen Krise die extreme Rechte an die Macht kommen, müsste sich Europa auf eine völlig veränderte Situation einstellen. Der Rassemblement National will beispielsweise Frankreichs EU-Beiträge kürzen. Außenpolitisch sind die Rechtsnationalen skeptisch gegenüber den Sanktionen gegen Russland, zum Teil auch gegenüber der militärischen Unterstützung der Ukraine.
Über die Unterstützung für die Ukraine hinaus brauche Europa eine starke französische Regierung für weitere wichtige Vorhaben. Das betont Franziska Brantner, langjährige Frankreichkennerin und Co-Vorsitzende von Bündnis ‘90/Die Grünen. Als solche nennt sie: Digitalisierung, Energiepolitik, Wettbewerbsfähigkeit und den Wiederaufbau im Nahen Osten.
Wie geht es jetzt weiter?
Falls auch der zweite Regierungsversuch von Ministerpräsident Sébastien Lecornu scheitert, bliebe das möglicherweise nicht ohne tiefgreifende Folgen, erklärt Politologe Dorian Dreuil: Es bestehe die Gefahr, dass die Demokratie und ihre Institutionen durch das „nationale Psychodrama“, das Frankreich derzeit erlebe, langfristig Schaden nehmen.
Die Aussetzung der Rentenreform, die Premierminister Lecornu in seiner Regierungserklärung angekündigt hat, könnte ein Schritt in Richtung eines Lernprozesses zu Kompromissen sein.
Historiker Leonhard Horowski hält es für möglich, dass die Fünfte Französische Republik tatsächlich die Kraft zur Veränderung findet. Und zwar – ausgerechnet – „angesichts der starken Tradition, keine Kompromisse zu machen“ sowie der Erfahrung, dass man bereits „ein System zerbrochen und neu konstruiert hat“ – was historisch gesehen relativ kurz zurückliege.
Es bleibe zu hoffen, dass diese Veränderung zu einer neuen Form der Demokratie führt, so Horowski: einer etwas funktionaleren, vielleicht auch mit einem weniger polarisierenden Wahlrecht ausgestatteten. Und nicht zu der „Art von Staat, die zum Beispiel die Anhänger von Le Pen sich im Zweifelsfall eher wünschen“.
abr