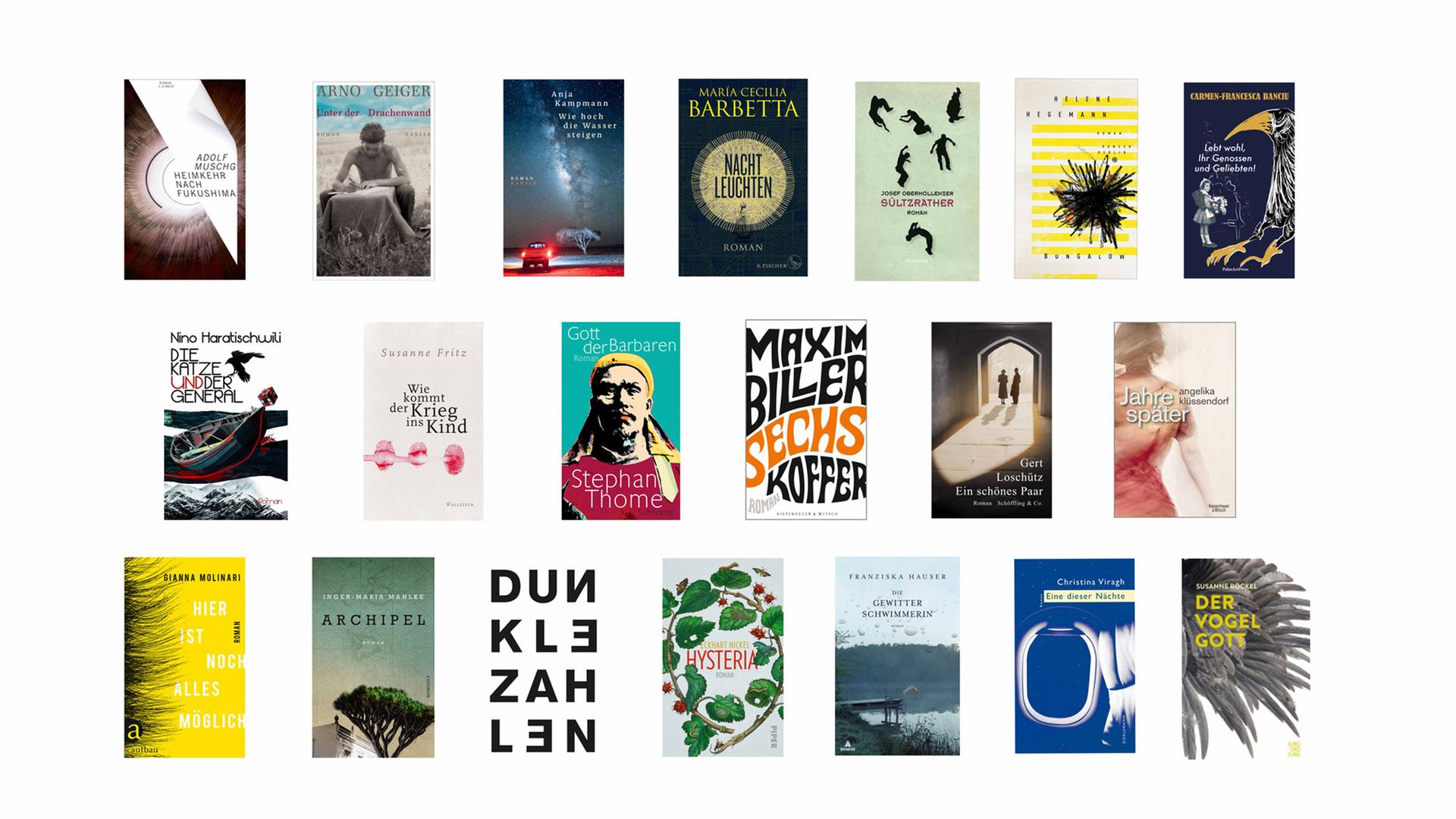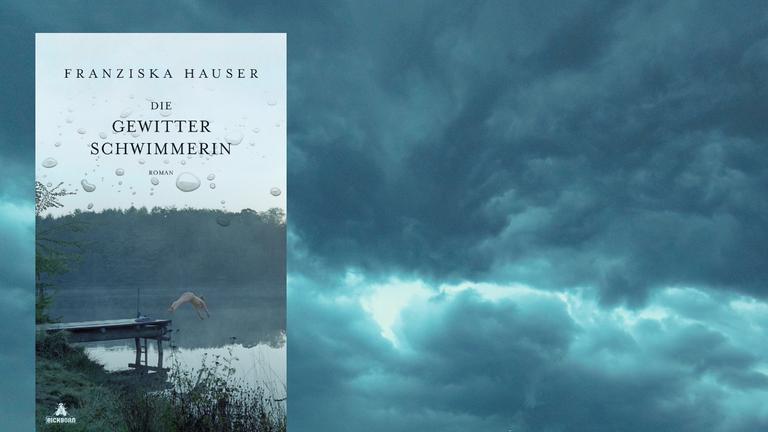
Auf der letzten Seite hofft Tamara, vom Blitz getroffen zu werden, mitten im See, dort, wo sie immer schon untergetaucht ist, wenn es ihr zu viel wurde. Aber das Gewitter zieht vorbei, die Protagonistin in Franziska Hausers zweitem Roman bleibt verschont. Es ist die finale Pointe in diesem Mehrgenerationenbuch, in dem auf mehr als 420 Seiten niemand jemals Schonung erfährt.
Von Friedrich Hirsch, geboren 1883, bis zu dessen Urenkelin Henriette Hirsch, Jahrgang 1975, reicht bei Hauser der Personenreigen. Innerhalb dieses Zeitraums widerfahren den Familienmitgliedern viele der Gräuel, die das zwanzigste Jahrhundert zu bieten hat: Friedrich wächst im Kaiserreich auf, inmitten des wachsenden Antisemitismus, und muss 1938 nach England ins Exil fliehen. Sein Sohn Alfred wiederum flüchtet nach Südfrankreich, um dort im Widerstand gegen die Nazi-Okkupation zu kämpfen, gemeinsam mit seiner ersten großen Liebe Esther; später wird er als Publizist und Schriftsteller in der DDR Karriere machen. Tamara, Alfreds Tochter, wird ihr Glück als diplomierte Puppenspielerin u. a. in Ost-Berlin versuchen und ihre Kräfte an der engstirnigen sozialistischen Doktrin verschleißen. Während gut die Hälfte der Passagen auf einzelne Familienfiguren fokussieren, sind die restlichen Kapitel aus Tamaras Sicht geschrieben:
"Schweigend fahren wir aus der Ödnis wieder ab. Ich fühle, wie eine große Bedrohung in meinen Körper fließt, darin kleben bleibt wie Harz. In der Stadt ist die Welt wieder lebendig. Ich sehe die Menschen in den Straßen Kinderwägen schieben, Einkaufstauschen tragen, einander an den Händen halten. Bestimmt sind keine Juden mehr darunter. Ich stelle mir vor, wie alle Schuhe, die im KZ auf dem Berg liegen, leer auf den Straßen zwischen den Menschen herumlaufen. Warum Papa lieber Kommunist sein will und kein Jude, weiß ich jetzt. Kommunisten kämpfen, Juden werden ermordet."
Von Kindesbeinen an alkoholabhängig
In diesen makrohistorischen Kontext sind private Ereignisse eingebettet, in denen sich der faule Kern der Familie Hirsch zeigt: Vater Alfred vergewaltigt seine Töchter, ebenso missbrauchen andere Familienmitglieder die beiden Mädchen. Die jüngere Dascha, 1954 geboren, wird bereits als Kind tabletten- und alkoholabhängig; bis an ihr Lebensende wird sie durch eine Hölle aus Verleugnungen, Klinikaufenthalten und Abtreibungen gehen. Sie ist die Hauptgeschädigte dieser Familie, und neben der Haushälterin Irmgard, die als eifriger Schatten mehr als fünfzig Jahre die Hirschs begleitet, ist sie die spannendste Figur, ophelia-haft gefangen in einem Wirbel aus Wahnsinn und Verschweigen.
"Mein Bewusstsein tastet sich im Hinterkopf langsam an den Tod heran. Mein Gehirn hat eine Schranke zugemacht zwischen Dascha und dem Tod. Damit ich nicht überfahren werde. Ich setze mich auf die niedrige Mauer. Seit Jahren bin ich auf Daschas Tod vorbereitet. Es hilft aber nichts. Wie durch dichte Watte schleicht sich in mir der Mensch langsam an, der zu dem Tod gehört. Dascha trifft auf den Tod, und ich finde, sie gehören nicht zusammen. Dass Dascha und der Tod lange zusammengehörten, will ich immer noch nicht wahrhaben. Etwas ist total schiefgelaufen."
Indes wird gleich zu Beginn deutlich, dass der "Gewitterschwimmerin" die nötige Sprache und epische Koordination abgeht, um die vielen Erzählstränge miteinander zu verknüpfen. Selten gelingen der Autorin markante Szenen oder pointierte Bilder, viel zu oft schlittert ihr Stil in einer Kombination aus Ungeschicklichkeit und Ambition umher:
"'Du bist der einzige Mann auf der Welt, den ich wirklich liebe!', lallt sie leise, nimmt seine Hände, sieht ihn theatralisch an, als versuche sie, durch reine Willenskraft das Wort Liebe mit Tränen auf ihre faltigen Wangen zu schreiben. Sie lässt die Miene fallen wie eine Maske und seine Hände auch."
So bleiben die vielen Figuren rudimentäre Sprachpuppen, die einem einzigen Gefühl unterworfen sind: Groll oder Gram, Lust oder Leere. Neben diese Banalisierung von Psychen, die keinem Menschen zu keiner Zeit gerecht wird, tritt ein anekdotisches Verständnis von Historie. In sechzig Kapiteln, in einem Defilee von Episoden, Erinnerungen und Eskapaden, wird von allem ein wenig geboten. Mal wird uns vom KZ Dachau berichtet, in das Friedrich verschleppt wurde. Mal springen wir in die DDR, als Alfred unter Zwang von der Stasi rekrutiert wird, um seine Schriftstellerfreunde zu bespitzeln. Aber wenig in diesem bloß additiven Roman wächst über den Status von Familieninterna oder Wissenshäppchen aus dem Geschichtsbuch hinaus. Über weite Strecken ist der Text wenig mehr als ein Haufen aus Geschichte und Geschichten.
Scheu vor der Gegenwart
Zum sprachlichen Dilettantismus gesellt sich historiographische Schludrigkeit. An einer Stelle lässt die Autorin im Sommer 1939 jüdische Figuren nach Auschwitz deportieren, Wochen bevor Deutschland Polen überfällt, zwei Jahre bevor das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Betrieb genommen wird. Ab diesem Zeitpunkt steht Hausers Schreibprojekt grundsätzlich auf der Kippe, will es doch die Genese einer Familie im Hallraum dieses Jahrhunderts der Extreme beschreiben.
Immerhin gibt es nach gut hundertfünfzig Seiten weit weniger schiefe Sprachbilder, auch dem willkürlichen Erzählzoom mal auf die eine, dann auf die andere Figur wird Einhalt geboten. Kurzum: Das Buch wird ab der Hälfte zu einem soliden historischen Familienroman, wie er seit Jahren die Leselust nach ein wenig Geschichte und nach viel Emotion bedient. Einen substantiellen, gar innovativen Beitrag zu diesem Genre, wie ihn etwa Per Leo 2014 mit "Flut und Boden" lieferte, erbringt Hauser freilich nicht.
Das liegt neben vielen anderen Schwächen auch an der Scheu, die der Text vor der Gegenwart hegt, vor der narrativen Implikation, dass mehr als ein Jahrhundert erzählte deutsche Realgeschichte nicht plötzlich aufhört, sondern im Hier und Jetzt weiterwirkt und weiterschwelt. Davon ist bei Hauser nirgends die Rede, die Gegenwart ist ein entpolitisiertes Plateau, von dem aus nur nach hinten geblickt wird. Dabei ist ihr Material himmelschreiend aktuell: Antisemitismus und Überwachung, Missbrauch und Flucht, Faschismus und Assimilation. Tatsächlich steckt der Roman just an dieser Scharnierstelle fest: Weil ihm die literarische Objektivierung seines historischen-privaten Materials misslingt, schreibt er sich konsequent in die eigene Irrelevanz hinein. So enttäuscht das Buch gleich doppelt: als Auskunft über vergangene Zeiten ebenso wie als Zeitkommentar, der in der Fiktion heutige in früheren Missständen spiegelt.
Besser als der DDR-Schund?
Kurz bevor Tamara Hirsch am Ende in den See steigt, gibt es eine Szene, die einen Einblick in die Motivation hinter der "Gewitterschwimmerin" gewährt. Die Tochter von Tamara, Henriette, schlägt einen Roman ihres Großvaters Alfred auf:
"Jetzt war sie achtzehn und versuchte, eines seiner Bücher zu lesen. Alfred konnte unmöglich das ganze Buch so kompliziert formuliert haben, dachte sie nach der ersten Seite. Kreischend bohrten sich die weit aufgerissenen Mäuler der schwarzen Kräne in die bunten Leiber der Schleppkähne. Alfreds Bücher waren hässlich. Henriette wusste schon als Kind, dass Tamara sie deshalb nicht lesen konnte. Tamara konnte nur Bücher mit schönen Umschlägen lesen. Henriette las auch hässliche Bücher. Nur Alfreds nicht."
Wie Henriette Hirsch ist Franziska Hauser 1975 geboren. In einer Notiz am Anfang weist die Autorin darauf hin, der Roman basiere auf der "tatsächlichen Geschichte meiner Familie". Eine autofiktionale Nähe zwischen beiden darf ohne allzu schlechtes Gewissen angenommen werden. Aber bleiben wir in der Fiktion: Die Enkelin blättert widerwillig in einem Buch ihres Großvaters und tut es als ideologisch überfrachteten Schinken des sozialistischen Realismus ab. Nur zwei Seiten später wird Henriette ihre Mutter Tamara in einem Kapitel, das 2012 spielt, zur Rede stellen:
"'Warum bist du eigentlich so geworden, wie du nicht sein wolltest?' Henriette legte ihr Handy auf den Tisch. Die Pegelanzeige der Diktiergerät-App fing an zu zappeln, als ein Flugzeug über den Garten flog. 'Ich höre dir zu, aber ich umarme dich nicht, wenn du weinst', sagte Henriette streng und verschränkte die Arme."
Hier beginnt das Gegenprojekt zur großväterlichen DDR-Literatur. Aus der oralen Geschichtsschreibung, wie sie an dieser Stelle inszeniert wird, geht dieser Roman, "Die Gewitterschwimmerin", hervor. Einem Offenbarungseid kommt dabei die implizite Setzung gleich, dort sei der Ideologie-Schund des Großvaters zu finden, hier der bessere, andere, wertvollere Roman der Enkelin. Denn so plump der sozialistische Realismus oftmals war, so platt nimmt sich zwei Generationen später Franziska Hausers völlig überforderter Familienroman aus.
Franziska Hauser: "Die Gewitterschwimmerin", Eichborn, Köln, 431 Seiten, 22 Euro