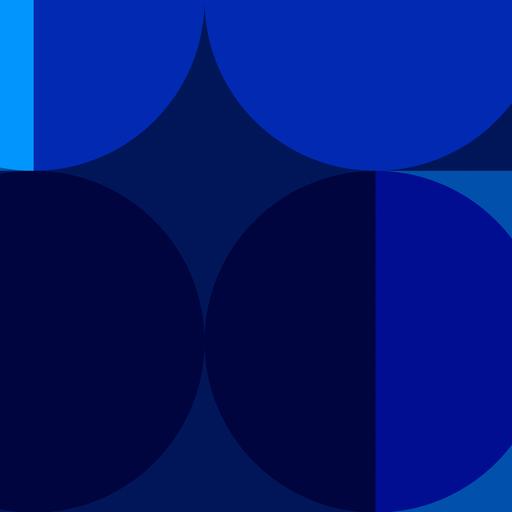Nach dem Rücktritt Margot Käßmanns vor fünf Jahren war Nikolaus Schneider sehr plötzlich Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland geworden. Anfangs sei er darüber gar nicht begeistert gewesen, sagte er im DLF. "Das war ein gewisser Automatismus. Ich hatte keine Wahl, ich war ihr Stellvertreter."
Dass Schneider oftmals als linker Arbeiterpriester bezeichnet wird, betrachtet er selbst als verkürzte Darstellung. Soziale Missstände prangert er zwar an, aber immer aus einem christlichen Selbstverständnis heraus. "Als Pfarrer haben wir an der Seite der Menschen zu stehen und sie in ihren Ängsten zu begleiten. " Schneider habe sich stets nur aus seinem Glauben heraus engagiert. "Da habe ich auch nicht nach Parteipolitik geguckt."
Das Gespräch in voller Länge:
Sprecher: Jovial und mit einer rheinischen Gelassenheit, so hat ihn der "Rheinische Merkur" einmal charakterisiert. Das war kurz nachdem er zum Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland aufgestiegen war. Die Rede ist von Nikolaus Schneider, geboren 1947 als Sohn eines Hochofenarbeiters.
Schon früh wurde er in Folge des Strukturwandels im Ruhrgebiet mit sozialen Missständen konfrontiert, die ihn ein Leben lang prägten. Ein bodenständiger Theologe, den die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" einst einen "in der Wolle gefärbten Linksprotestanten" nannte. Schneider studierte Theologie in Wuppertal, Göttingen und Münster und trat 1977 seine erste Pfarrstelle in Duisburg-Rheinhausen an, wo er sich für die Krupp-Arbeiter und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze einsetzte. Es folgten Stationen als Superintendent im Kirchenkreis Moers. Von 2003 bis 2013 war er Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, und 2010 wurde er nach dem Rücktritt von Margot Käßmann EKD-Ratsvorsitzender.
Dieses Amt gab er vorzeitig im November 2014 wegen der schweren Erkrankung seiner Frau auf. Mit ihren unterschiedlichen Ansichten beteiligten sich die beiden an der Sterbehilfedebatte in Deutschland. Die jüngste ihrer drei Töchter, Maike Schneider, starb 2005 im Alter von 25 Jahren an Leukämie.
Nikolaus Schneider: Als Pfarrer haben wir an der Seite der Menschen zu stehen.
Sprecher: Heimatliche Aspekte, der Geruch des Rheins und die prägende Rolle des Vaters.
Birgit Wentzien: Herr Schneider, was ist "Zuhause" für Sie?
Schneider: Das muss ich doppelt beantworten. Ich bin zu Hause, wo ich mit meiner Familie bin, wo ich mich wohlfühle, und das ist im Augenblick hier in Berlin. Hier ist meine Frau, hier ist meine älteste Tochter mit drei Enkelkindern, und seitdem ich nicht mehr im Amt bin, kümmere ich mich auch sehr um die Enkel.
Wentzien: Und Duisburg ist weit weg.
Schneider: Und Duisburg ist weit weg. Aber ich muss schon sagen, wenn ich ins Ruhrgebiet komme und den Rhein rieche oder so manches rieche, was von der alten Industrie noch in der Luft ist – das ist ja nicht mehr allzu viel –, dann fühle ich mich durchaus zu Hause.
"Mein Vater war wenig begeistert"
Wentzien: Heimat könnte, würde ich sagen, auch Ihr Glaube sein, denn der zieht sich ja auch durch Ihr ganzes Leben, und zwar, wichtig, wenn man den Start betrachtet, so ganz anders als Ihr Vater das erwartet hat. Der Sohn eines atheistischen Stahlkochers und Hochofenmeisters aus Duisburg lässt sich bei der Konfirmation taufen – da waren Sie zwölf, 13, 14 Jahre alt ...
Schneider: Ja, so 14, 15 ...
Wentzien: ... genau, wird geprägt vom Christlichen Verein Junger Menschen, CVJM, studiert Theologie und heiratet 1970 auch noch eine Göttinger Theologiestudentin. Was hat Ihr Vater gesagt?
Schneider: Mein Vater war wenig begeistert.
Wentzien: Von allen Stationen?
Schneider: Von allen Stationen. Er hat mich mit den Worten zum Studium verabredet [Anmerkung der Redaktion: gemeint ist verabschiedet], es sei nun schade, dass ich nun auch das Volk betrügen würde. Und das ist so diese alte Feuerbach-These, die hatte er inhaliert und hat also da durchaus ein bisschen traurig auf mich geschaut. Aber er war ein sehr liebevoller Vater und auch einer, der mich akzeptiert hat, und hat dann auch weiter mich im Studium unterstützt.
Er hat irgendwann während dieser Studienzeit noch, da haben wir sehr viel miteinander geredet, und wir waren uns in vielen Dingen, auch in politischen Fragen – das war ja so die Hochzeit der Studentenbewegung –, waren wir uns sehr einig. Und dann hat mein Vater irgendwie die Kurve gekriegt, indem er sagte: Unsere Leute saßen im KZ, der Niemöller saß im KZ, das ist eine Basis. Also, er war da immer sehr kurz und knapp, aber das war für ihn dann der Zugang zu dem, was ich dann machte.
Wentzien: Und das Wort von dem Volksbetrug, haben Sie darüber noch mal gesprochen?
Schneider: Darüber haben wir gar nicht mehr gesprochen, weil das hat mich dann herausgefordert. Ich habe mich – wir müssen ja eine Philosophieprüfung machen – mein Spezialgebiet war Feuerbach, damit habe ich mich intensiv auseinandergesetzt, und war ihm dann in Gesprächen, das ließ ich dann immer so durchblicken, doch sehr gewachsen, und dann hat er auf die Auseinandersetzung verzichtet.
Mein Vater war so im formalen Sinne kein sehr hochgebildeter Mann. Der hatte nicht mal einen Hauptschulabschluss, weil die Familie einfach nach dem Ersten Weltkrieg aus Frankreich kam, aus Lothringen, hier ins Ruhrgebiet. Die hatten deutsch optiert und mussten dann weg. Der hatte also gar keinen formalen Schulabschluss, sprach damals auch Französisch, und hat dann über Hilfsarbeitertätigkeiten einen Weg gefunden.
Und nach dem Krieg wurde er dann von seiner Firma sehr gefördert, sodass er dann Erwachsenenbildung machte und immerhin als Obermeister, also kurz unterm Ingenieur aufhörte. Also ein durchaus intelligenter, sehr strebsamer, arbeitsamer Mensch, aber formale Bildung konnte er nicht viel. Er hat schon eine Menge gelesen, aber formale Bildung hatte er nicht so wie ich.
"Ich habe meinen Vater immer sehr respektiert"
Wentzien: Haben Sie ihn so ein bisschen missioniert auf der Strecke?
Schneider: Missioniert kann man nicht sagen, sondern ich habe ihn immer sehr respektiert, und das hat er auch sehr zu schätzen gewusst. Ich habe ihn sehr respektiert, und das hat ihn, glaube ich, geöffnet für meinen Weg. Er ist dann übrigens schon – er ist einmal in die Kirche gekommen, und zwar, als ich in meine Pfarrstelle in Rheinhausen eingeführt wurde. Da war er dabei und fand das dann aber auch ganz in Ordnung, was ich da gesagt habe.
Wentzien: Sie haben es erwähnt, Ihre Frau Anne wird Lehrerin für Religion und Mathematik und Sie werden Pfarrer in Rheinhausen. Und als Kohle-, Stahl- und Ölkrisen dort dafür sorgen, dass die Hälfte der Gemeindemitglieder von Nikolaus Schneider arbeitslos werden, da sind Sie an der Seite der Menschen, und Sie gelten ab sofort als linker Arbeiterpriester. Sie haben jetzt gar nicht gezuckt, als ich sagte "linker Arbeiterpriester".
Schneider: Ja, das wird häufiger über mich gesagt.
"Die Bibel ist kein Buch, das man ins Museum stellt"
Wentzien: Sind Sie das?
Schneider: Ich würde das für eine sehr verkürzte Form meiner Vorstellungen halten.
Wentzien: Wie das Journalisten so machen ...
Schneider: Ganz genau. Ich bin schon jemand, der fest in seinem Glauben dort steht. Und mein Glaube sagt mir, dass wir als Kirchen an der Seite der Benachteiligten und der Armen zu stehen haben und uns für Gerechtigkeit und auch soziale Gerechtigkeit einzusetzen haben.
Wenn man so was öffentlich äußert und das konkret macht, dann gilt man sehr schnell als links. Und ich muss sagen, dass ich, was persönliche Kontakte angeht und verlässliche Freundschaften, da gucke ich nicht auf die Farbe, sondern das geht bei mir quer durch. Und es gibt Menschen, etwa auch aus der jetzigen Regierung, auch aus der Bundesregierung, denen ich sehr freundschaftlich verbunden bin und die nicht von der SPD-Seite sind, sondern von der CDU-Seite.
Wenn man so was öffentlich äußert und das konkret macht, dann gilt man sehr schnell als links. Und ich muss sagen, dass ich, was persönliche Kontakte angeht und verlässliche Freundschaften, da gucke ich nicht auf die Farbe, sondern das geht bei mir quer durch. Und es gibt Menschen, etwa auch aus der jetzigen Regierung, auch aus der Bundesregierung, denen ich sehr freundschaftlich verbunden bin und die nicht von der SPD-Seite sind, sondern von der CDU-Seite.
Ich habe mein Amt ernst genommen. Als Pfarrer haben wir an der Seite der Menschen zu stehen und sie in ihren Ängsten zu begleiten. Also, die Evangelien, die Bibel selbst ist ja kein Buch, das man ins Museum stellt und sagt "schöne alte Geschichten", sondern entscheidend ist doch, dass der Geist dieses Buches heute wirkt und heute lebendig ist. Und deshalb habe ich aus meinem Glauben heraus mich engagiert. Das war jetzt kein parteipolitisches Programm oder was auch immer, sondern da habe ich auch nicht nach Parteipolitik geguckt, und siehe da, es gab immer Koalitionen über die Parteigrenzen hinweg.
"Da bin ich durch und durch Preuße"
Sprecher: Deutschlandfunk – das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Nikolaus Schneider.
Schneider: Und da, muss ich sagen, bin ich durch und durch Preuße. Wenn ich mich in ein solches Amt wählen lasse, dann stehe ich auch für die Konsequenzen, die mit dieser Wahl verbunden sind, ein.
Sprecher: Überraschend an die Spitze der evangelischen Kirche Deutschlands und die Politik des offenen Pfarrhauses.
Wentzien: Das war jetzt die Phase des Arbeitsbischofs in Rheinhausen und Umgebung.
Schneider: Da war ich Pfarrer.
"Ich hatte keine Wahl"
Wentzien: Und jetzt kommt, holterdipolter, in Ihrem Leben ein Amt um die Ecke. Ihre Frau Anne Schneider hat damals gesagt, als dieses höchste Amt der evangelischen Kirche um die Ecke kam: "Die Kirche braucht Zirkuspferde und Karrengäule. Wenn Margot Käßmann nach außen strahlt und Nikolaus nach innen zieht, ist das prima."
Das war im Jahr 2010 nach dem Rücktritt von Margot Käßmann. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelte damals gegen Käßmann wegen Trunkenheit am Steuer.
Wir kommen gleich auf den Karrengaul, ich zitiere Ihre Frau. Wir bleiben noch mal ganz kurz bei diesem Moment. Hatten Sie damals überhaupt eine Alternative, also hatten Sie die Wahl, oder war das so, Margot geht, ich komme?
Schneider: Das war ein gewisser Automatismus. Ich hatte keine Wahl, ich war ihr Stellvertreter, und ich war auch zunächst überhaupt nicht begeistert davon, dass ich nun Ratsvorsitzender wurde. Als Stellvertreter ist man im Amt. Margot Käßmann ist, glaube ich, an einem Dienstag zurückgetreten, und am Freitag war Sitzung des Rates, und die habe ich schon geleitet.
Also, da gab es gar kein großes Überlegen oder Abwägen. Und das ist ja auch die Funktion des Stellvertreters, dass er dann zur Verfügung steht. Und da, muss ich sagen, bin ich durch und durch Preuße. Wenn ich mich in ein solches Amt wählen lasse, dann stehe ich auch für die Konsequenzen, die mit dieser Wahl verbunden sind, ein.
"Verhältnisse so akzeptieren, wie sie sind"
Wentzien: Nummer eins und Nummer zwei. Jetzt – ich beziehe mich immer auf das Wort Ihrer Frau – wurde aus dem Karrengaul Nikolaus Schneider dann ein Zirkuspferd?
Schneider: Nein. Sagen wir mal, ich musste dann schon ein bisschen flotter werden ...
Wentzien: Wie macht man so was?
Schneider: Gute Frage. Indem man sich einfach Mühe gibt, also indem man auch die Verhältnisse so akzeptiert, wie sie sind. Ich hatte nun plötzlich für die Kirche zu sprechen, ich war plötzlich von den Medien sehr gefragt, es kamen Interviewanfragen ohne Ende. Ich stand da plötzlich in der Öffentlichkeit, und dann war völlig klar, dem habe ich mich zu stellen. Und dann habe ich mir Mühe gegeben, dem auch gerecht zu werden, soweit das ein Karrengaul denn kann.
"Meine Frau und ich haben immer ein offenes Haus gehabt"
Wentzien: Sie sind beide, Anne und Nikolaus Schneider, seither, aber ich glaube, auch vorher schon, ein exemplarisches evangelisches Pfarrersehepaar gewesen, öffentlich streitbar seit mehr als fünf Jahrzehnten inzwischen. Noch mal die Frage nach der Alternative. Hat man in so einer Position, der einen und dann der anderen an der Spitze der evangelischen Kirche eine Alternative, oder muss man das auch so öffentlich praktizieren? Das ist ja schon für das eigene private Leben eine Umstellung.
Schneider: Na, die Alternative hat man schon. Da muss man sich schon entscheiden, wie man es machen will. Und meine Frau und ich, wir haben immer ein offenes Haus gehabt. Diese klassische Tradition des evangelischen Pfarrhauses, die haben wir immer gelebt. Und dazu gehört eine gewisse Öffentlichkeit.
Zu mir konnten immer Leute kommen, Frauen und Kinder haben auch die Brüder von der Landstraße versorgt, aber in unser Haus habe ich auch immer eingeladen, Politik, Wirtschaft – und diese Form des öffentlichen Hauses mit einem Diskurs, der den privaten Raum kennt, aber der eine öffentliche Wirkung hat, dieses Modell haben wir immer vertreten, und das haben wir dann auch übertragen auf den Ratsvorsitz. Das kann man natürlich ganz anders machen, aber so haben wir es gemacht. Und von daher haben wir versucht, eine Linie zu halten. Ich unterscheide zwischen privat und intim und nicht zwischen privat und öffentlich.
Also, die Art und Weise, wie wir dann gemeinsam auch aufgetreten sind und Stellung genommen haben, war ein Stückchen auch, wenn Sie so wollen, das evangelische Pfarrhaus im Amt des Ratsvorsitzenden. Das geht durchaus. Aber wir haben uns schon darum bemüht, die Grenze zum Intimen zu wahren, denn das geht die Öffentlichkeit nichts an.Man kann da auch ein anderes Modell fahren und kann durchaus sagen, das Private halten wir auch völlig raus, es gilt nur das Amt. Da gibt es unterschiedliche Modelle, und ich denke, es liegt an den Temperamenten, und es liegt auch an den Konstellationen.
Ich hatte das Glück, eine Frau zu finden oder von einer Frau gefunden zu werden oder mit einer Frau zusammengebracht zu werden durch eine noch höhere Kraft, die das dann ermöglicht hat. Und dann, glaube ich, wäre es blöd gewesen, das nicht zu tun, denn meine Frau hat immer hohen Anteil genommen an dem, was ich getan habe, und sie war immer meine wichtigste Gesprächspartnerin auch in inhaltlichen Fragen. Gott sei Dank hat sie eben auch Theologie studiert. Und die Mathematik ist auch nicht schädlich fürs logische Denken. Das war eine gute Ergänzung oder ist eine gute Ergänzung. Es ist ja bis heute so.
Die Bibel ist kein Kochbuch, sondern die Bibel gibt Orientierung, wie ein Kompass Orientierung gibt, und nicht wie ein Navi.
Krankheit und Tod in der Familie sowie unterschiedliche Vorstellungen über die letzten Dinge des Lebens
Wentzien: Sie gestatten eine – ich lerne mit Ihnen, Herr Schneider – weitere private, vielleicht auch intime Frage. Drei Töchter werden geboren, alle drei studieren Theologie. Ihre Tochter Kathrin ist heute Richterin, ihre Tochter Annika ist Sozialpädagogin, und Ihre Tochter Maike ist mit 22 Jahren an Leukämie gestorben. Sie haben gemeinsam mit Ihrer Frau ein Buch mit Briefen an und von Ihrer Tochter veröffentlicht mit dem Titel "Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist".
Ihre Frau hat damals gesagt, "ich hatte eine Auszeit von meiner Gottesbeziehung genommen zu dieser Zeit". Sie haben gesagt, "das hat uns unterschieden. Ich kämpfte und betete länger." Können Sie mir das erklären?
Schneider: Ja. Wir haben natürlich darum gebetet, dass es für Maike eine Rettung gab. Und wir haben beide ein Gottesbild, das davon ausgeht, dass Gott nicht der Marionettenspieler ist, der uns an den Strippen zieht, aber dass er auf eine Weise, die wir nicht kennen und auch nicht verstehen können, aber dass er durchaus ein gegenwärtiger, ein präsenter Gott ist, der auch Einfluss nehmen kann.
Ich habe immer gesagt, Gottes Segen und die Kunst der Ärzte, das muss zusammenkommen.
Ich habe immer gesagt, Gottes Segen und die Kunst der Ärzte, das muss zusammenkommen.
Meine Frau hatte irgendwann den Eindruck, bei all den Gebeten, er hört nicht, oder er will das anders. Und dann hat sie gesagt, dann will ich auch nicht mehr beten. Bei mir war das so, dass ich sagte, wie er hört und ob er hört und was er tut, weiß ich nicht, kann ich auch nicht wissen, und deshalb bleibe ich da hartnäckig und nervig. Und ich habe das auch nicht vom Ende her gedacht.
Meine Frau hat irgendwann, sehr viel früher als ich, für sich entschieden, dass sie das Sterben und den Tod unserer Tochter akzeptiert, sodass sie in der letzten Phase sehr viel intensiver Sterbebegleitung bei meiner Tochter gemacht hat als ich. Ich habe das erst ganz kurz vor Maikes Sterben richtig akzeptiert. Davor habe ich einfach immer noch gekämpft und gehofft. Und das heißt, meine Frau denkt dann sehr viel stärker vom Ende her und hat von daher das Beten eingestellt. Ich bin jemand, der sagt, jeder Tag hat seine Mühe, und wir konzentrieren uns jetzt ganz auf den heutigen Tag, und da geben wir alles. Und aus diesem Grunde habe ich dann auch sehr viel länger gekämpft und mich bemüht.
Wentzien: Hinter Ihnen und Ihrer Frau liegen beileibe schwere, mehrere, viele Monate. Sie beide sagen, Glaube und Theologie sind öffentlich, dabei bleiben Sie lebenslang. Auch Ihre Liebe ist öffentlich. Seit Ihrem Rücktritt vom Amt im Juli 2014, als Sie Ihren vorzeitigen Amtsverzicht mit der Begründung erklärten, Ihre Frau sei an Brustkrebs erkrankt und Sie wollten Sie intensiv begleiten. Wie geht es Ihrer Frau?
Schneider: Darf ich noch eines kurz sagen: Ich habe zwei Gründe gehabt. Grund eins: Ich will für meine Frau da sein. Grund zwei: Das Amt braucht den vollen Einsatz. Ich hätte dem Amt auch nicht mehr gerecht werden können.
Heute geht es meiner Frau erstaunlich gut. Wir hatten das nicht erwartet, dass es so auskommt, denn die Prognose war am Anfang sehr schlecht. Inflammatorischer Brustkrebs, ich habe am Anfang nicht gegoogelt, was das bedeutet, ich habe das später gemacht, und da kann einem ganz anders werden, wenn man das alles liest. Außerdem war der Krebs schon ins Lymphsystem eingedrungen, also da bestand größte Gefahr, und die Ärzte guckten auch alle relativ skeptisch.
Das hat sich dann geändert, weil die übrigen Organe doch alle noch frei waren, und die Therapie scheint wirklich gut geholfen zu haben. Jedenfalls sagen uns die Mediziner heute, dass meine Frau mit einer großen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren Ruhe haben wird vor dem Krebs. So.
"Ich bin auf Wolke sieben"
Wentzien: Wie geht es Ihnen?
Schneider: Das ist eine Art Hochgefühl, ich bin auf Wolke sieben. Das ist eine unglaublich schöne Erfahrung, dass mir noch mal einige gemeinsame Jahre geschenkt sind, denn diese Vorstellung, jetzt allein leben zu müssen, wäre für mich doch äußerst schrecklich gewesen.
Wentzien: Ihre Frau Anne spricht weiterhin von der Freiheit zum Sterben als Option. Sie sprechen von der Freiheit zum Leben, immer. Und Sie sagen zugleich, Herr Schneider, Sie respektieren den Wunsch Ihrer Frau, Sie würden aus Liebe zu ihr Wege gehen, die Sie selbst nicht für richtig halten. Das ist nach fünf Jahrzehnten Ehe Ihre Privatangelegenheit, aber eine, die Sie auf relativ bemerkenswerte und sehr wohl überall registrierte Art und Weise öffentlich bewusst machen.
Das ist ja, glaube ich, ein Schritt, über den man sich auch miteinander verständigen muss, und ein Schritt, der besagt, das Schneidersche Lebensthema ist jetzt das Sterben. Wie können Sie damit auf die Dauer so umgehen?
Schneider: Das Schneidersche Lebensthema war in der Phase, als wir diese öffentlichen Gespräche geführt haben, in der Tat das Sterben, die Frage, wie gehen wir denn damit um. Das hat sich aber jetzt Gott sei Dank geändert. Das Weiterleben steht jetzt im Vordergrund.
Wenn es dann mal konkret aufs Sterben zugeht, wird das sicher wieder hochkommen, dass wir da unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich persönlich hoffe allerdings sehr, dass Sterbehilfe und Sterbebegleitung auch bei meiner Frau die Begleitung beim Sterben sein kann, dass sie nicht allein stirbt und dass sie ohne Schmerzen stirbt. Und das ist ja auch das Wesentliche, sodass sie dann auf dem Weg, dem anderen Weg, den sie für möglich hält, nämlich auch die Verkürzung ihres Lebens aktiv zu betreiben, dass sie darauf verzichtet.
Das diskutieren wir jetzt nicht jeden Tag. Wir haben uns auch sehr überlegt, ob wir das öffentlich diskutieren. Wir haben aber dann schon gedacht, dass es nicht falsch ist, das öffentlich zu diskutieren, weil die unterschiedlichen Aspekte, die da zum Ausdruck gebracht wurden, erst einmal auf der Basis großer Gemeinsamkeiten war. Und ich denke, eine bestimmte Gesprächskultur bei solchen elementaren Fragen, eine solche Gesprächskultur ist absolut notwendig, damit man zu guten Ergebnissen kommt und auch im Respekt voreinander und miteinander solche Gespräche führt.
Und es war mir wichtig, auch deutlich zu machen, dass wir uns nicht gegenseitig verketzern. Aus theologischen Gründen kann man durchaus zu unterschiedlichen Positionen gelangen, und hier gilt es, einfach auch Respekt voreinander zu bewahren. Auch darum ging es mir. Es ist nicht so einfach, dass man die Bibel aufschlägt, und dann weiß man, aha, so geht es. Die Bibel ist kein Kochbuch, sondern die Bibel gibt Orientierung, wie ein Kompass Orientierung gibt, und nicht wie ein Navi.
"Liebe geht für mich immer vor Dogmatik"
Wentzien: Wir haben inzwischen seither nach langer Debatte einen bemerkenswerten Beschluss des Bundestages. Wir haben eine weitergehende Debatte an der Stelle. Aber, Herr Schneider, wenn ich Sie jetzt betrachte, den Privatmenschen und den Kirchenmenschen und den Ehemenschen – Sie waren immer an der Nahtstelle. Sie haben gesagt, Sie würden die Position Ihrer Frau aus Liebe zu ihr nachvollziehen und sie begleiten. Kirche, Ihre Kirche, andere Kirchen haben anderes gesagt, und ganz plakativ und viel zu kurz, aber, wie das Journalisten nun mal so machen, der Vorwurf lautete, da geht jemand nach vorne und hat überhaupt nicht die Rückendeckung, was maßt der sich eigentlich an. Hat Sie das getroffen?
Schneider: Nein, das hat mich überhaupt nicht getroffen, das konnte ich ja auch ganz gut korrigieren und auch wieder zurückweisen.
Ich denke, hier muss man unterscheiden, dass ich erst mal in erster Linie Verantwortung für mich und meine Kirche übernehme. Und da habe ich eine Position vertreten, wie sie auch von meiner Kirche vertreten wird, und wie sie sich Gott sei Dank jetzt auch in der Beschlussfassung des Bundestages niedergeschlagen hat. Das war also sehr erfolgreich, und ich denke, hierbei muss man – dabei kann man mich behaften. Wenn ich selbst für mich anderes in Anspruch nehmen würde, als ich jetzt öffentlich geredet hätte, wäre ich unglaubwürdig, das geht nicht. Nein, für mich gilt das.
Ich denke, hier muss man unterscheiden, dass ich erst mal in erster Linie Verantwortung für mich und meine Kirche übernehme. Und da habe ich eine Position vertreten, wie sie auch von meiner Kirche vertreten wird, und wie sie sich Gott sei Dank jetzt auch in der Beschlussfassung des Bundestages niedergeschlagen hat. Das war also sehr erfolgreich, und ich denke, hierbei muss man – dabei kann man mich behaften. Wenn ich selbst für mich anderes in Anspruch nehmen würde, als ich jetzt öffentlich geredet hätte, wäre ich unglaubwürdig, das geht nicht. Nein, für mich gilt das.
Ein anderer Mensch ist aber ein anderer Mensch, und das haben wir zu respektieren. Und wir haben große Gemeinsamkeiten. Das ist das eine. Das andere ist aber, Liebe geht für mich immer vor Dogmatik, und ich gehe mit meiner Frau auf die goldene Hochzeit zu, und ich werde sie natürlich nicht allein lassen, wenn sie da ihren Weg geht und einen anderen Weg geht, als ich für richtig halte. Aber ich muss noch was ergänzen: Meine Frau weiß auch genau, was sie von mir erwarten kann und was sie mir zumuten kann.
Und meine Frau würde nie Dinge von mir erwarten, die ich dann wirklich nicht kann. Dass ich etwa sie aktiv töte, das würde ich nie machen, und das wird sie auch nie von mir erwarten. Also, hier muss man sagen, diese Begleitung ist nicht nur einseitig, dass ich ein Stückchen über meinen Schatten springe. Die ist wirklich auch hier wechselseitig. Auch meine Frau springt über ihren Schatten. Und insofern konnte ich diese Art von Kritik immer gut ertragen und zurückweisen, weil ich fand sie unangemessen.
"Diese Debatte hat uns gut getan"
Wentzien: Wenn Sie Ihre eigene private, intime Lebenssituation mal zur Seite stellen – wenn man das kann – und gucken, was im Bundestag passiert ist, was in diesem Land sich bei diesem Thema bewegt hat – sind wir beim Sprechen, beim Nachdenken, beim Artikulieren über die wesentlichen, letzten Dinge des Lebens, ein bisschen weiter, als wir es noch vor Jahren waren?
Schneider: Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, dass uns diese Debatte gut getan hat. Es gab Auseinandersetzungen in den Zeitungen, nicht nur in den Feuilletons, auch in den politischen Teilen. Das hat die Kenntnis und sozusagen den Grundwasserspiegel in diesen wesentlichen ethischen Fragen erheblich angehoben. Es gab eine ganz breite Debatte in den elektronischen Medien und in den Printmedien. Das ist sehr gut.
Das Zweite: Auch die politische Auseinandersetzung fand ich ausgesprochen angemessen. Es wurde der Fraktionszwang aufgehoben, es gab Gruppenanträge, also parteiübergreifend. Und der Bundestag hat etwas gemacht, was es bis dahin noch nicht gab: Es gab eine Plenarsitzung, die diente der reinen Information, ohne irgendwelche Anträge, wo man sich erst mal in der Sache schlau machte.
Es gab Anhörungen in allen Fraktionen, wo auch unsere Fachleute, die Ethiker, aufgetreten sind und noch mal auch begründet haben, wo auch Juristen aufgetreten sind und begründet haben, wo Mediziner aufgetreten sind. Es war auf dem Kirchentag in Stuttgart ein ganz wesentliches Thema. Ich habe da auch mehrere Veranstaltungen bestritten, gemeinsam etwa mit dem Gesundheitsminister, mit Hermann Gröhe, und Herrn Borasio, einer der führenden Ärzte in der Palliativmedizin.
Das hat unserem Land richtig gut getan. Und etwas Zweites hat unserem Land auch richtig gut getan, nämlich dass wir nun bereit sind, für Palliativmedizin und für Hospize deutlich mehr Geld auszugeben als vorher. Das ist auch eine ganz praktische Konsequenz, dass wir also nicht nur groß reden, sondern dass wir uns das auch was kosten lassen und auch konkret was tun.
Wentzien: Das Gesetz, verabschiedet im Bundestag, sagt, geschäftsmäßige Sterbehilfe ist in Deutschland künftig verboten. "Geschäftsmäßig" meint das auf Wiederholung angelegte organisierte und gewinnorientierte Handeln von Vereinen und Einzelpersonen. Und sollte jemand sich dieser Regel widersetzen, drohen bis zu drei Jahre Haft. Also, um dieses Kapitel etwas abzuschließen, Herr Schneider, auch Sie saßen mental mit im Bundestag und haben da Ja gesagt.
Schneider: Ja.
Sprecher: Sie hören das Zeitzeugengespräch des Deutschlandfunks, heute mit dem früheren Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Nikolaus Schneider.
Schneider: Kirche muss festhalten an ihrem biblischen Zeugnis, und Kirche muss aus dem biblischen Zeugnis heraus begründen.
Sprecher: Hört auf die Bibel – die EKD und ihre Funktion in Politik und Gesellschaft.
Wentzien: Keine Partei ist Kirche, sagen Sie, Bischof Schneider, aber sie muss an den großen Debatten der Republik teilnehmen. Kirche sollte nicht nur der politische Kurs interessieren, aber andererseits dürfen wir uns nicht in den frommen Winkel zurückziehen, wo es überhaupt nicht mehr interessiert, was in der Welt passiert.
Jetzt haben wir angesprochen und an Ihr Wort erinnert, von Rheinhausen nämlich: Mein Amt nehme ich ernst. Wo ist die Grenze, Herr Schneider?
Jetzt haben wir angesprochen und an Ihr Wort erinnert, von Rheinhausen nämlich: Mein Amt nehme ich ernst. Wo ist die Grenze, Herr Schneider?
Es gibt nicht wenige, die werfen der evangelischen Kirche vorneweg vor, sie sei zeitgeistig und beliebig und würde immer nachgeben dem, was da in der Öffentlichkeit ist. Wo ist die Grenze, und wo gibt es quasi die Maximen und Wahrheiten, an denen die evangelische Kirche festhalten muss, und wo muss sie sich bewegen?
Schneider: Das Spezifische der evangelischen Kirche ist, dass sie im Wesentlichen auf die Bibel hört, und die Bibel der Tradition verortet. Das heißt, die Bibel geht auch vor Dogmatik und vor allen dogmatischen und auch ethischen Festlegungen, die wir getroffen haben, weil wir davon ausgehen, dass es in der Bibel eine Kraft gibt, die aus sich heraus wirkt, und die nicht nur Ergebnis unserer hermeneutischen Bemühungen ist, sondern eine Kraft, die aus sich heraus wirkt.
Deshalb kann es im Hören auf die Bibel und in der nüchternen Analyse der zeitlichen Umstände zu Veränderungen kommen. Das muss man ja zueinander bringen. Die Bibel wurde zu Zeiten verfasst, als wir völlig andere gesellschaftliche Verhältnisse hatten. Das kann man also nicht fundamentalistisch eins zu eins übersetzen, sondern es bedarf der hermeneutischen, also der interpretatorischen Bemühungen, um sich zu fragen, was damals so und so gesagt wurde, was würde das heute bedeuten, bis hin zu der Frage, ist das überhaupt noch anwendbar. Auch diese Frage muss man stellen, denn der Geist Gottes ist auch eine präsentischer Geist.
Der Geist Gottes ist der richtig verstandene Zeitgeist. Ich weiß, der Begriff Zeitgeist ist ja negativ konnotiert. Da sagt man immer, ja, ja, man passt sich den jeweiligen herrschenden Meinungen an. Das meine ich nicht. Das halte ich auch für Unsinn. Es mag so was im Einzelfall vorkommen, das will ich nicht bestreiten, aber als Grundlinie gegenüber der evangelischen Kirche ist dieser Vorwurf der schiere Unsinn.
Ich zitiere Dietrich Bonhoeffer, der das gesagt hat, dass der wahre Zeitgeist der Heilige Geist ist. Denn Gott ist gegenwärtig. Wenn wir das wirklich glauben, dann müssen wir auf der Höhe der Zeit unseren Glauben verantworten. Und so kommen wir zu Aussagen. Wo ist die Grenze?
Wentzien: Also woran muss Kirche festhalten?
Schneider: Kirche muss festhalten an ihrem biblischen Zeugnis, und Kirche muss aus dem biblischen Zeugnis heraus begründen. Daraus ergibt sich die Grenze. Das ist eine Grenze. Zweitens: Kirche darf nicht einfach zur Partei werden. Kirche darf nicht der Resonanzboden von CDU, SPD oder wem auch immer werden, sondern Kirche ist eine eigenständige Stimme, und die muss sie bleiben. Wenn es dann Überschneidungen gibt, okay, aber wir sind nicht Partei. Die dritte Grenze ist, Kirche darf nicht den Anspruch erheben, unmittelbar Politik zu machen. Wir haben kein unmittelbares politisches Mandat, wir sind nicht gewählt von den Menschen.
Das sind andere, und das haben wir zu respektieren. Das ist eine gute Ordnung in unserem Land, und das ist die nächste Grenze. Wir sollen, da gibt es eine schöne klassische Formulierung, die heißt, wir sollen nicht Politik machen, wir sollen Politik möglich machen, Hintergrundgespräche führen, Beratung anbieten, Argumentationslinien anbieten, aber der Politik überlassen und vor allen Dingen auch respektieren und das selber so wollen, dass, wenn die Politik auf diesem Hintergrund zu ihren eigenen Entscheidungen kommt, und die haben wir dann als Kirche auch zu respektieren, auch, wenn sie uns nicht passen.
"Gottes Gegenwart in der Welt ist eine einzige Irritation"
Wentzien: Der Jurist Udo de Fabio hat jüngst auf der Synode in Bremen den Kirchen ins Stammbuch geschrieben, sie sollten irritieren im politischen Prozess. Tun sie das?
Schneider: Manchmal irritieren wir, durchaus.
Wentzien: Die Politik oder sich selbst?
Schneider: Es kommt schon beides vor, auch die Politik. Ich halte das – aber manchmal schon auch uns selbst, wenn wir nun, sagen wir mal, anfangen müssen, unsere Traditionen neu zu formulieren, irritiert das auch nach innen, das ist völlig klar. Aber auch Politik haben wir zu irritieren, weil es gibt Selbstverständlichkeiten und sogenannte Eigengesetzlichkeiten im politischen Betrieb, die im Grunde mehr Denkzwänge als Sachzwänge sind. Und gegenüber Denkzwängen Irritation zu äußern oder Irritierendes zu äußern, tut nur gut, denn Zwang ist niemals ein guter Ratgeber.
Und insofern war ich Udo de Fabio richtig dankbar, dass er das gesagt hat. Ich halte das in der Tat für eine Aufgabe. Gottes Gegenwart in der Welt ist, wenn Sie so wollen, eine einzige Irritation. Die großen Gestalten unseres Glaubens waren irritierend – gucken Sie sich die großen Propheten an. Gucken Sie Jesus selber an, seinen Lebensweg bis hin zum Kreuz ist eine einzige Irritation.
Die großen Gestalten unseres Glaubens danach, von Augustin bis Franz von Assisi über Luther bis hin zu Dietrich Bonhoeffer, haben irritiert. Und das zeigt, dass diese Irritation, also das konsequente Eintreten für die Menschen und für die Rechte eines jeden Menschen, für die Achtung der Würde eines jeden Menschen, auch der kleinen und der benachteiligten, und vor allen Dingen, für deren Lebensrechte einzutreten, ist immer eine Irritation.
Wentzien: Lassen Sie uns über die Flüchtlinge im Land sprechen, Herr Schneider, und darüber, dass Sie zum Beispiel mit vielen anderen auch gesagt haben, es kommen Probleme und Konflikte auf uns zu. Ermutigung und Zuversicht sind da, und lassen Sie uns bitte über viele Menschen sprechen in diesem Land, die den Flüchtlingen helfen, die aber beispielsweise – ich erinnere mich an eine Demonstration in Neugraben-Fischbek, Schilder vor sich her tragen, auf denen steht, "Ja zur Hilfe" und "Nein zur Politik".
Das irritiert mich etwas, denn das sind ja Menschen, die wollen helfen, die wollen aber zugleich ausdrücken, dass das, was praktisch-politisch hier im Land passiert, überhaupt nicht gut ist. Wo sind Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie diese Schilder sehen. Und wenn Sie sagen, wir dürfen nicht Partei sein als Kirche, wir müssen helfen in aller Barmherzigkeit, und wir müssen irritieren. Wo steht Kirche bei diesem Thema?
Schneider: Hier muss man jetzt erst mal, denke ich, erst mal ermutigen, bei der Haltung zu bleiben, Flüchtlinge willkommen, das gehört, ist Teil des Genoms des jüdisch-christlichen Glaubens.
Es gibt keine Forderung, die häufiger in der Bibel formuliert ist, wie den Fremdling aufzunehmen und für den Flüchtling da zu sein. Es gibt keine Forderung, die häufiger thematisiert ist. Weil es einfach so absolut nötig ist und es immer Flüchtlingsströme und Krieg und Gewalt und Flucht davor gab. Also, das ist Kern unseres Glaubens, der tätigen Seite unseres Glaubens. Und Menschen zu ermutigen, dabei, bei dieser Grundhaltung zu bleiben, ist richtig.
Die andere Seite ist, nüchtern hinzugucken, was kann man schaffen, und wie kann man es schaffen. Dann ist die Frage, Nein zur Politik – da muss man mit den Leuten reden, ist das gerecht, was ihr da sagt gegenüber der Politik. Ist das gerecht? Und da würde ich diskutieren und sagen, nein, es ist nicht gerecht.
Es gibt durchaus ein Politikversagen, also die Verhältnisse am LaGeSo in Berlin sind himmelschreiend, und das ist ein klares Verwaltungsversagen und am Ende auch ein Politikversagen. Und da gibt es gar kein Vertun.
Wentzien: Das ist eine Einrichtung in Berlin, die jetzt gerade einen Personalwechsel erlebt und die unterkomplex in jeder Art und Weise Flüchtlingen dort eben nicht hilft, sondern da gibt es Bürokratiewirren und alles andere, bloß keinen Überblick – so kann man es vielleicht zusammenfassen.
Schneider: Das haben Sie jetzt alles sehr vornehm ausgedrückt.
Wentzien: Sagen Sie es mal anders.
Schneider: Ja, man muss es drastisch sagen: Leute übernachten auf der Straße bei Regen und Kälte und warten Tage darauf, dass sie überhaupt registriert werden können, kriegen Nummern, die ihnen dann sagen, wann sie dran sind, aber dann sind sie nicht dran und sitzen die nächste Nacht. Das ist unglaublich. Und es sind die Ehrenamtlichen, die sich um die Leute kümmern, überhaupt dafür sorgen, dass Frieden in der Stadt bleibt. Es ist unglaublich, was dieses Amt sich erlaubt.
"Die pauschale Ablehnung der Politik, die finde ich ungerecht"
Wentzien: Herr Schneider, dann würden Sie doch an dieser Stelle, auf diesen Ort bezogen, sagen: Ja zur Hilfe, nein zur Politik.
Schneider: Es gibt Politikversagen, ja, aber zu pauschal "Nein zur Politik", das geht nicht, weil es gibt auch großartigen Einsatz in der Politik. Wenn Sie sich angucken, was die Bayern leisten in der Aufnahme von Tausenden von Flüchtlingen, und wie gut die das organisieren.
Da gab es am Anfang auch Probleme, dass das anlaufen muss, aber das machen die einfach großartig. Oder wie das in NRW läuft, das ist großartig. Und man kann das auch in anderen Bundesländern sagen, wo auch die Politik und die Verwaltung Großartiges leisten. Von daher, diese pauschale Ablehnung der Politik, die finde ich ungerecht. Sondern da, wo die Politik etwas leistet, muss man es auch sagen. Da, wo sie versagt, muss man es auch sagen, aber dann bitte konkret und nicht pauschal.
Wentzien: Neugraben-Fischbek und anderswo – ich meine, es ist, mit vielen anderen Beobachtern, eine große, fast die größte spontane gesellschaftliche Bewegung seit Jahrzehnten, die auch Gesellschaft ja politisiert auf eine Art und Weise, wie es bislang noch nicht der Fall war, weil beispielsweise jetzt, wir haben große Parteitage in diesem Monat, CDU, CSU, SPD, auch Unterschiede mit einem Mal wieder zu sehen sind.
Herr Schneider, aber diese Menschen, die dort helfen, die Sie auch gerade benannt haben, die haben vorneweg nichts mit Religion, nichts mit Ideologie und nichts mit Politik am Hut. Das heißt, was müsste zum Beispiel aus Kirche heraus jetzt passieren, damit dort auch so etwas wie ihre//Ihre Beteiligung zu sehen und zu spüren ist?
Schneider: Ich möchte Ihrer These doch etwas widersprechen. Sie haben gesagt, die Menschen, die dort helfen, haben mit Religion nichts zu tun. Es gibt unglaublich viele Menschen, die aus ihrem Glauben heraus helfen. Das größte Potenzial für ehrenamtliche Hilfe in unserem Land kommt nach wie vor aus den Kirchen. Und es gibt soziologische Untersuchungen, die deutlich machen, dass Menschen, die auch in ihrem Glauben gebunden sind, überdurchschnittlich bereit sind, sich auch ehrenamtlich zu engagieren.
Es gibt Gemeinden, die sich unglaublich einsetzen, die ihre Gemeindehäuser öffnen und auch Flüchtlingen anbieten, dass sie dort Aufnahme finden können. Also, da wird Großartiges geleistet.
Von daher, die Ausgangsthese stimmt nicht, sondern unsere Gemeinden sind wesentlich engagiert. Und es gibt was Zweites, was ich richtig finde. Wir gehen hin, um Menschen zu helfen. Und da sage ich nicht als Erstes, guten Tag, ich bin evangelischer Christ, das und das steht in meiner Bibel, und deshalb helfe ich Ihnen jetzt. Sondern ich gehe hin und schaue die Menschen an und frage, wie heißen Sie, wie geht es Ihnen, und wo kommen Sie her, und wie fühlen Sie sich jetzt, und was können wir tun? Das muss das Erste sein.
Wenn dann irgendwann mal diese Menschen mich fragen und sagen, hör mal, warum machst du das, dann gebe ich gern Antwort, warum ich das mache. Aber ich finde, das ist eine derart existenziell bedrängende Situation, dass wir damit nicht mit der Mission anfangen, sondern wirklich mit der grundlegenden Hilfe, aber dass wir auch, und das ist vielleicht doch eine gewisse Schwäche von uns, dass wir dann nicht verschweigen, aus welchen Gründen wir das tun.
"Wir kommen um eine kritische Überprüfung der Menschen nicht herum"
Wentzien: Was sagt Bischof Schneider, wenn er auf die Menschen schaut, die nicht nur als Verfolgte, sondern – noch nicht nachgewiesen, aber, das ist ja die Angst und die Furcht, als Verfolger hier ins Land kommen?
Sie haben sich immer wieder kräftig Richtung Islamismus sich geäußert. Sie haben beispielsweise, da möchte ich dann irritiert werden, mit Ihrer Aussage, wenn Sie mögen, auch gesagt, dass die muslimischen Verbände hier im Land, in Deutschland, bisweilen taktisch sich aufführen gegenüber dem, was säkulares Staatswesen hier ist. Wie bringen Sie das jetzt alles zusammen, wenn Sie die Furcht und die Angst und die Verunsicherung vieler Menschen hier im Land spüren, die sagen, wissen wir denn eigentlich, wer da bei uns ist, und wie stehen die Muslime in Deutschland und in Europa dazu?
Schneider: Das Erste, was man sagen muss, die Menschen, die hierhin flüchten, die flüchten ja genau vor diesen Kriegen, die flüchten vor den Islamisten und vor diesen brutalen Mördern des sogenannten Islamischen Staats, die flüchten davor. Das muss man grundsätzlich sagen, und das ist die weit überwiegende Zahl.
Und von daher, ja nicht in Panik geraten und nicht hektisch werden. Zweitens: nüchtern bleiben. Das sind ja durchaus intelligente Leute, die da beim Islamischen Staat sind, die da bei den Terroristen sind. Die werden versuchen, diese Fluchtbewegung zu nutzen, um Leute einzuschleusen. Und die haben ja schon jetzt Sympathisanten im Land, und die werden in die Lager gehen und werden sich bemühen, dort zu rekrutieren. Das muss man ganz nüchtern feststellen.
Aus diesem Grund kommen wir um eine kritische Überprüfung der Menschen nicht herum. Wir müssen schon genau nachgucken, wer kommt da zu uns, und müssen auch die Personalien feststellen. Das wird ein Riesenaufwand, und das wird eine Riesenanstrengung, aber daran kommen wir nicht vorbei. Und wenn wir das dann feststellen, dass es dort Islamisten gibt, dass es dort Menschen gibt, die dem Terror zuneigen und die den Terror unterstützen wollen, dann müssen wir da mit allen gebotenen Mitteln des Rechtsstaates einschreiten, das können wir im Ansatz nicht dulden.
Wir müssen auch deutlich machen, dass bestimmte Formen des Denkens in unserem Land nicht gehen. Also: Wir haben in vielen arabischen Ländern Antisemitismus sozusagen als eine normale Bildungsausstattung bei allen Menschen. Das wird in den Schulen gelehrt. Davon geprägt, kommen Menschen in unser Land. Hier haben wir eine Riesenaufgabe.
Wir müssen auch deutlich machen, dass bestimmte Formen des Denkens in unserem Land nicht gehen. Also: Wir haben in vielen arabischen Ländern Antisemitismus sozusagen als eine normale Bildungsausstattung bei allen Menschen. Das wird in den Schulen gelehrt. Davon geprägt, kommen Menschen in unser Land. Hier haben wir eine Riesenaufgabe.
"Wir brauchen die muslimischen Verbände"
Wentzien: Sie haben ja diese Erfahrungen auch am eigenen Leib gespürt, auf vielen Reisen, wo Sie diesen Eindruck gewinnen konnten.
Schneider: Oh ja. Als ich in diesen Ländern unterwegs war, da wurde ich häufig angesprochen: Deutschland gut, du gut – Warum? – Hitler gut. Das zieht einem geradezu den Boden unter den Füßen weg, dass der Antisemitismus und die Verfolgung und Ermordung der Juden sozusagen Markenzeichen für Deutschland sind, was in solchen Ländern dafür sorgt, dass wir eine hohe Reputation haben.
Es ist völlig verrückt. Wenn man das weiß, weiß man, welche Aufgabe man hat. Das ist ja Prägung, die Leute sind ja nicht in sich bösartig. Die sind so von Kindheit an geprägt worden. Da haben wir eine Riesenaufgabe, deutlich zu machen, dass das in unserem Lande nicht geht, und vor allen Dingen, dass es falsch ist und dass es eine Riesenungerechtigkeit ist. Das ist eine massive Bildungsarbeit, aber hier muss man auch massiv dagegenhalten.
Zu den Verbänden: Wir werden diese Aufgabe nicht ohne die muslimischen Verbände bewältigen können. Wir brauchen die Verbände, und ich kann nur sagen, ich habe im Umgang mit den Verbänden wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich würde den Verbänden, das will ich heute explizit hier sagen, nicht unterstellen, dass sie sich in einem taktischen Verhältnis zu unserem Grundgesetz und zu unserem Staat befinden, sondern das sind Leute, die diesen Staat so wollen, die diesen freiheitlichen Staat so wollen und die auch unser Grundgesetz bejahen, mit denen wir kooperieren können. Das kann man fast durchweg sagen, nach all den Gesprächen, die ich dort geführt habe.
Ich denke aber auch, dass die Verbände eine Aufgabe haben. Und diese Aufgabe ist, dass sie ja die Flüchtlinge, die Muslime am besten erreichen, und dass sie sich beteiligen an dieser Bildungsaufgabe, an dieser Sozialisationsaufgabe, dass sie auch deutlich gegen den Antisemitismus Stellung beziehen und dass sie deutlich auch hinschauen, wo Islamisten Terror bei uns propagieren wollen, und dass auch die Verbände das unterbinden und dagegen angehen und auch mit unserer Polizei, mit unseren Sicherheitsorganen zusammenarbeiten. Das ist schon die Erwartung, die ich an die islamischen Verbände habe. Ebenso, dass eben auch im Bereich der islamischen Theologie sich einiges ergeben muss und verändern muss. Aber das ist ein weiteres Thema.
Wentzien: Würden Sie denn sagen, weil Sie diese Aufgabe und diese Erwartung formulieren, dass das noch zu gering ausgeprägt ist, als dass in den muslimischen Verbänden diese noch mal sorgsamere und kenntnisreichere Beobachtung derer, die da wirklich als Gefährder bei uns sind, noch erfolgen müsste und sollte?
Schneider: Ich will jetzt hier nicht so in die Meckerecke gehen und die islamischen Verbände und ihre Vertreter sollen nicht den Eindruck gewinnen, was will er noch alles von uns?
Ich will als Erstes mal sagen, ich akzeptiere und respektiere ihr Auftreten und finde es großartig, was sie alles machen. Ich habe aber die Bitte – ich will das sehr deutlich als Bitte formulieren –, dass sie ihre Anstrengungen an dieser Stelle auch noch mal verstärken und vielleicht auch ein bisschen systematisieren. Dass wir also sehr gezielt und sehr systematisch mit einem solchen Informations-, Aufklärungs- und Bildungsprogramm auf die Flüchtlinge zugehen.
"Die Risiken und Aufgaben sind groß, aber sie sind zu bewältigen"
Wentzien: Wenn Sie diese beiden Komplexe, die Flüchtlingsbewegungen auf dem Kontinent, die Anstrengungen und auch das ja von Ihnen benannte, in Teilen vorhanden Politikversagen zusammenfassen und mal auf die Gegenwart Ihrer Enkelkinder schauen, die eines Tages dann über uns als Geschichte reden werden – werden wir diese Aufgaben gewuppt bekommen haben? Und wird Politik vielleicht auch noch mit geradem Rücken dastehen?
Schneider: Ich glaube, dass wir das schaffen können, und ich bin davon überzeugt, dass wir in zehn, 15 Jahren doch zufrieden zurückschauen können. Ich glaube, dass die Chancen, die mit dieser Zuwanderung verbunden sind, dass die überwiegen gegenüber den Risiken und den Aufgaben.
Die Risiken und Aufgaben sind groß, aber sie sind zu bewältigen. Und dann birgt das Ganze doch unglaubliche Chancen auch für unser Land, weil es kommen Menschen mit ihrem Engagement, mit ihrer Intelligenz, mit ihrer Bereitschaft, sich zu engagieren. Und das kann unserem Land am Ende gut tun.
Wentzien: Auch der Politik.
Schneider: Auch der Politik.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.