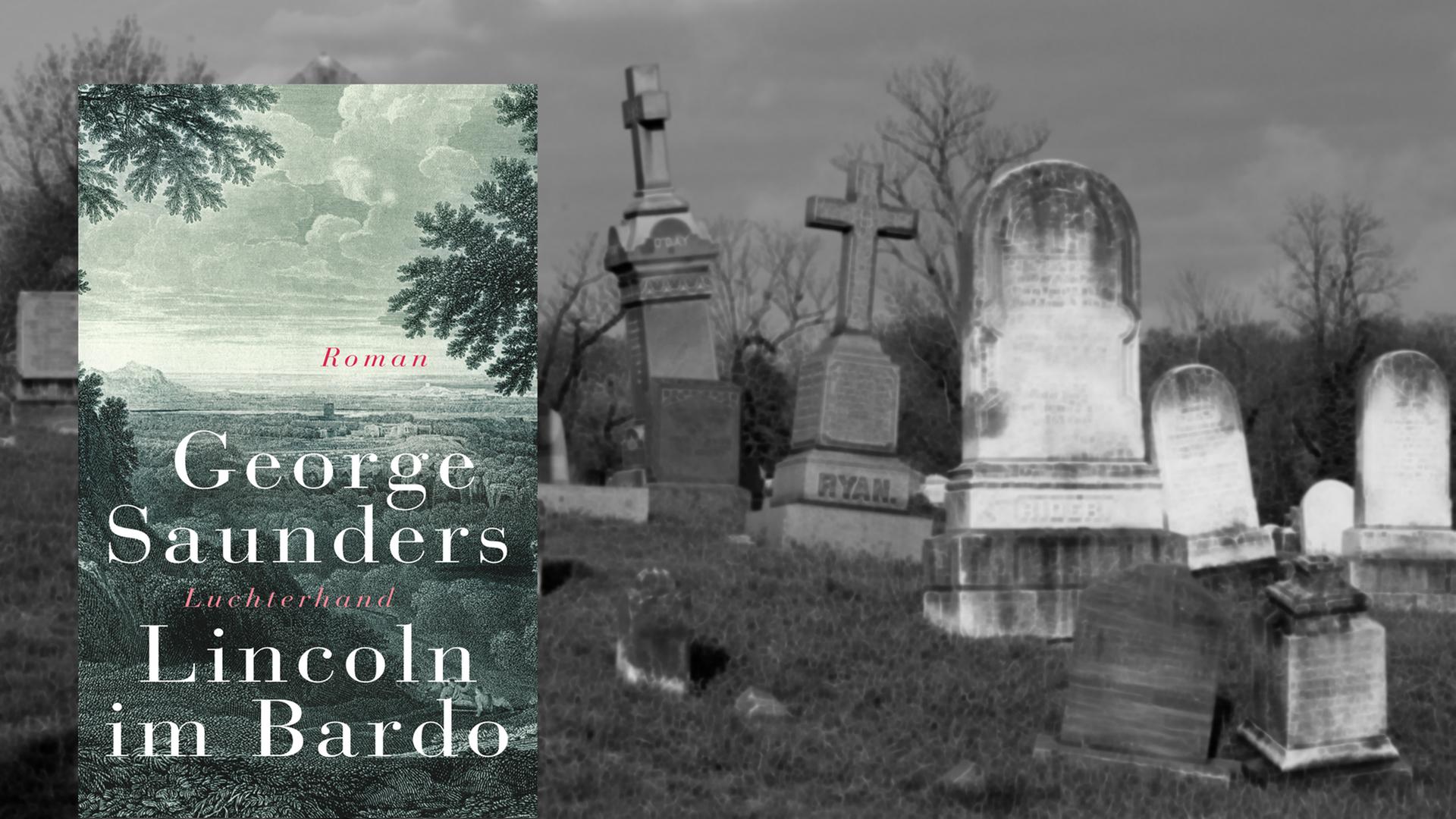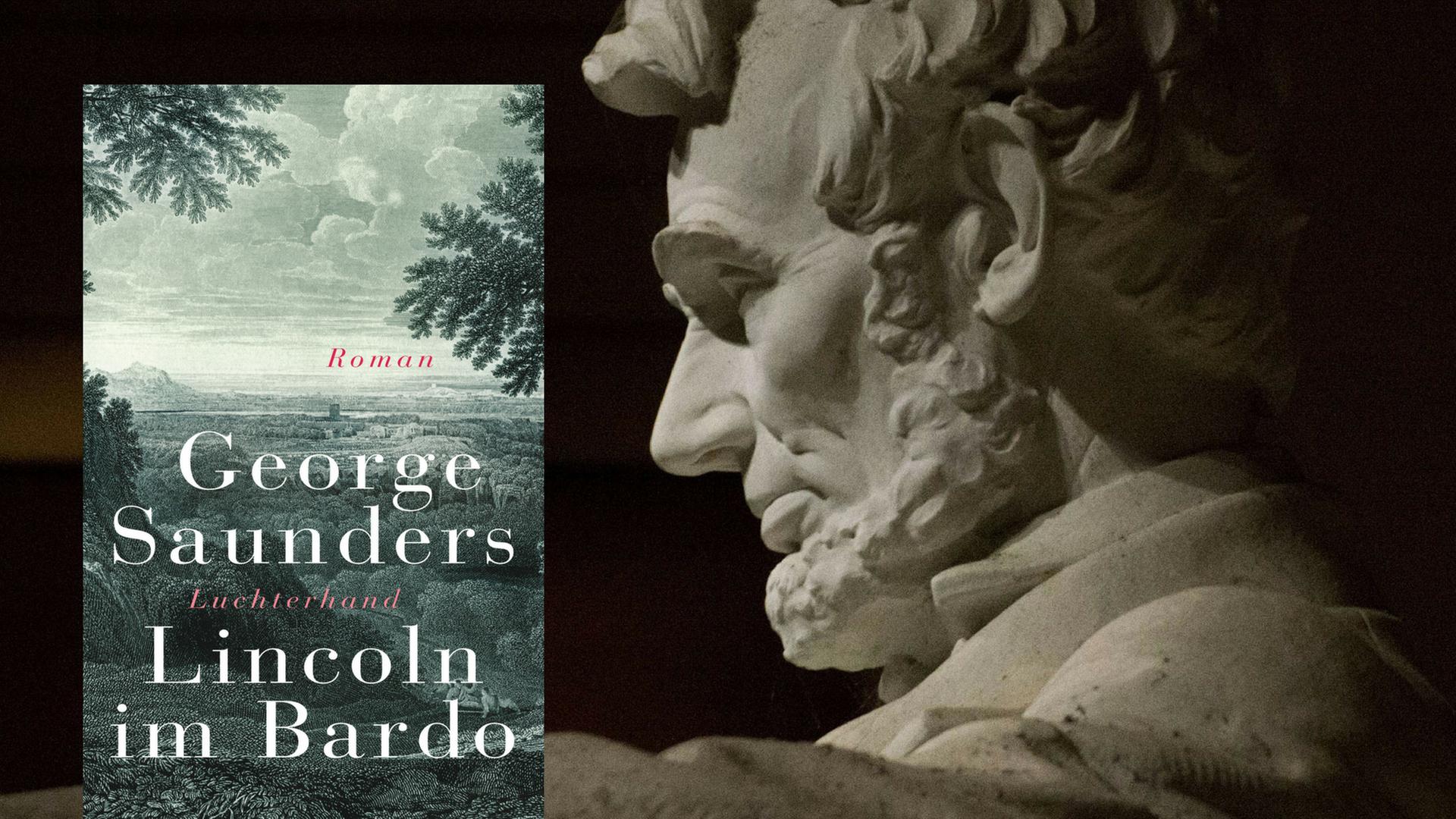
Aus diesem Stoff ließe sich leicht ein Horrorroman entwickeln: Ein alter Friedhof im 19. Jahrhundert, eine Unzahl Geister, die Nacht für Nacht über das Leben sprechen, das sie geführt haben und in das sie gerne zurückkehren möchten. Alle gezeichnet von der Erfahrung des Sterbens, für immer gefangen in dem Ausdruck des Staunens, des Schreckens oder der Angst, die sie in diesem Moment gepackt haben. Einige von ihnen seit Jahrzehnten tot, andere erst seit kurzer Zeit. Und alle zusammen ein Spiegel jener amerikanischen Gesellschaft, deren innere Widersprüche und offene Konflikte die Vereinigten Staaten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Bürgerkrieg treiben.
Über 160 Stimmen lässt George Saunders in seinem Roman "Lincoln im Bardo" zu Wort kommen. Viele in einer Art von Oral History als Zitate aus historischen Quellen; die meisten jedoch als fiktive und schon verstorbene Beobachter, die von ihren persönlichen Schicksalen berichten, manche im Zorn, manche wehleidig, manche renitent - besessen von sich selbst in ihrem nicht toten und nicht lebendigen Unruhestand. Es sind Weiße und Schwarze, Freie und Sklaven, Soldaten und Frauen, Mächtige und Arme. Nur drei dieser Stimmen gehören lebenden Figuren, nämlich dem amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln, der im Februar 1862 seinen Sohn Willie, der an Typhus gestorben ist, zu Grabe tragen muss, dem Friedhofswärter und einer alten Frau, die in einem Haus wohnt, das dem Friedhofsportal gegenüber liegt, von wo aus sie alles beobachten kann, was sich dort abspielt.
Friedhofstreiben als Spiegel des Landes
"Lincoln im Bardo", 2017 mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet und nun in einer deutschen Übertragung von Frank Heibert im Luchterhand Literaturverlag erschienen, konzentriert sich im Wesentlichen auf den Tag der Beerdigung des kleinen Jungen und auf die Nacht, in der Abraham Lincoln mehrfach alleine die Grabkammer besucht, den Sarg öffnet und den Leichnam seines Sohnes umarmt, weil er ihn nicht gehen lassen möchte. Um diesen Kern herum gruppiert George Saunders das Konzert seiner vielen Gewährsleute und formt daraus ein Zeitgemälde, das über Jahrzehnte ausgreift, das Mentalitäten und Kalamitäten genauso wie Unrecht, Gewalt und Bürgersinn in sich schließt. Dieses Friedhofstreiben wird zum Spiegel eines Landes, das gerade dabei ist, sich selbst zu zerstören; die Geisterstimmen bilden sozusagen dessen tagabgewandte Seite.
Alles in diesem Roman steht zunächst unter dem Vorzeichen möglicher Zerstörung - im Privaten wie auf der politischen Bühne, wo das Präsidenten-Ehepaar an dem Abend, an dem der Sohn stirbt, einen prunkvollen, anschließend vielfach kritisierten Empfang geben:
"Die Blumenarrangements schrieben Geschichte. Turmhohe
Farbexplosionen – welch Üppigkeit, nur um im Müll zu landen,
unter der trüben Februarsonne zu verblassen und vertrocknen.
Die Tierkadaver – das »Fleisch« – auf teuren Servierplatten,
warm, von Kräuterzweiglein bedeckt, dampfend,
saftig: weggeschafft werweißwohin, eindeutig Abfall jetzt,
wieder Leichenteile, unbeschönigt, nach ihrer kurzen Erhebung
in den Stand genussbringenden Essens! Die tausend
Kleider, noch am Nachmittag ehrfürchtig bereitgelegt, auf
der Türschwelle sorgfältig von letzten Stäubchen befreit, die
Röcke gerafft für die Kutschfahrt: wo sind sie jetzt? Ist ein
einziges von ihnen irgendwo im Museum ausgestellt? Gibt es
noch ein paar davon, auf Dachböden aufbewahrt? Die meisten
sind zu Staub zerfallen. Wie die Frauen, die sie voller
Stolz in jenem flüchtigen Moment des Glanzes trugen."
In: "Das gesellschaftliche Leben im Bürgerkrieg. Faxen, Metzelei, Verwüstung" (unveröffentlichtes Manuskript) von Melvin Carter
Repräsentation und gute Gesellschaft, Tod und Auflösung gehören untrennbar zusammen - das steht wie ein Motto über dem Buch. In Interviews hat George Saunders immer wieder erklärt, wie ihn diese Episode aus Abraham Lincoln Leben fasziniert habe, wie lange er damit beschäftigt gewesen sei, entweder etwas daraus zu machen oder das Thema für immer beiseite zu legen. Er ist als Verfasser von Kurzgeschichten berühmt geworden, als Erfinder von ungewohnten Settings und als Großmeister von Fantasien, die den gewohnten Rahmen realistischen Erzählens hinter sich lassen. Für deutsche Leser markiert vermutlich der 2014 erschienene Band "Zehnter Dezember" den Punkt, an dem Saunders größere Bekanntheit erlangt hat. Dass aus "Lincoln im Bardo" nicht auch wieder eine Kurzgeschichte geworden ist, hat er damit erklärt, dass der Stoff, als er sich endlich darauf eingelassen habe, immer weiter angewachsen sei, dass er aus sich selbst die kurze Form gesprengt habe. Herausgekommen ist ein kleinteiliges Mosaik, ein Roman, der keinen Moment lang den Eindruck erwecken möchte, in traditioneller Erzählhaltung dem oft schon nacherzählten Weg Abraham Lincolns nachspüren zu wollen.
"Die Blumenarrangements schrieben Geschichte. Turmhohe
Farbexplosionen – welch Üppigkeit, nur um im Müll zu landen,
unter der trüben Februarsonne zu verblassen und vertrocknen.
Die Tierkadaver – das »Fleisch« – auf teuren Servierplatten,
warm, von Kräuterzweiglein bedeckt, dampfend,
saftig: weggeschafft werweißwohin, eindeutig Abfall jetzt,
wieder Leichenteile, unbeschönigt, nach ihrer kurzen Erhebung
in den Stand genussbringenden Essens! Die tausend
Kleider, noch am Nachmittag ehrfürchtig bereitgelegt, auf
der Türschwelle sorgfältig von letzten Stäubchen befreit, die
Röcke gerafft für die Kutschfahrt: wo sind sie jetzt? Ist ein
einziges von ihnen irgendwo im Museum ausgestellt? Gibt es
noch ein paar davon, auf Dachböden aufbewahrt? Die meisten
sind zu Staub zerfallen. Wie die Frauen, die sie voller
Stolz in jenem flüchtigen Moment des Glanzes trugen."
In: "Das gesellschaftliche Leben im Bürgerkrieg. Faxen, Metzelei, Verwüstung" (unveröffentlichtes Manuskript) von Melvin Carter
Repräsentation und gute Gesellschaft, Tod und Auflösung gehören untrennbar zusammen - das steht wie ein Motto über dem Buch. In Interviews hat George Saunders immer wieder erklärt, wie ihn diese Episode aus Abraham Lincoln Leben fasziniert habe, wie lange er damit beschäftigt gewesen sei, entweder etwas daraus zu machen oder das Thema für immer beiseite zu legen. Er ist als Verfasser von Kurzgeschichten berühmt geworden, als Erfinder von ungewohnten Settings und als Großmeister von Fantasien, die den gewohnten Rahmen realistischen Erzählens hinter sich lassen. Für deutsche Leser markiert vermutlich der 2014 erschienene Band "Zehnter Dezember" den Punkt, an dem Saunders größere Bekanntheit erlangt hat. Dass aus "Lincoln im Bardo" nicht auch wieder eine Kurzgeschichte geworden ist, hat er damit erklärt, dass der Stoff, als er sich endlich darauf eingelassen habe, immer weiter angewachsen sei, dass er aus sich selbst die kurze Form gesprengt habe. Herausgekommen ist ein kleinteiliges Mosaik, ein Roman, der keinen Moment lang den Eindruck erwecken möchte, in traditioneller Erzählhaltung dem oft schon nacherzählten Weg Abraham Lincolns nachspüren zu wollen.
Lincolns Dilemma
Dessen Lage ist Anfang 1862 einigermaßen unangenehm: Abrahm Lincoln ist 1860 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden, ohne allzu viel Erfahrung mit öffentlichen Ämtern oder der Washingtoner Politik zu haben, und vertritt als moderater Gegner der Sklaverei eher pragmatische, auf Kompromisse bedachte Haltungen, weil ihm der Erhalt der Union wichtiger ist als die radikale Lösung dieser sozialen Frage. Durch seine überraschende Wahl verschärft sich der Konflikt zwischen den Sklavenhalterstaaten im Süden und den Nordstaaten. Und obwohl Lincoln als Präsident erklärt, die Regierung in Washington werde nicht mit Waffengewalt gegen die abtrünnigen Konföderierten vorgehen, eröffnen letztere mit einem Angriff auf das Fort Sumter den Bürgerkrieg. Die Frage nach der Freiheit für alle Sklaven rückt erst in den Mittelpunkt, als sie sich instrumentalisieren lässt, um den Süden zu schwächen. Auch nimmt der Krieg zunächst für den Norden einen ungünstigen Verlauf und bald wird auch klar, dass er nicht in wenigen Wochen und mit einigen wenigen militärischen Maßnahmen zu beenden sein wird. Das setzt den Präsidenten unter Druck, Lincoln erlebt Anfang 1862 einen Tiefpunkt seiner Präsidentschaft, lebt mit den Klagen über sein Zögern und seine Schwäche:
"Seit neunzehn Monaten hat das Volk auf Euer Geheiß Söhne,
Brüder, Ehemänner & Geld geliefert, ohne Unterlass. – Was
ist das Ergebnis? – Ist Euch eigentlich klar, dass die Verzweiflung,
der Kummer, die Trauer, die dieses Land überziehen,
Eure Schuld sind? – dass die jungen Männer, die zerschmettert,
verkrüppelt, ermordet und für den Rest ihres Lebens
zu Invaliden gemacht wurden, das alles nur Eurer Schwäche,
Entschlusslosigkeit & fehlenden moralischen Courage verdanken?"
Tagg, ebenda, Brief von S. W. Oakey
"Seit neunzehn Monaten hat das Volk auf Euer Geheiß Söhne,
Brüder, Ehemänner & Geld geliefert, ohne Unterlass. – Was
ist das Ergebnis? – Ist Euch eigentlich klar, dass die Verzweiflung,
der Kummer, die Trauer, die dieses Land überziehen,
Eure Schuld sind? – dass die jungen Männer, die zerschmettert,
verkrüppelt, ermordet und für den Rest ihres Lebens
zu Invaliden gemacht wurden, das alles nur Eurer Schwäche,
Entschlusslosigkeit & fehlenden moralischen Courage verdanken?"
Tagg, ebenda, Brief von S. W. Oakey
Private und politische Krise verwoben
Parallel zu diesem Dilemma muss Lincoln als Familienvater den Tod dreier seiner Kinder zu Lebzeiten hinnehmen, im Februar 1862 den des geliebten Sohnes Willie, der über Wochen an Typhus dahingesiecht ist. Die private Katastrophe und die Krise seiner Präsidentschaft fallen zusammen und Saunders verwebt sie, sodass sie sich gegenseitig spiegeln und kommentieren. Er habe an die Pieta gedacht, als man ihm erstmals von Lincoln in der Grabkammer seines Sohnes erzählt habe, hat er erklärt, dieses Bild sei ein Schlüssel zu seinem Roman.
"Er ist nur einer.
Eine Last, die mich fast umbringt.
Habe diese Trauer weggeschoben. Ungefähr dreitausendmal.
Bisher. Bis jetzt. Ein Berg. Aus Jungen. Irgendjemandes Jungen.
Muss damit weitermachen. Habe vielleicht nicht den Mut dafür.
Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, wo das hinführt, ist
das Eine. Aber was hier vor mir liegt, ist ein teures Beispiel dafür,
wohin
meine Befehle -
Habe vielleicht nicht den Mut dafür.
Was tun? Einhalt gebieten? Diese dreitausend ins Loch der Verluste
werfen? Den Frieden suchen? Der große Narr der Kehrtwende
werden, König der Unentschiedenheit, Lachnummer bis in
alle Ewigkeit, schwafelnder Hinterwäldler, dürftiger Mr. Wendehals?
Es ist außer Kontrolle. Wer es ausführt. Wer dran schuld ist.
Wessen Auftritt es ausgelöst hat.
Was mache ich.
Was mache ich hier.
Alles Unsinn jetzt. Diese Trauernden kamen an. Mit ausgestreckten
Händen. Unversehrte Söhne. Trugen verkrampfte Trübsalsmasken,
um jedes Zeichen ihres Glücks zu verbergen, das - das
weiterging. Sie konnten nicht verbergen, wie lebendig sie dadurch
immer noch waren, durch ihr Glück über ihre immer noch leben-
den Söhne und deren Möglichkeiten. Bis vor kurzem war ich einer
von ihnen. Schlenderte pfeifend durch das Schlachthaus, wandte
meinen Blick ab von dem Gemetzel, konnte lachen und träumen
und hoffen, weil es mir noch nicht zugestoßen war."
Die Kunst von George Saunders besteht darin, dieser Verzweiflung des Präsidenten nie ungebrochen Raum zu geben. Der Leser erfährt nur das über den Präsidenten, was in Erinnerungen von Zeitgenossen über ihn geschrieben wird, oder das, was die Geister der Toten auf dem nächtlichen Friedhof ihm ablauschen oder in ihm sehen, wenn sie sich, körperlos wie sie sind, in seine Seele und seinen Körper einschleichen, um ihn zu beeinflussen.
"Er ist nur einer.
Eine Last, die mich fast umbringt.
Habe diese Trauer weggeschoben. Ungefähr dreitausendmal.
Bisher. Bis jetzt. Ein Berg. Aus Jungen. Irgendjemandes Jungen.
Muss damit weitermachen. Habe vielleicht nicht den Mut dafür.
Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, wo das hinführt, ist
das Eine. Aber was hier vor mir liegt, ist ein teures Beispiel dafür,
wohin
meine Befehle -
Habe vielleicht nicht den Mut dafür.
Was tun? Einhalt gebieten? Diese dreitausend ins Loch der Verluste
werfen? Den Frieden suchen? Der große Narr der Kehrtwende
werden, König der Unentschiedenheit, Lachnummer bis in
alle Ewigkeit, schwafelnder Hinterwäldler, dürftiger Mr. Wendehals?
Es ist außer Kontrolle. Wer es ausführt. Wer dran schuld ist.
Wessen Auftritt es ausgelöst hat.
Was mache ich.
Was mache ich hier.
Alles Unsinn jetzt. Diese Trauernden kamen an. Mit ausgestreckten
Händen. Unversehrte Söhne. Trugen verkrampfte Trübsalsmasken,
um jedes Zeichen ihres Glücks zu verbergen, das - das
weiterging. Sie konnten nicht verbergen, wie lebendig sie dadurch
immer noch waren, durch ihr Glück über ihre immer noch leben-
den Söhne und deren Möglichkeiten. Bis vor kurzem war ich einer
von ihnen. Schlenderte pfeifend durch das Schlachthaus, wandte
meinen Blick ab von dem Gemetzel, konnte lachen und träumen
und hoffen, weil es mir noch nicht zugestoßen war."
Die Kunst von George Saunders besteht darin, dieser Verzweiflung des Präsidenten nie ungebrochen Raum zu geben. Der Leser erfährt nur das über den Präsidenten, was in Erinnerungen von Zeitgenossen über ihn geschrieben wird, oder das, was die Geister der Toten auf dem nächtlichen Friedhof ihm ablauschen oder in ihm sehen, wenn sie sich, körperlos wie sie sind, in seine Seele und seinen Körper einschleichen, um ihn zu beeinflussen.
"Bardo" - Zwischenreich zwischen Leben und Tod
Diese Geister agieren dabei nicht selbstlos, sie sind, jeder auf seine Weise, ebenso wankelmütig und unentschlossen und ebenso allein mit ihrem Leid. Sie leben im "Bardo", in einem Raum, den Saunders der buddhistischen Vorstellung von einem Zwischenreich zwischen Leben und Tod nachempfunden hat, einem Raum, in dem das Leben mit seinen Hoffnungen und Zielen noch nicht abgelegt, die Erlösung von diesen Wünschen noch nicht erlangt ist. Sie haben den Tod als ihr Schicksal noch nicht angenommen, sie sprechen von ihren Särgen als "Kranken-Kisten", sie hoffen auf Behandlungen und Genesungen, die schon lange gescheitert sind. Vor allem aber hoffen sie auf Besucher, auf Menschen, denen sie noch etwas bedeuten und die sie zurückführen könnten in das Leben, das sie aus eigener Kraft nicht mehr erreichen können. Als Abraham Lincoln seinen begrabenen Sohn aufsucht, bestärkt sie das in ihren Hoffnungen.
Vor allem drei Männer stellt George Saunders dabei als Beobachter heraus: einen alten Reverend, der stets mit gesträubten Haaren und mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen erscheint; einen ehemaligen Buchdrucker, dem in der Nacht, in der er mit seiner zweiten, sehr jungen Frau zum ersten Mal schlafen wollte, ein Balken den Kopf eingeschlagen und die Geschlechtsteile hart getroffen hat, der seither nackt und mit übermäßig geschwollenem Glied auftreten muss, sowie den homosexuellen Selbstmörder Roger Bevins, einst ein junger Mann der, ebenfalls unförmig entstellt, genau wie alle anderen immer wieder freimütig erzählt, wie er dahin gelangt ist, wo der Leser ihm nun begegnet. Wie er sich erst die Pulsadern aufgeschnitten, dann aber nicht habe sterben wollen:
"Meine einzige Hoffnung bestand darin, von einem der
Dienstboten gefunden zu werden, das wusste ich, also taumelte
ich zur Treppe und stürzte mich hinunter. Von dort
schaffte ich es, in die Küche zu kriechen -
Und da bleibe ich liegen.
Ich warte darauf, gefunden zu werden (am Boden zur Ruhe
gekommen, Kopf beim Ofen, umgekippter Stuhl neben
mir,
ein Stück Orangenschale an meiner Wange), auf dass man
mich wiederbelebe und ich auferstehen könne, um den furchtbaren
Schlamassel wegzuräumen, den ich angerichtet habe
(das wird Mutter gar nicht gefallen), und dann hinauszugehen
in diese wunderschöne Welt, als neuer, mutigerer Mann,
und endlich zu leben! Werde ich meiner Vorliebe nachgehen?
Und ob! Und wie! Ich war nahe dran, alles
zu verlieren, und
deshalb bin ich jetzt frei von aller Angst, Zögerlichkeit und
Scheu. Wenn ich erst wiederbelebt bin, werde ich andächtig
auf Erden wandeln und dabei aufsaugen, riechen, kosten, lieben,
wen ich möchte;
berühren, probieren, ganz still stehen
inmitten aller Schönheiten dieser Welt (…)."
George Saunders entwirft eine bizarr anmutende Situation, die von Pathos, Anteilnahme und Leid lebt, die aber Szene für Szene zugleich durch die comic-hafte, man könnte vielleicht auch sagen "trashige" Inszenierung ins Komische umbogen wird. Die Seelen auf dem Friedhof führen ein langweiliges Dasein, sie sehnen sich nach Abwechslung und schweben über den Friedhof wie Gespenster aus einem Kinderbuch und der Roman verwendet viel Sprachwitz auf diese Inszenierungen. Aber wenn es ernst wird, wenn sie sich entscheiden müssten, ob sie weiter dort verharren oder den Tod akzeptieren möchten, dann fürchten sie den Blick in die Hölle, die vielleicht auf sie wartet. So wie der alte Reverend, der schon einmal vor der Frage "Hast Du richtig gelebt?" geflohen ist, der einen Blick in diese Hölle getan und davor zurückgeschreckt ist.
"Die Diamanttüren flogen auf.
Ich blinzelte ungläubig ob der Verwandlung dahinter. Das
Zelt bestand nicht mehr aus Seide, sondern aus Fleisch (fleckig
und rosa von verdorbenem Blut); das Festmahl war kein
Festmahl, sondern vielmehr lagen auf langen Tischen dort
drinnen zahlreiche menschliche Gestalten ausgestreckt, in
verschiedenen Stadien der Schindung; der Gastgeber war
kein König, kein Jesus, sondern eine Bestie mit blutigen
Händen und langen Reißzähnen in einer schwefelfarbenen,
mit Innereien besudelten Robe. Außerdem konnte man drei
Frauen und einen gebückten alten Mann erkennen, die lange
Seile aus (ihren eigenen) Gedärmen trugen (furchtbar!). Aber
am furchtbarsten war es, wie sie vor Freude aufkreischten, als
mein Freund im Totenanzug zu ihnen hineingezerrt wurde,
und wie der arme Bursche immer weiterlächelte, als wollte er
sich bei seinen Fängern einschmeicheln, wie er all die wohltätigen
Dinge auflistete, die er in Pennsylvania vollbracht
hatte, die zahlreichen guten Menschen, die für ihn bürgen
würden, (...)
Jetzt war ich dran.
Wie hast du gelebt?, fragte das Wesen zur Rechten.
"Meine einzige Hoffnung bestand darin, von einem der
Dienstboten gefunden zu werden, das wusste ich, also taumelte
ich zur Treppe und stürzte mich hinunter. Von dort
schaffte ich es, in die Küche zu kriechen -
Und da bleibe ich liegen.
Ich warte darauf, gefunden zu werden (am Boden zur Ruhe
gekommen, Kopf beim Ofen, umgekippter Stuhl neben
mir,
ein Stück Orangenschale an meiner Wange), auf dass man
mich wiederbelebe und ich auferstehen könne, um den furchtbaren
Schlamassel wegzuräumen, den ich angerichtet habe
(das wird Mutter gar nicht gefallen), und dann hinauszugehen
in diese wunderschöne Welt, als neuer, mutigerer Mann,
und endlich zu leben! Werde ich meiner Vorliebe nachgehen?
Und ob! Und wie! Ich war nahe dran, alles
zu verlieren, und
deshalb bin ich jetzt frei von aller Angst, Zögerlichkeit und
Scheu. Wenn ich erst wiederbelebt bin, werde ich andächtig
auf Erden wandeln und dabei aufsaugen, riechen, kosten, lieben,
wen ich möchte;
berühren, probieren, ganz still stehen
inmitten aller Schönheiten dieser Welt (…)."
George Saunders entwirft eine bizarr anmutende Situation, die von Pathos, Anteilnahme und Leid lebt, die aber Szene für Szene zugleich durch die comic-hafte, man könnte vielleicht auch sagen "trashige" Inszenierung ins Komische umbogen wird. Die Seelen auf dem Friedhof führen ein langweiliges Dasein, sie sehnen sich nach Abwechslung und schweben über den Friedhof wie Gespenster aus einem Kinderbuch und der Roman verwendet viel Sprachwitz auf diese Inszenierungen. Aber wenn es ernst wird, wenn sie sich entscheiden müssten, ob sie weiter dort verharren oder den Tod akzeptieren möchten, dann fürchten sie den Blick in die Hölle, die vielleicht auf sie wartet. So wie der alte Reverend, der schon einmal vor der Frage "Hast Du richtig gelebt?" geflohen ist, der einen Blick in diese Hölle getan und davor zurückgeschreckt ist.
"Die Diamanttüren flogen auf.
Ich blinzelte ungläubig ob der Verwandlung dahinter. Das
Zelt bestand nicht mehr aus Seide, sondern aus Fleisch (fleckig
und rosa von verdorbenem Blut); das Festmahl war kein
Festmahl, sondern vielmehr lagen auf langen Tischen dort
drinnen zahlreiche menschliche Gestalten ausgestreckt, in
verschiedenen Stadien der Schindung; der Gastgeber war
kein König, kein Jesus, sondern eine Bestie mit blutigen
Händen und langen Reißzähnen in einer schwefelfarbenen,
mit Innereien besudelten Robe. Außerdem konnte man drei
Frauen und einen gebückten alten Mann erkennen, die lange
Seile aus (ihren eigenen) Gedärmen trugen (furchtbar!). Aber
am furchtbarsten war es, wie sie vor Freude aufkreischten, als
mein Freund im Totenanzug zu ihnen hineingezerrt wurde,
und wie der arme Bursche immer weiterlächelte, als wollte er
sich bei seinen Fängern einschmeicheln, wie er all die wohltätigen
Dinge auflistete, die er in Pennsylvania vollbracht
hatte, die zahlreichen guten Menschen, die für ihn bürgen
würden, (...)
Jetzt war ich dran.
Wie hast du gelebt?, fragte das Wesen zur Rechten.
Grausamkeit des Bürgerkriegs
Diese Bilder sind eher der christlichen Tradition des Fegefeuers und den Höllenbildern eines Hieronymus Bosch entlehnt und nicht dem buddhistischen Bardo. Unter den Lebenden kommen dem nur die Eindrücke von den Schlachtfeldern des Bürgerkrieges gleich, der schon früh im Jahr 1862 erahnen lässt, wie blutig es noch werden wird. Recherchiert man, findet man Fotos von diesen Schlachtfeldern, aber George Saunders gelingt es auch ohne solche Bebilderungen durch die Beschreibungen, die Grausamkeit dieses Bürgerkrieges zu verdeutlichen. Die Bilder von Otto Dix von den Schlachtfeldern und Schützengräben des Ersten Weltkrieges bieten sich zum Vergleich an - auch der amerikanische Bürgerkrieg war wie der Erste Weltkrieg nicht als endloses Gemetzel geplant - und zog sich dann doch jahrelang hin.
"Die Toten lagen, wie sie gefallen waren, in jeder vorstellbaren
Haltung, manche klammerten sich an ihren Gewehren
fest, als wären sie gerade dabei zu schießen, während andere,
eine Patrone in ihrem eisigen Griff, gerade nachluden.
Einige Mienen trugen ein friedvolles, frohes Lächeln, während
sich auf anderen ein feindseliger Blick des Hasses gehalten
hatte. Jedes Antlitz schien das genaue Gegenstück der
Gedanken zu sein, die demjenigen durch den Kopf gegangen
waren, als der Bote des Todes ihn ummähte. Vielleicht
spürte jener edel wirkende Jüngling mit seinem gen Himmel
gewandten Lächeln
und den glänzenden, blutverklebten Locken,
wie sich ein Muttergebet durch seine Sinne stahl, just
als sein junges Leben erlosch. Neben ihm lag ein junger Ehemann,
dem das Gebet für die Gattin und das Kleine noch auf
den Lippen verweilte."
In: "Die Bürgerkriegsjahre. Eine tägliche Chronik vom Leben einer Nation", herausgegeben von Robert E. Denney, Bericht von Corporal Lucius W. Barber, Co.D, 15. Freiwilligen-Infanterie von Illinois, Kämpfer in Fort Donelson
In den Gesichtern der Gefallenen hat sich so wie in den Körpern und Mienen der Geisterwesen auf dem Friedhof eingegraben, was sie im letzten Moment ihres Lebens empfunden haben. Der Friedhof ist auch in dieser Hinsicht der Spiegel der oberirdischen Welt - und Abraham Lincoln als nächtlicher Gast auf diesem Friedhof wird zum Resonanzraum der Trauer der vielen, die dort schon begraben liegen.
"Die Toten lagen, wie sie gefallen waren, in jeder vorstellbaren
Haltung, manche klammerten sich an ihren Gewehren
fest, als wären sie gerade dabei zu schießen, während andere,
eine Patrone in ihrem eisigen Griff, gerade nachluden.
Einige Mienen trugen ein friedvolles, frohes Lächeln, während
sich auf anderen ein feindseliger Blick des Hasses gehalten
hatte. Jedes Antlitz schien das genaue Gegenstück der
Gedanken zu sein, die demjenigen durch den Kopf gegangen
waren, als der Bote des Todes ihn ummähte. Vielleicht
spürte jener edel wirkende Jüngling mit seinem gen Himmel
gewandten Lächeln
und den glänzenden, blutverklebten Locken,
wie sich ein Muttergebet durch seine Sinne stahl, just
als sein junges Leben erlosch. Neben ihm lag ein junger Ehemann,
dem das Gebet für die Gattin und das Kleine noch auf
den Lippen verweilte."
In: "Die Bürgerkriegsjahre. Eine tägliche Chronik vom Leben einer Nation", herausgegeben von Robert E. Denney, Bericht von Corporal Lucius W. Barber, Co.D, 15. Freiwilligen-Infanterie von Illinois, Kämpfer in Fort Donelson
In den Gesichtern der Gefallenen hat sich so wie in den Körpern und Mienen der Geisterwesen auf dem Friedhof eingegraben, was sie im letzten Moment ihres Lebens empfunden haben. Der Friedhof ist auch in dieser Hinsicht der Spiegel der oberirdischen Welt - und Abraham Lincoln als nächtlicher Gast auf diesem Friedhof wird zum Resonanzraum der Trauer der vielen, die dort schon begraben liegen.
Intensiver Austausch zwischen den Lebenden und den Toten
Doch nicht nur der Vater ist gemeint, wenn der Romantitel von "Lincoln im Bardo" spricht. Auch sein Sohn Willie spielt in diesem Zwischenreich eine entscheidende Rolle. Kinder, so wissen es die Veteranen unter den Geistern, sollten diesen Ort umgehend verlassen, denn er sei denen vorbehalten, die an einem Leben festhalten wollen, dass sie unerfüllt gelassen hat. Willie aber sträubt sich dagegen, er hofft auf den Besuch seines Vaters, der sich aber immer nur der Leiche im Sarg zuwendet und nie dem Geist des Jungen, den er gar nicht bemerkt, den er auch nicht hört, wenn der zu ihm spricht. In dem der Geist des Sohnes aber den Vater belauscht, als der über den Leichnam gebeugt den Verlust beklagt, versteht der Junge die eigene Situation und deren Ausweglosigkeit. Und damit auch die Situation all der Geister um ihn herum.
Es ist ein steter intensiver Austausch zwischen den Lebenden und den Toten, den George Saunders hier entwirft, eine Vision von Humanität, denn die Seelen der Verstorbenen durchdringen und belauschen nicht nur den Präsidenten, sondern kaum dass dieser Prozess in Gang gekommen ist, durchdringen sie sich auch gegenseitig zu Hunderten und erkennen erst dabei, wer ihre nächtlichen Gefährten wirklich waren, ehe sie im demütigenden Zustand auf dem Friedhof angekommen sind.
Es ist ein steter intensiver Austausch zwischen den Lebenden und den Toten, den George Saunders hier entwirft, eine Vision von Humanität, denn die Seelen der Verstorbenen durchdringen und belauschen nicht nur den Präsidenten, sondern kaum dass dieser Prozess in Gang gekommen ist, durchdringen sie sich auch gegenseitig zu Hunderten und erkennen erst dabei, wer ihre nächtlichen Gefährten wirklich waren, ehe sie im demütigenden Zustand auf dem Friedhof angekommen sind.
Diese allseitige Verschmelzung könnte unangenehm esoterisch wirken, wäre sie nicht durch die bizarre Vorstellung von den vielen ineinander verwobenen Seelen einmal mehr komisch gebrochen. Saunders Roman ist ein gewagter Balance-Akt, ständig in der Gefahr abzustürzen. Das geschieht aber nie, auch nicht, wenn gegen Ende des Buches das politische Amerika des Jahres 1862 als Handlungsfeld wieder stärker in den Blick rückt. Es ist wiederum einer der Toten, der beschreibt, was in dem Moment in Lincoln vorgeht, es ist nicht der große Redner selbst, dem Saunders hier das Wort gibt:
"Sein Geist neigte von neuem dem Leid zu; der Tatsache, dass
die Welt voll Leid war; dass jeder auf seine Weise unter einer
Last des Leides ächzte; dass alle litten; dass man, welchen
Weg man auch immer einschlug auf dieser Welt, nie vergessen
durfte, die anderen litten alle auch (keiner zufrieden; alle
ungerecht behandelt, vernachlässigt, übersehen, missverstanden),
und deshalb musste man tun, was man konnte, um die
Bürde derjenigen zu erleichtern, denen man begegnete; dass
sein derzeitiges Leid nicht allein das seinige war, keineswegs,
Vergleichbares hatten vielmehr schon unzählige andere zu
allen Zeiten, zu jeder Zeit gespürt und würden es noch zu
spüren bekommen, weshalb es weder verlängert noch gesteigert
werden durfte, denn in diesem Zustand konnte er
niemandem helfen, und da er durch seine Stellung in der
Welt entweder viel Hilfe leisten oder viel Schaden anrichten
konnte, durfte er, wenn es irgend ging, nicht so niedergeschlagen
bleiben."
Keine Geschichtsschreibung, sondern Ergründung innerer Prozesse
Der Präsident, der tief in der Nacht auf sein Pferd steigt und den Friedhof verlässt, ist nun jener Abraham Lincoln, der parteiübergreifend als Lichtgestalt verehrt wird. Der von da an den Krieg gegen die Südstaaten und für die Befreiung aller Sklaven energisch führen wird und die Vereinigten Staaten vor dem Zerbrechen bewahrt. An diesem Umschlagspunkt ist Saunders interessiert, nicht an Geschichtsschreibung. Er lässt verstorbene Sklaven zu Wort kommen, schildert das Leid einer jungen Mulattin, die traumatisiert durch zahllose Vergewaltigungen die Sprache verloren hat. Und er greift das Pathos der bis heute berühmten "Gettysburg Address" Lincolns auf, jener Drei-Minuten-Rede, in welcher der Präsident nach dem Sieg bei Gettysburg 1863 den Wert eines demokratischen und geeinten Amerikas beschworen hat.
Es ist der Selbstmörder Roger Bevins, der diese Ideen zuletzt im Roman am deutlichsten aufnimmt und einen Aufbruch beschwört, an dem er selbst nicht mehr teilnehmen wird.
"War es das wert. Das Töten wert. Oberflächlich gesehen ging
es um eine Formsache (die Union halt), aber in der Tiefe um
viel mehr. Wie sollten die Menschen leben? Wie konnten die
Menschen leben? Jetzt erinnerte er sich an den Jungen, der
er gewesen war (der sich vor Vater versteckte, um Bunyan
zu lesen; der Kaninchen züchtete, um ein bisschen Geld zu
verdienen; der in der Stadt herumstand, auf dass die grelle
Parade des Alltags die harte Sprache des Hungers übertöne;
der zurücktaumeln musste, wenn einer von denen, die
mehr Glück hatten, fröhlich in seiner Kutsche vorbeikam),
der sich schräg und komisch fühlte (und schlau, überlegen),
langbeinig, immer irgendwo dagegenrempelnd, immer mit
Spitznamen bedacht.
(…)
Auf der anderen Seite des Ozeans schauten satte Könige
hämisch zu, weil nach einem guten Anfang hier nun etwas
entgleist war (wie weiter südlich ähnliche Könige auch), und
wenn etwas entgleiste, dann war der ganze Laden hinüber,
für immer, und falls das jemals einer wieder in Gang bringen
wollte, na, da würde er zu hören bekommen (und zwar zu
Recht): Der Pöbel kann sich nicht selber organisieren.
Und ob der Pöbel das konnte. Und würde.
Er würde den Pöbel dabei anführen.
Das Ganze gewinnen - so würde es kommen."
Es ist der Selbstmörder Roger Bevins, der diese Ideen zuletzt im Roman am deutlichsten aufnimmt und einen Aufbruch beschwört, an dem er selbst nicht mehr teilnehmen wird.
"War es das wert. Das Töten wert. Oberflächlich gesehen ging
es um eine Formsache (die Union halt), aber in der Tiefe um
viel mehr. Wie sollten die Menschen leben? Wie konnten die
Menschen leben? Jetzt erinnerte er sich an den Jungen, der
er gewesen war (der sich vor Vater versteckte, um Bunyan
zu lesen; der Kaninchen züchtete, um ein bisschen Geld zu
verdienen; der in der Stadt herumstand, auf dass die grelle
Parade des Alltags die harte Sprache des Hungers übertöne;
der zurücktaumeln musste, wenn einer von denen, die
mehr Glück hatten, fröhlich in seiner Kutsche vorbeikam),
der sich schräg und komisch fühlte (und schlau, überlegen),
langbeinig, immer irgendwo dagegenrempelnd, immer mit
Spitznamen bedacht.
(…)
Auf der anderen Seite des Ozeans schauten satte Könige
hämisch zu, weil nach einem guten Anfang hier nun etwas
entgleist war (wie weiter südlich ähnliche Könige auch), und
wenn etwas entgleiste, dann war der ganze Laden hinüber,
für immer, und falls das jemals einer wieder in Gang bringen
wollte, na, da würde er zu hören bekommen (und zwar zu
Recht): Der Pöbel kann sich nicht selber organisieren.
Und ob der Pöbel das konnte. Und würde.
Er würde den Pöbel dabei anführen.
Das Ganze gewinnen - so würde es kommen."
Gespräch mit der Geschichte
Ist George Saunders Roman somit ein politisches, gar ein engagiertes Buch?
In einigen Reaktionen ist ein Bezug zum Amerika unter dem aktuellen Präsidenten Donald Trump betont worden, dem Abraham Lincoln überlebensgroß gegenübergestellt sei. Aber Saunders ergreift eigentlich keine Partei, der Roman gibt keine Empfehlungen außer vielleicht der, sich den Forderungen zu stellen, die auf einen zu kommen - und da lässt sich vieles mit verbinden. "Lincoln im Bardo" bietet sich vielmehr als eine ausgedehnte historische Meditation an, als Gespräch mit der Geschichte, mit den Lebenden und den Toten, nicht zuletzt mit sich selbst - und stets im Genuss einer gewissen ironischen Distanz.
In einigen Reaktionen ist ein Bezug zum Amerika unter dem aktuellen Präsidenten Donald Trump betont worden, dem Abraham Lincoln überlebensgroß gegenübergestellt sei. Aber Saunders ergreift eigentlich keine Partei, der Roman gibt keine Empfehlungen außer vielleicht der, sich den Forderungen zu stellen, die auf einen zu kommen - und da lässt sich vieles mit verbinden. "Lincoln im Bardo" bietet sich vielmehr als eine ausgedehnte historische Meditation an, als Gespräch mit der Geschichte, mit den Lebenden und den Toten, nicht zuletzt mit sich selbst - und stets im Genuss einer gewissen ironischen Distanz.
George Saunders: "Lincoln im Bardo"
Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert
Luchterhand Literaturverlag, München, 448 Seiten, 25 Euro
Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert
Luchterhand Literaturverlag, München, 448 Seiten, 25 Euro