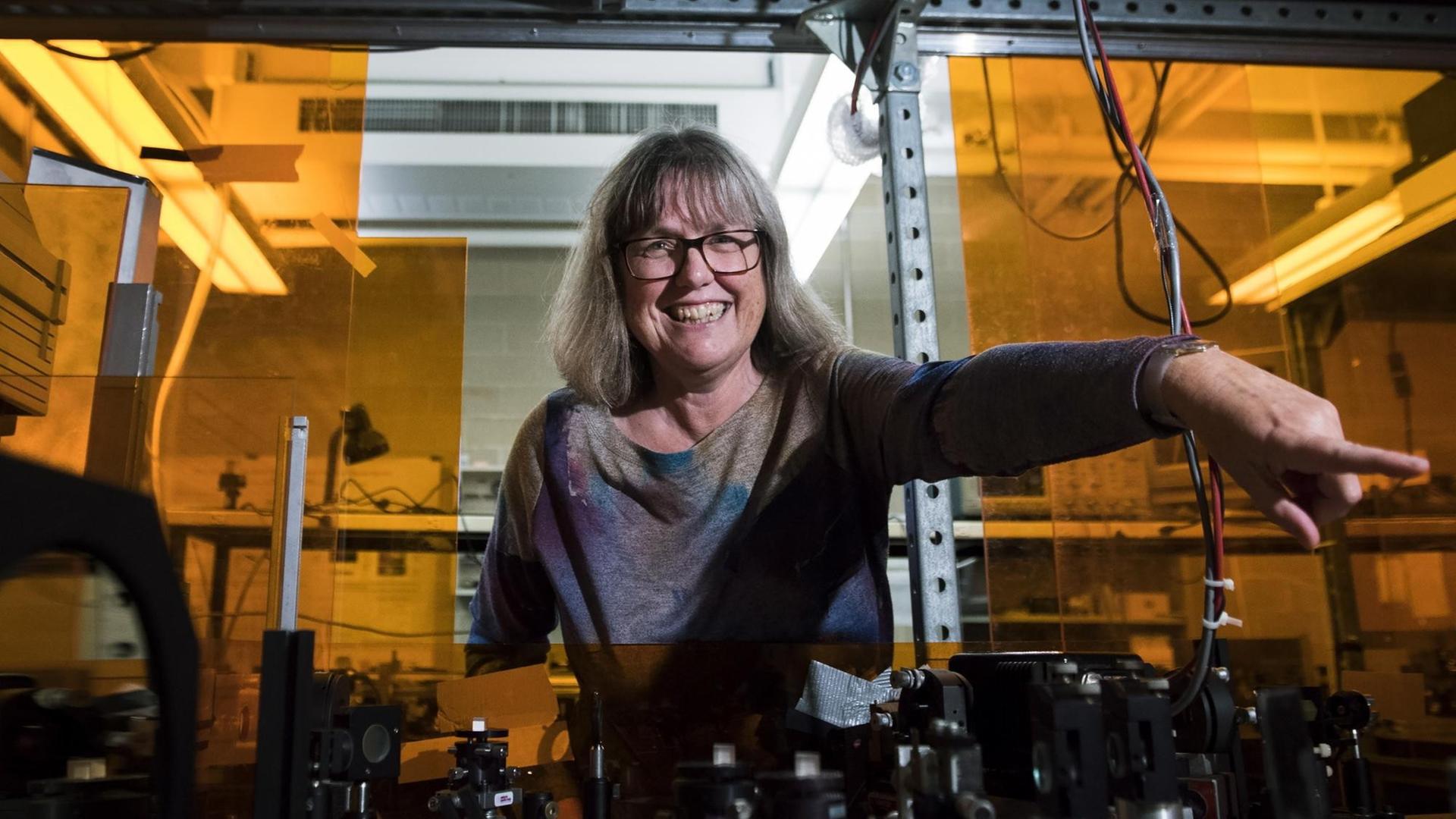Die Forschungsergebnisse zu COVID-19 wachsen fast so schnell wie die Infektionszahlen. Die Veröffentlichungen im biomedizinischen Bereich haben sich trotz Lockdown zwischen Februar und Mai verdoppelt. Über alle Fachrichtungen hinweg ist die Zahl der Veröffentlichungen im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte gestiegen. Ein Höhenflug für die Forschung, aber nicht für alle Forschenden:
"Für Eltern war es deutlich schwieriger und für Mütter noch ein bisschen mehr."

Martha Nari Havenith ist seit Februar Forschungsgruppenleiterin am Ernst-Strüngmann Institut in Frankfurt am Main. Eigentlich hätte sie Anfang März dabei sein sollen, ihr Labor aufzubauen. Stattdessen saß sie den Lockdown über im Kinderzimmer und baute Türmchen aus Bauklötzen. So wie manch andere Kolleginnen auch.
Ungleiche Lastenverteilung zwischen Müttern und Vätern
"Also so inoffiziell gefühlt, habe ich den Eindruck, dass die Mütter generell zwischen 50 und 90 Prozent der Kindererziehung übernehmen und die Väter mehr so zwischen 10 und 50 Prozent. Das heißt, wenn man als Frau Glück hat, dann teilt man sich das 50/50 und als Mann. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass männliche Kollegen, die Väter sind, teilweise die Möglichkeit hatten, mehr zu arbeiten."
Das Gefühl trügt nicht: Eine umfassende Analyse der Daten von über 2300 wissenschaftlichen Magazinen des Verlagshauses Elsevier zeigt: Frauen hatten an der Flut von Fachartikeln, die allein in den ersten Monaten der Pandemie entstanden sind, im Verhältnis weniger Anteil als normalerweise. Das gilt für fast alle Fachrichtungen, aber ganz besonders für Forschung rund um das Thema COVID-19.
Das Gefühl trügt nicht: Eine umfassende Analyse der Daten von über 2300 wissenschaftlichen Magazinen des Verlagshauses Elsevier zeigt: Frauen hatten an der Flut von Fachartikeln, die allein in den ersten Monaten der Pandemie entstanden sind, im Verhältnis weniger Anteil als normalerweise. Das gilt für fast alle Fachrichtungen, aber ganz besonders für Forschung rund um das Thema COVID-19.
COVID-Studien als Datenbasis
Damit bestätigt die Analyse einen Trend, auf den kleinere Untersuchungen schon länger hingedeutet hatten. Geschlossene Schulen und Kindergärten sind eine wichtige Ursache für die Benachteiligung von Wissenschaftlerinnen in der Pandemie. Das zeigt unter anderem eine Umfrage unter Professorinnen und Professoren in Deutschland, die Heike Solga geleitet hat. Sie ist Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt am WZB, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung:
"Also wenn wir nur Väter und Mütter vergleichen, dann sehen wir, dass über 70 Prozent der Professorinnen mit minderjährigen Kindern sagen, sie konnten nicht so viel einreichen, wie sie geplant hatten. Aber nur 54 Prozent der Väter. Und wir finden, dass bei den Vätern sieben Prozent sogar sagen konnten, sie haben mehr veröffentlicht als geplant."
Ähnliches Bild in USA und Europa
Umfragen unter Forschenden in den USA und Europa kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Aus der Befragung von Heike Solga geht hervor, dass Wissenschaftlerinnen durch die Pandemie aber auch dann stärker eingeschränkt sind, wenn sie selber keine kleinen Kinder haben. Ein Grund: Frauen kooperieren mehr mit Frauen. Damit waren Wissenschaftlerinnen häufiger indirekt von geschlossenen Kindergärten und Schulen in ihrer Arbeit beeinträchtigt als Männer. Ein anderer Grund liegt nicht bei den Kindern, sondern in der Lehrverpflichtung:
"Was ich schon überraschender fand, dass für das Gesamtsample der über 1600 Befragten der Umstieg auf die Online-Lehre der Hauptgrund war, warum sie weniger als geplant Papiere eingereicht haben in der Zeit des Lockdown. Knapp die Hälfte der Befragten bei den Frauen, aber nur unter 30 Prozent bei den Männern."
Höhrere Belastung in der Lehre
Der Grund: Männer übernehmen im akademischen Betrieb häufiger Ämter, die sie von Lehrverpflichtungen entbinden. Frauen halten im Verhältnis nicht nur mehr Lehrveranstaltungen, sie stecken auch mehr Zeit in die Betreuung Studierender. Unterschiede, die ganz unabhängig von der Pandemie dazu führen, dass Karrierechancen nicht gleich verteilt sind, meint Heike Solga:
"Ich würde sagen, das Wissenschaftssystem ist jetzt nicht unbedingt das Paradies für die Gleichstellung und ist nicht viel besser als viele Bereiche in der Wirtschaft."
Gut 50 Prozent aller Angestellten an deutschen Hochschulen sind weiblich. Frauen stellen die Hälfte der Studierendenschaft und 45 Prozent der Promovierenden. Aber sie besetzen nur ein Viertel der Professuren. Damit liegen die Universitäten noch unter der Zielquote von 30 Prozent, die für Wirtschaftsunternehmen gilt.
Langzeitfolgen für die Karriere vorgezeichnet
Martha Nari Havenith ist auf dem Weg zur Professur. Das heißt, sie muss sich in den kommenden Jahren als unabhängige Forscherin beweisen. Ein wichtiges Maß dafür ist der wissenschaftliche Output: Wie viele Fachartikel sie in welcher Zeit veröffentlicht. Eine ungeplante Kinderpause kann dabei langfristige Konsequenzen haben:
"Es wird uns netto fast ein Jahr kosten. Ich meine, wenn das nicht in Betracht gezogen wird, das ist ein großes Problem für uns. Ein Jahr – das ist eine Menge, wenn man das auf einem Lebenslauf erklären will!"
Genderforscher und Gleichstellungsbeauftragte fordern Wissenschaftsinstitutionen und Forschungsförderer deshalb auf, Maßnahmen zu ergreifen, die insbesondere Frauen, die durch Corona in ihrer Berufstätigkeit beeinträchtigt wurden, besser stellen. Tatsächlich haben viele Geldgeber Fristen und Deadlines verlängert, um Forschenden unabhängig von ihrem Geschlecht den entstandenen Zeitdruck zu nehmen. Das gilt auch für die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, den größten deutschen Forschungsförderer. Ein spezielles Förderprogram für Frauen ist allerdings nicht geplant, erklärt Eva Reichwein, Direktorin in der Gruppe Chancengleichheit der DFG. Denn in den Antragszahlen der DFG selber sei bislang keine Corona-bedingte Veränderung der Geschlechterverteilung zu beobachten.

Kontext für Leistungsbewertung berücksichtigen
"Es hat uns selbst ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, angesichts dieser ganzen anderen Ergebnisse. Aber ich denke: Ja – wir müssen abwarten, wie sich das mittel- und langfristig entwickelt. Da kann es sehr gut sein, dass es noch mal Änderungen gibt. Und das haben wir natürlich dann auch im Blick. Aber im Moment ist kein eindeutiger Zusammenhang erkennbar."
Solange das so bleibt, setzt die DFG darauf, existierende Maßnahmen bekannter und damit wirksamer zu machen. Etwa eine Richtlinie, die dazu auffordert, wissenschaftliche Leistung im Kontext der individuellen Lebensumstände zu begutachten. Kindererziehungszeiten sollen so auch abseits von Pandemien und Notsituationen besser berücksichtigt werden. Ziel ist es, Gleichstellung langfristig zu fördern. Und hier könnte COVID-19 für die Frauen ausnahmsweise Mal etwas Gutes bewirken, denkt Genderforscherin Heike Solga.
"Die unterschiedliche private Situation von Männern und Frauen auch innerhalb der Wissenschaft, die ist sichtbarerer geworden in der COVID-19-Phase. Und dieses Sichtbarmachen und damit auch wieder eine neue Aufmerksamkeit zu erlangen, das kann man natürlich auch als Chance nutzen."