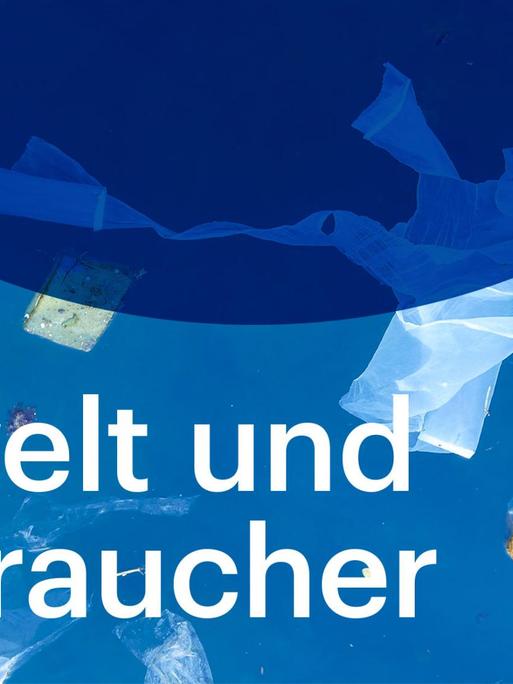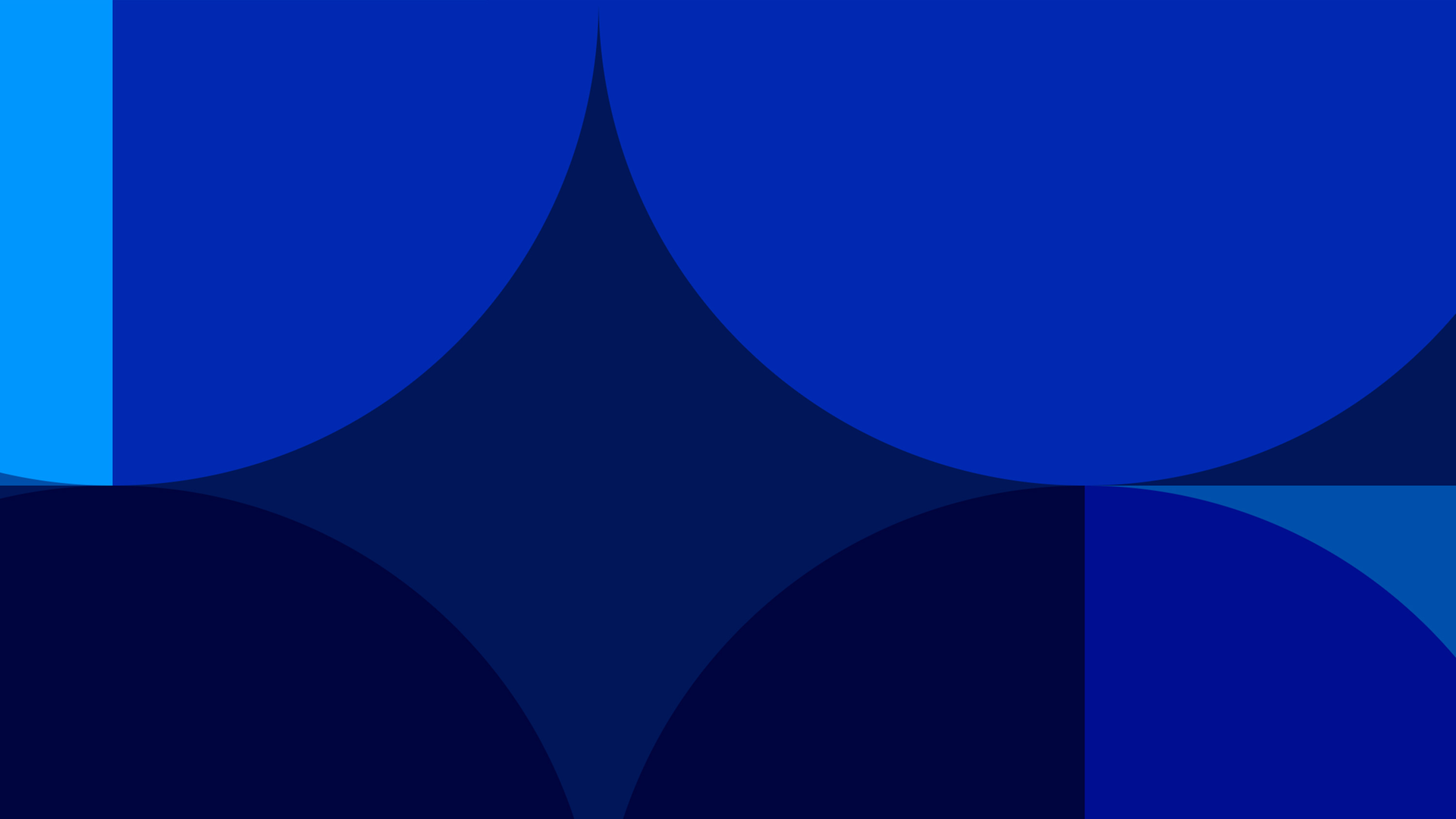Die Große Drüsenameise Tapinoma magnum ist winzig, schwarz und hat einen besonderen Geruch. Die invasive Art stammt aus dem Mittelmeerraum und wird zunehmend zum Problem: Selbst Spielplätze mussten bereits wegen Befalls geschlossen werden. Und die Bekämpfung der Insekten ist nahezu unmöglich.
Wann ist die Große Drüsenameise zum Problem in Deutschland geworden?
Zwar gibt es die Große Drüsenameise spätestens seit 2009 in Deutschland, doch erst seit gut zehn Jahren gilt sie Fachleuten als Problem. Damals begannen sich Kolonien zu entwickeln, die nicht mehr in den Maßstab von Nestern passen, wie wir sie von heimischen Ameisen kennen. Tapinoma magnum bildet sogenannte Superkolonien, die ganze Straßenzüge umfassen können. Heute ist die gesamte Rheinebene durchsetzt, und Nachweise reichen bis nach Hamburg und Dresden.
Dass die Große Drüsenameise so erfolgreich ist, liegt an zwei Entwicklungen: Zum einen ermöglicht ihr der Klimawandel, sich auch in Deutschland zu entwickeln. Zum anderen gedeihen hierzulande inzwischen mediterrane Pflanzen, die Händler aus dem Mittelmeerraum beziehen: Mit den Wurzelballen von Olivenbäumen oder Palmen gelangt die Ameise immer wieder nach Deutschland. Dass Fachleute die Ameise oft in der Nähe von Gartencentern oder Gewächshäusern finden, stützt diese Hypothese.
Was ist das Besondere an der Tapinoma magnum?
Tapinoma magnum unterscheidet sich grundlegend von heimischen Ameisen. Heimische Kolonien bestehen aus einer Königin und Tausenden Arbeiterinnen. Sie unterscheiden streng zwischen „eigen“ und „fremd“ und bekämpfen Nester anderer Ameisenarten. Tapinoma-Arbeiterinnen akzeptieren Ameisen ihrer eigenen Art – auch wenn sie von anderen Königinnen abstammen. Sie bilden vielmehr sogenannte Superkolonien mit Hunderten, Tausenden oder sogar Hunderttausenden Königinnen.
Tapinoma magnum ist eine invasive Ameise. Davon leben inzwischen 13 Arten in Deutschland. Diese Ameisenarten haben neben den Superkolonien weitere Eigenschaften, die sie besonders erfolgreich machen. Erstens fressen sie eigentlich alles. Haben sie ein totes Insekt, einen Regenwurm oder eine Blattlauskolonie entdeckt, rufen sie schnell weitere Arbeiterinnen herbei – schneller als die Konkurrentinnen aus den Kolonien heimischer Ameisenarten.
Zweitens: Kommt es zu Konflikten, bespritzt Tapinoma magnum fremde Ameisen mit ihrem Gift. Das ist eine wirksame chemische Waffe, denn es verschmilzt mit dem Chitinpanzer der anderen Ameise und tötet sie.
Drittens stellen die invasiven Ameisen Königinnen und Männchen möglichst sparsam her, sie verzichten auf Fettreserven und Flugmuskeln, die andere Arten ihren Geschlechtstieren mitgeben. Die brauchen sie auch gar nicht, denn die Königinnen lassen sich noch im mütterlichen Nest befruchten. Darum können sie auf den Hochzeitsflug und die Suche nach Männchen anderer Kolonien verzichten.
Dieses Verhalten wird möglicherweise genetisch abgesichert. Bei verwandten Arten fanden Fachleute ein „Supergen“ – eine Abfolge von Genen, die im Paket vererbt wird und dadurch Eigenschaften wie die Superkolonialität zuverlässig weitergibt. Auch für Tapinoma magnum erwarten Wissenschaftler ein solches genetisches Konstrukt. Sie sind überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es gefunden wird.
Wie erkennt man die Große Drüsenameise?
Wer die Ameise auf einem Gehsteig sieht, kann sie nur schwer von der heimischen Schwarzen Wegameise Lasius niger unterscheiden. Anders als die Namen Große Drüsenameise oder Tapinoma magnum vermuten lassen, sind die Arbeiterinnen dieser Art winzig: gerade einmal zwischen zwei und vier Millimeter groß. Wer genau hinschaut, erkennt, dass die größten Arbeiterinnen doppelt so lang sind wie die kleinsten. Wer einen Tropfen Zuckersirup auf ein weißes Blatt gibt und die Ameisen beim Fressen beobachtet, erkennt diese Unterschiede leicht.
Zerdrückt man eine Arbeiterin zwischen den Fingern, verströmt sie einen charakteristischen Geruch. Manche vergleichen den Duft mit Glasreiniger, andere mit ranziger Butter oder Nagellackentferner. Zudem treten sie in Massen auf und bilden breite Ameisenstraßen, die Mauern und Wege säumen. Diese Kolonnen können Häuser vollständig umrunden und wirken wie kleine Highways der Insektenwelt.
Äußerlich können sogar Fachleute Große Drüsenameisen nur mit aufwändigen Messungen mit teuren Mikroskopen zuverlässig von nahe verwandten Arten wie Tapinoma ibericum oder Tapinoma darioi unterscheiden, die ebenfalls zur Tapinoma-nigerrimum-Gruppe gehören. Die Tiere haben eine Art Hasenscharte, also eine Kerbe im Oberkiefer, die man unter dem Mikroskop erkennen kann. Für eine sichere Bestimmung setzen Fachleute Stereomikroskope ein, die bis zu tausendfache Vergrößerungen erlauben. An jedem Tier führen sie bis zu 28 Messungen durch, bestimmen etwa die Kopflänge oder die Anzahl ihrer Borsten. Erst diese mikroskopischen Details ermöglichen eine eindeutige Abgrenzung zu verwandten Arten. Die Arbeit ist mühsam: Rund eine Stunde dauert es, drei Tiere zu analysieren.
Für den Laien ist diese Unterscheidung aber zweitrangig, denn alle drei Arten sind invasiv, sie verhalten sich ganz ähnlich und können ähnliche Probleme verursachen.
Können Tapinoma-Ameisen bekämpft werden?
Eine Bekämpfung ist möglich, solange die Kolonien klein sind. Aber auch das ist nicht trivial. Lediglich die Stadt Zürich hat bislang Kolonien vollständig beseitigen können. Dort wurden Fraßköder, Gießmittel und weitere Präparate kombiniert, bis der Erfolg sichtbar wurde. Entscheidend ist die frühe Erkennung.
Ist die Kolonie einmal groß, sind die Chancen, sie zu bekämpfen, verschwindend gering. Verfehlt die Bekämpfung nur eine Königin, breiten sich die Ameisen aufs Neue aus. Fachleute sprechen von einem „Flächenbrand“, der sich ständig neu entzündet, wenn nicht restlos gelöscht wird.
Zudem sind in Deutschland bislang keine Gifte zum Einsatz gegen die Insekten im Freiland zugelassen. Die meisten Gemeinden und Schädlingsbekämpfer setzen auf heißes Wasser, das Woche für Woche aufs Neue eingesetzt werden muss.
Ist es nicht völlig normal, dass Arten sich ausbreiten?
Grundsätzlich ist Artenwanderung ein natürlicher Prozess. Doch die Geschwindigkeit, mit der sich heute Organismen über den Globus bewegen, ist beispiellos. Der internationale Handel transportiert Tiere und Pflanzen über Distanzen, die sie von selbst nie überwinden könnten. Der Klimawandel wiederum vertreibt viele Tier- und Pflanzenarten aus ihren angestammten Gebieten, eröffnet ihnen aber gleichzeitig oft neue Lebensräume.
In Deutschland gelten mittlerweile dreizehn Ameisenarten als invasiv, darunter neben Tapinoma magnum auch die Wegameise Lasius neglectus oder die Großkopfameise Pheidole pallidula. Weltweit sind es Hunderte. Diese Arten zerstören Ökosysteme, verdrängen Einheimische und verursachen hohe Kosten. Internationale Studien sehen in invasiven Arten eine der größten Bedrohungen für die Artenvielfalt, gleichauf mit der Zerstörung und Übernutzung von Lebensräumen und der Klimakrise.
Es ist also kein normaler, langsamer Anpassungsprozess, sondern ein massiver Umbruch, der ganze Ökosysteme destabilisieren kann. Tapinoma magnum ist ein Beispiel für diesen Trend: ein Tier, das durch Globalisierung und Klimawandel in kurzer Zeit von einer mediterranen Randerscheinung zu einem ernstzunehmenden Problem in Mitteleuropa geworden ist.