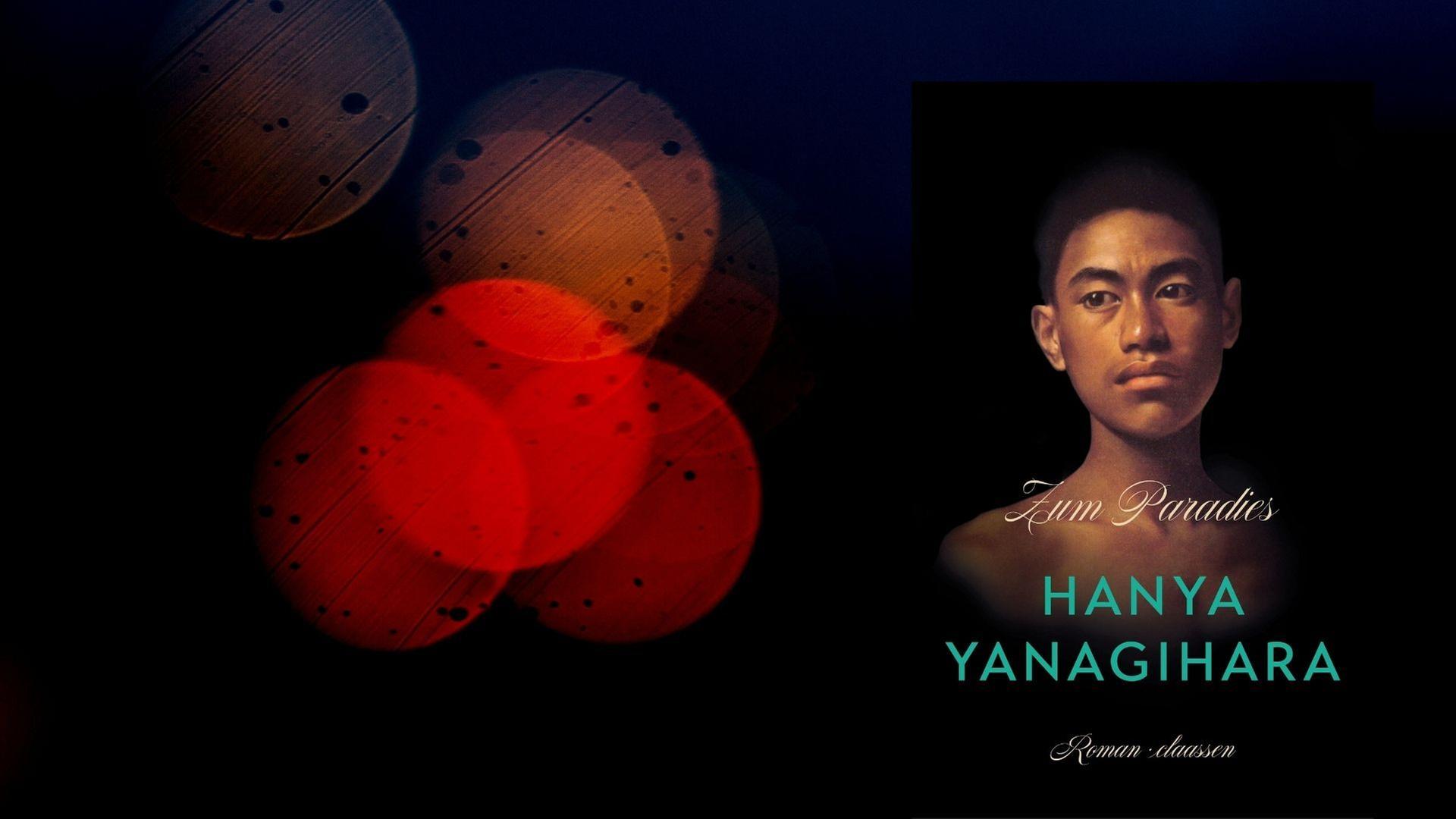
Als David Bingham von einem kleinen Abendspaziergang zurückkehrt, erwartet ihn im Haus am Washington Square, wo er mit seinem Großvater lebt, Besuch.
„Er stand vor den Türen zum Salon und fuhr sich mehrmals mit den Händen durchs Haar – eine nervöse Angewohnheit, so wie das wiederholte Glattstreichen seiner Stirnlocke, wenn er las oder zeichnete, oder das sanfte Hindurchziehen seines Zeigefingers unter der Nase, wenn er nachdachte oder beim Schachspielen wartete, bis er am Zug war, oder wann immer er Zeuge einer Darbietung wurde -, ehe er abermals seufzte und beide Türen zugleich aufstieß, mit einer Geste, die Selbstvertrauen und Überzeugung demonstrieren sollte, obgleich er beides selbstverständlich nicht besaß. Sie sahen geschlossen zu ihm herüber, aber unbeteiligt, weder erfreut noch bestürzt, ihn zu sehen.“
Davids Schwester Eden und sein Bruder John sind da. Er…
„… schüttelte ihm und seinem Ehemann Peter die Hand; er küsste zuerst seine Schwester und dann ihre Ehefrau Eliza auf die rechte Wange.“
Die gleichgeschlechtliche Ehe wurde in den USA erst 2015 eingeführt. Die Begrüßungsszene spielt jedoch 1893 in einer fiktiven Version der Geschichte Nordamerikas. Darin ist einiges anders als man es aus Geschichtsbüchern kennt.
„Vor dem Krieg hatten die Südstaaten den Freistaaten zwar ablehnend gegenübergestanden, ihren Bürgern jedoch das Recht auf landesweite Freizügigkeit eingeräumt. Nach dem Krieg und der darauffolgenden Abspaltung von der Union aber durften die Menschen nicht mehr in den nun in Vereinigte Kolonien umbenannten Süden und die Kolonisten nicht mehr in den Norden reisen“.
Amerika in zwei Teile gespalten
Der amerikanische Bürgerkrieg liegt 1893 - wie in der historischen Realität – knapp drei Jahrzehnte zurück. Aber die politische Lage, die er hinterlassen hat, ist im Roman eine andere. Es gibt zwei Staatengebilde: Den autoritären Süden und die sogenannten Freistaaten des Nordens, zu denen New York gehört. Dazwischen verläuft eine militärisch befestigte Grenze. Flüchtlinge, die versuchen, aus dem Süden in den liberalen Norden zu entkommen, riskieren ihr Leben.
„Man hörte fürchterliche Geschichten von abgebrochenen Versuchen: Kindern, die schreiend von ihren Eltern fortgerissen und, so hieß es, als Knechte an eingesessene Familien verkauft wurden; Frauen, die von ihren Ehemännern getrennt und zur Wiederheirat gezwungen wurden; Gefangenschaft; Tod.“
Dass ihr das Reglement des literarischen Realismus zu eng ist, hat Hanya Yanagihara bereits mit ihrem internationalen Bestseller „Ein wenig Leben“ bewiesen. Aus einem amerikanischen Sittenbild ließ sie eine Märtyrergestalt hervorgehen, deren extreme Überzeichnung ins Mythische ragt. Der suggestiven Wirkung ihres hochemotionalen Erzählstils konnten sich auch jene Kritiker nicht entziehen, die eine Tendenz zum Leidenspathos bemängelten. Eine bescheidene Autorin ist Hanya Yanagihara in der Tat nicht. Ihr neuer Roman „Zum Paradies“ hat nicht weniger als 900 Seiten und besteht aus drei eigenständigen, „Büchern“ genannten Teilen. Im letzten entwirft sie eine Dystopie am Ende des 21. Jahrhunderts. Der mittlere spielt in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Und der erste blendet zurück ins Jahr 1893. Allen gemeinsam ist der Name eines Protagonisten, David Bingham, und der Schauplatz: Das Haus am Washington Square.
„‘Ich habe ein Angebot erhalten, dich zu verheiraten‘, sagte sein Großvater schließlich in das Schweigen hinein. ‚Eine gute Familie – die Griffiths aus Nantucket. Natürlich haben sie als Schiffsbauer begonnen, aber nun haben sie ihre eigene Flotte und auch einen kleinen, aber ertragreichen Pelzhandel. Der Vorname des Gentlemans lautet Charles; er ist Witwer. Seine Schwester – ebenfalls Witwe – lebt mit ihm zusammen und zieht ihre drei Söhne gemeinsam mit ihm auf. Er verbringt die Handelssaison auf der Insel und lebt im Winter auf dem Kap. Ich kenne die Familie nicht persönlich, aber sie haben eine sehr respektable Stellung – sie beteiligen sich recht eifrig an der örtlichen Regierung, und Mister Griffith Bruder, mit dem seine Schwester und er das Geschäft betreiben, ist der Vorstand der Handelsgesellschaft. Es gibt noch eine weitere Schwester, die im Norden lebt. Mister Griffith ist der Älteste; die Eltern leben noch – es waren Mister Griffiths Großeltern mütterlicherseits, die das Geschäft gegründet haben. Frances hat das Angebot über ihren Anwalt erhalten.‘“
„Washington Square“, ein Ort der Literaturgeschichte
David Bingham, den im Leben nicht viel mehr erwartet als ein großes Erbe und melancholisch verbummelte Tage, soll nach dem Willen seines Großvaters unter die Haube. Zwar sind im fiktiven Freistaat New York gleichgeschlechtliche Ehen 1893 an der Tagesordnung, die Heiratspolitik der Upper Class entspricht jedoch durchaus den historisch verbürgten Verhältnissen. Nicht zufällig wählt Yanagihara den Washington Square als Ort der Erzählung. Es ist der Titel eines Klassikers des 19. Jahrhunderts, „Washington Square“ von Henry James, der die Liebestragödie einer Junggesellin aus reichem Haus erzählt. Wie sie verliert auch David sein Herz an einen berechnenden Schönling und ist durch keinen Gegenbeweis von der Überzeugung abzubringen, aus echter Liebe umworben zu werden. Von der arrangierten Ehe mit Charles will er nichts wissen.
„Er war ein Mann, der Edward Bishop liebte, und er tat, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, etwas, was er wollte, etwas, was ihn ängstigte, aber etwas, das ihm gehörte. Vielleicht war seine Entscheidung töricht, aber er traf eine Entscheidung. Er streckte den Arm nach unten aus; er schob die Finger durch den Griff des Koffers; er schloss die Hand darum; er stand auf. ‚Leb wohl‘, flüsterte er. ‚Ich liebe dich Großvater.‘“
David verlässt das Haus am Washington Square für immer, der Leser kehrt schon auf der nächsten Seite zurück. Im zweiten Romanteil wird das Haus - wir sind nun im Jahr 1993 - von einem wohlhabenden Juristen namens Charles und seinem jungen Geliebten David bewohnt. Auch ein gewisser Edward wird erneut auftauchen. Nur Männer? Ja, nur Männer. „Zum Paradies“ ist überwiegend ein Männerroman und Hanya Yanagihara das, was man als Männerschriftstellerin bezeichnen könnte. Schon in „Ein wenig Leben“ waren sämtliche Hauptfiguren männlich. Natürlich gehört es zu den poetischen Freiheiten eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin - wie die Vorliebe für eine bestimmte Region oder ein Milieu – ein Geschlecht zu bevorzugen. Man kann sich aber durchaus fragen, wie das Werk eines männlichen Autors aufgenommen würde, dessen Interesse an lesbischen Paaren so stark überwiegt wie das von Hanya Yanagihara an schwulen.
„Ja, Charles´ prüfender Blick auf sich selbst war das Ergebnis der Eitelkeit und Unsicherheit der mittleren Jahre, aber er war, wie David wusste – wusste, aber zu ignorieren versuchte -, auch ein Ausdruck von Charles´ Angst: Nahm er ab? Verloren seine Fingernägel an Farbe? Bekam er hohle Wangen? Hatte er offene Wunden? Wann würde sich die Krankheit in seinen Körper einschreiben? Wann würden es die Medikamente tun, die die Krankheit bislang auf Abstand gehalten hatten? Wann würde er ein Einwohner im Land der Kranken werden? Es totzuschweigen, war töricht, und doch taten es beide, solange es nicht verhängnisvoll war, es zu tun. Charles schwieg, und David ließ es zu. Oder war es David, der schwieg, und Charles, der es zuließ? In jedem Fall war das Ergebnis dasselbe: Sie redeten selten über die Krankheit; nicht einmal ihren Namen sprachen sie aus.“
Die Rede ist von Aids. Die Seuche wütet zu Beginn der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts in den amerikanischen Metropolen. Charles gibt im Haus am Washington Square ein Abschiedsfest für einen todkranken Freund, an dem selbstverständlich auch der junge David teilnimmt. Aber er fühlt sich als Fremdkörper in den bourgeoisen Kreisen des Hausherrn. Äußerlich getrennt durch seine Mittellosigkeit und den Altersunterschied, innerlich durch die Geschichte seiner hawaiianischen Herkunft und seines Vaters, die er sogar Charles verschweigt.
„Manchmal hatte er das Gefühl, seine Kindheit erneut zu durchleben. Diesmal mit Charles als seinem Vater, und dann wurde ihm übel, weil Charles nicht sein Vater war; er war sein Liebhaber. Doch das Gefühl blieb – da war jemand, der ihm erlaubte, der Gegenstand von Besorgnis zu sein und niemals der Besorgte“.
Der hawaiianische Vater
Mit der Einführung von Davids Vater verändern sich im zweiten Romanteil schlagartig Szenerie und Erzählstimme. Über mehr als 100 Seiten kommt nun der Vater zu Wort, der in einer psychiatrischen Anstalt auf Hawaii verdämmert. In seinen Halluzinationen spricht er zu seinem Sohn, den er zehn Jahre nicht gesehen hat und nie mehr sehen wird. Es ist die innere Rede eines Sterbenden, der sein Leben rekapituliert.
„Mein Sohn, mein Kawika – was machst Du dieser Tage? Ich weiß, wo Du bist, weil Mama es mir gesagt hat: In New York. Aber wo in New York, frage ich mich? Und was machst Du dort? Sie sagte, Du würdest in einer Anwaltskanzlei arbeiten, allerdings nicht als Anwalt, aber glaube nur nicht, ich wäre deswegen weniger stolz auf Dich. Ich war einmal in New York, wusstest Du das? Ja, es stimmt, Dein Papa hat selbst ein paar Geheimnisse.“
Spätestens jetzt, mit dem langen Exkurs in die Geschichte Hawaiis - seiner Annexion durch die Vereinigten Staaten, seines kulturellen Identitätsverlustes und der Unabhängigkeitsbestrebungen der indigenen Bevölkerung -, stellt sich die Frage nach der Zielrichtung des Romans. Er lehnt sich an die Form der Great American Novel an, des großen amerikanischen Epos. Aber Hanya Yanagihara, die selbst hawaiianischer Abstammung ist, füllt die Form mit einer Gegenerzählung, sie beleuchtet die Schattenseiten amerikanischer Fortschritts- und Freiheitsutopien.
„Ich verübelte mir meine Herkunft. Ich verfluchte meine Schule, die Generationen von Binghams besucht hatten, dafür, dass sie mich nicht besser vorbereitet hatte. Was hatte ich dort Nützliches gelernt? Ich hatte die gleichen Fächer wie meine Kommilitonen gehabt, aber wie es schien, hatte das Lernen der hawaiianischen Geschichte und einiger Bruchstücke der hawaiianischen Sprache einen Großteil meiner Ausbildung in Anspruch genommen, wobei ich letztere nicht einmal beherrschte. Wie sollte mir dieses Wissen nützlich sein, wenn der Rest der Welt sich schlicht nicht dafür interessierte? Ich traute mich nicht zu erwähnen, wer meine Familie war – ich spürte, dass die eine Hälfte von ihnen mir nicht glauben und die andere Hälfte mich verspotten würde.“
Davids Vater, ein lebensschwacher und psychisch kranker Mann, ist in der Romanfiktion der direkte Nachfahre der letzten Königsfamilie von Hawaii, die der Amerikanisierung des Inselstaates zum Opfer fiel. Er gerät in die Fänge eines paranoiden Unabhängigkeitskämpfers mit Namen Edward, der von der Utopie eines hawaiianischen Urstaates träumt.
Utopie und Verblendung
„Als erstes änderten wir unsere Namen. Das war 1978, ein Jahr ehe wir fortgingen. Er hatte seinen schon ein Jahr zuvor geändert. Zuerst war er Ekewaka geworden, die hawaiianisierte Form von Edward.
Als zweites errichtet Edward an einem abgelegenen Küstenstück sein persönliches Hawaii, das von drei Menschen bewohnt wird: Ihm, dem zehnjährigen David und dessen infantil verblendetem Vater. Über Jahre hinweg haust der Junge mit den beiden Männern in einem erbärmlichen Zeltlager fern der Zivilisation, unter Edwards despotischem Regime.
„Als Edward uns am frühen Freitagabend weckte, um einen Sprechgesang anzustimmen, machtest Du mit, und als er sagte, dass wir drei von diesem Tag an gemeinsam Hawaiianisch lernen würden, sahst Du mich an, und als ich nickte, zucktest Du ergeben mit den Schultern. ‚Okay‘, sagtest Du. ‚Ae‘, verbesserte er Dich streng, und Du zucktest wieder mit den Schultern. ‚Ae‘ wiederholtest Du. Die meiste Zeit über warst Du undurchschaubar, aber ich sah, wie Verwunderung und auch Belustigung über Dein Gesicht glitten. Erwartete Edward WIRKLICH, dass Du Dir Dein Essen selber im Meer fingst? Solltest Du WIRKLICH lernen, es über dem Feuer zu braten? Sollten wir WIRKLICH um acht Uhr abends schlafen gehen, damit wir bei Morgengrauen aufwachen konnten?“
In der Gestaltung solcher Szenerien erweist sich Yanagiharas Stärke: Das Phantastische als Realität, ob es sich um Männerehen am Ende des 19., oder um einen absurden hawaiianischen Miniaturstaat im 20. Jahrhundert handelt. Davon abgesehen ist sie nicht nur eine mitreißende Erzählerin, sondern auch eine souveräne Romanarchitektin. „Zum Paradies“ gleicht einem verwinkelten Gebäudekomplex, in dem man sich überraschend leicht zurechtfindet. Das Problem dieses Monumentalwerks steckt nicht in seinen Teilen und sprunghaften Übergängen. Es ergibt sich aus dem Ganzen, das offenkundig auf eine Art kritische Geschichtsphilosophie hinauswill. Buch eins befasst sich mit dem reaktionären Erbe der amerikanischen Südstaaten, Buch zwei mit dem US-Imperialismus. Das dritte und letzte Buch indes entfaltet auf 400 Seiten das Schreckensbild einer dystopischen Zukunft. Durch die Gesamtkonstruktion lässt sich diese nicht anders verstehen denn als logische Konsequenz der vorangegangen politischen Vergehen. Dieses Deutungsmodell aber ist zugleich überambitioniert und schlicht.
Amerika nach unserer Zeit
„Nach meiner Krankheit hatte ich keine schönen Haare mehr. Niemand von uns Überlebenden hat das. Es lag an den Medikamenten, die wir nehmen mussten: Erst fielen uns alle Haare aus, und als sie nachwuchsen, waren sie flaumig und dünn und staubfarben, und man konnte sie nicht länger als bis zum Kinn wachsen lassen, sonst brachen sie ab. Vielen Überlebenden der Krankheiten von `50 und `56 war das gleiche passiert, aber bei uns Überlebenden von `70 war es schlimmer. Eine Zeitlang konnte man daran erkennen, wer die Krankheit überlebt hatte, aber dann wurde eine Variante des Medikaments für die Krankheit von `72 verschrieben, und dann ließ es sich schwerer auseinanderhalten, und es war auch einfach praktischer, kurze Haare zu haben: Es war weniger heiß, und man brauchte weniger Wasser und Seife, um sie zu waschen. Deswegen haben heute viele kurze Haare – man braucht Geld, wenn man sie lang tragen will. Daran kann man erkennen, wer in Zone Vierzehn lebt; dort haben sie alle lange Haare, denn jeder weiß, dass Zone Vierzehn dreimal so viel Wasser bekommt wie die Zone mit der zweithöchsten Wasserzuteilung, nämlich unsere, Zone acht.“
Wir sind im Jahr 2094. Amerika wird von Virusepidemien und Klimakatastrophen heimgesucht. Eine Ordnungs- und Überwachungsdiktatur regelt und beherrscht das Leben der Menschen. Jede ihrer Handlungen wird protokolliert.
„Man konnte im Zentrum auch eine Luftdusche nehmen, und manchmal, wenn ich mich nach Sauberkeit sehnte und noch kein Wassertag war, verwendete ich meine Zeit im Zentrum für eine Luftdusche. Man kam auch für die jährlichen Impfungen ins Zentrum und für das zweiwöchentliche Blutbild und die Schleimhautabstriche und um seine monatlichen Lebensmittelcoupons und Zuteilungen und von Mai bis September die die drei Kilo Eis abzuholen, die jeder Einwohner einmal im Monat zu einem reduzierten Preis kaufen durfte.“
Von der einstmals versprochenen Freiheit Amerikas ist nicht das Geringste mehr übrig, jederzeit müssen die Einwohner New Yorks mit Kontrollen und Wohnungsdurchsuchungen rechnen.
„Dann waren sie fertig, und die beiden Männer und der Hund kamen aus dem Schlafzimmer, und einer von den Männern sagte ‚Sauber‘ zu dem Mann an der Tür und ‚Signatur‘ zu uns, und wir drückten beide den rechten Daumen auf das Display, das er uns hinhielt, und sagten unsere Namen und Identifikationsnummern in das Mikrofon des Scanners, und dann gingen sie, und wir sperrten die Tür hinter ihnen ab.“
Die Ich-Erzählerin arbeitet als Assistentin in einem Labor für biochemische Forschung. Ihr Alltag verläuft so monoton, ja fremdgesteuert wie ihre Ehe - als wären zwei Roboter verheiratet worden. Doch eines Tages entsteht ein Riss im mechanischen Dasein der jungen Frau. In einer Schrankschublade findet sie Zettel mit mysteriösen Botschaften, die offensichtlich an ihren Mann gerichtet sind. Nach allgemeinem Reglement dürfen die Eheleute pro Woche einen Abend allein verbringen. An einem dieser freien Abende folgt die Ich-Erzählerin heimlich ihrem Mann und beobachtet, wie er ein fremdes Haus betritt.
„‘Du bist spät dran heute‘, hörte ich jemanden sagen, einen Mann, bevor sich die Tür wieder schloss. Und dann war er fort. Nachdem ich fünf Minuten abgewartet hatte, ging ich selbst die Treppe hinauf und drückte ein Ohr an die Tür, die mit abblätternder schwarzer Farbe bedeckt war. Ich lauschte und lauschte. Aber da war nichts. Es war, als wäre mein Mann verschwunden – nicht in ein Haus, sondern in eine vollkommen andere Welt.“
Ein Briefwechsel im späten 21. Jahrhundert
Hat er einen Geliebten? Gehört er einer Untergrundorganisation an? Handlungsstränge mit der Spannung eines Thrillers aufzuladen, auch diese Technik beherrscht Hanya Yanagihara. Der dritte Romanteil beschränkt sich jedoch nicht auf die Geschichte des Ehepaares und die Aufdeckung der geheimnisvollen Aktivitäten des Mannes. Immer wieder springt er aus dem Jahr 2094 zurück in den Briefwechsel zweier Männerfreunde aus den Jahren 2054, 2064 und 2088. Dieser Briefwechsel ist nicht nur etwas langatmig, man fragt sich auch, warum es ihn überhaupt gibt und welche Funktion er hat. Er referiert Schritt für Schritt die Entwicklung der zunehmenden Verdüsterung Amerikas im 21. Jahrhundert, mitsamt Kriegen, Epidemien, Klimakatastrophen und autokratischen Regierungen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Zukunft tatsächlich genauso aussieht, für manchen lässt sie sich an drei Fingern aus den Nachrichten unserer Tage hochrechnen. Aber die phantastische Zukunftsschau des Romans verengt sich dabei zur mäßig originellen Alarmbotschaft. Es wirkt, als müsse sich Hanya Yanagihara für die Rolle der Kassandra ein wenig verbiegen. Das Talent dieser hochemotionalen Erzählerin liegt eher auf dem Gebiet der Psyche. So ist „Zum Paradies“ über weite Strecken ein bannender wie interessanter Roman – makellos ist er nicht.
Hanya Yanagihara: „Zum Paradies“
aus dem Englischen von Stephan Kleiner
Claassen Verlag, Berlin. 895 Seiten, 30 Euro.
ab 11.01.2022 im Buchhandel
aus dem Englischen von Stephan Kleiner
Claassen Verlag, Berlin. 895 Seiten, 30 Euro.
ab 11.01.2022 im Buchhandel

