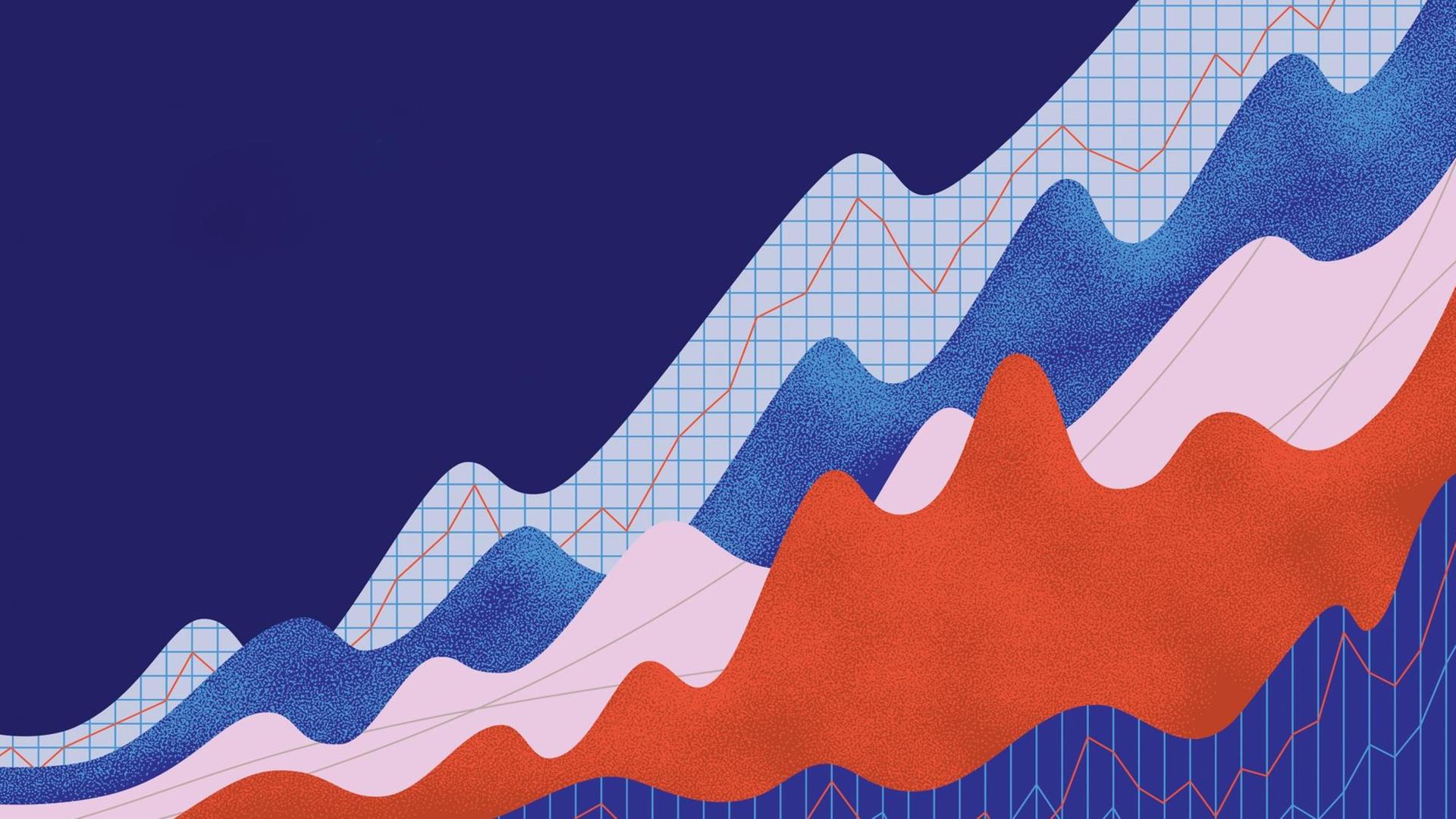Unvermittelt kam die grenzenlose Mobilität nahezu zum Stillstand, die eben noch als ein Ideal in der globalisierten, offenen Welt gegolten hatte. Vielleicht verspürten nun Gestrandete zum ersten Mal Heimweh, als ungewiss war, ob und wann eine Heim- oder Weiterreise möglich sein würde? Und dann schien es, als ob viele ihre Heimat zum ersten Mal bewusst wahrnähmen und eine stärkere Bindung an sie entwickelten.
Und dann das Unheimliche: die paradoxen Erfahrungen mit leeren Städten und abgebrochenen Sozialkontakten, in einer für viele neuen digitalen Arbeits- und Bildungswelt. Konnten nun endlich große Teile der Gesellschaften ihre Heimat im Digitalen finden, als könnte Heimat bald tatsächlich dort sein, „wo sich das WLAN automatisch verbindet”? Susanne Scharnowski ordnet in ihrem Essay die vielen Fragen, die der Begriff Heimat in Pandemie- und Krisenzeiten stellt.
Die Literaturwissenschaftlerin Susanne Scharnowski ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU Berlin und war DAAD-Lektorin für deutsche Sprache an Universitäten in Cambridge, Melbourne und Taipeh.
Die Coronakrise ist nicht nur die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch das einschneidendste disruptive Ereignis seit dem 11. September 2001. Das aus dem Englischen übernommene Wort Disruption bedeutet Störung, Unterbrechung, Bruch oder Riss und bezeichnet ein Ereignis, in dessen Folge vertraute Gewohnheiten, Einrichtungen, Verfahren und Verhaltensweisen sich tiefgreifend und oftmals irreversibel verändern.
Heimat veränderte sich bis zur Unkenntlichkeit
Und in der Tat: Die nahezu in allen Staaten verhängten Maßnahmen gegen die Pandemie führten weltweit zu radikalen Veränderungen der Lebensweise, die nur wenige Wochen zuvor für die meisten vollkommen unvorstellbar gewesen wären: Die Bewegungsfreiheit wurde durch Einreiseverbote, Ausgangs- und Kontaktsperren drastisch eingeschränkt, Flüge wurden gestrichen, Schulen, Universitäten, Büros, Geschäfte, Kinos, Theater, Bibliotheken, Restaurants, Cafés, Hotels, Sportstadien, Schwimmbäder, Clubs, Museen und Konzertsäle geschlossen. Wer konnte, arbeitete vom Homeoffice aus, betreute außerdem vielleicht auch Kinder im Home‑Schooling. Alltag, Nahumgebung und vertraute Lebenswelt, kurz: die Heimat, veränderten sich bis zur Unkenntlichkeit. Verwaiste Städte mit ihren verlassenen Straßen, leeren Bussen und Bahnen und geschlossenen Läden wirkten fremd, fast schon unheimlich. Alltägliche Handlungen wie der Einkauf im Supermarkt wurden zur Belastung.
Durch den unerhörten Imperativ des Distanzhaltens waren Familie und Freunde – für viele Menschen ein wesentliches Element ihrer Heimat – wochenlang außer Reichweite: Alte und kranke Angehörige konnten nicht besucht werden, von Sterbenden konnte man sich nicht verabschieden, selbst Trauerfeiern waren untersagt. Durch die Einführung der Pflicht, eine Gesichtsmaske zu tragen, wurden die verbleibenden sozialen Kontakte und Begegnungen erschwert. Heribert Prantl hat in der "Süddeutschen Zeitung" vor allem diese Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen als Entheimatung bezeichnet:
"Corona ist Entheimatung. Corona hat eine andere Beziehung zu den Mitmenschen hergestellt; die sind eine potentielle Gefahr; man geht daher auf Abstand zu ihnen, man schützt sich vor ihnen, man begegnet ihnen mit Maske, man vermeidet Kontakt, sei es beim Einkaufen, beim Wandern im Wald oder beim Joggen im Park. Wenn einer an der Supermarktkasse zu nahe an uns herantritt, werden wir nervös. Und man selbst spürt böse Blicke, wenn man sich auf Unbekannte zubewegt."
Plötzlich auf das Zuhause zurückgeworfen
Zwar waren die Menschen wie selten zuvor an ihre Wohnung, ihren Wohnort, ihr engstes Lebensumfeld gebunden, doch war diese Lebenswelt kaum noch wiederzuerkennen. Die Erfahrung, plötzlich auf das Zuhause zurückgeworfen zu sein, war um so ungeheuerlicher, als bis zu diesem Zeitpunkt das Ideal einer grenzenlosen und global vernetzten Welt gegolten hatte, in der die Menschen sich weitgehend ungehindert bewegen können und in der es normal sein sollte, dass Menschen nicht dauerhaft in dem Land ihrer Herkunft leben müssen oder überhaupt an einem Ort zuhause sind. Digitalnomaden waren die emblematischen Figuren dieser neuen Zeit. Die Journalistin Julia Wadhawan widmete ihnen 2016 in der "Zeit" ein Porträt:
"Die Reisenden gehören zu einer wachsenden Gruppe von Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt verschieben wie andere ihre Zimmerpflanzen. Sie bezeichnen sich als multilokal und ortsunabhängig, sie nennen sich: Digitalnomaden. [...] Sie reisen umher wie Bürger eines Weltstaates; auf der Suche nach Abenteuern lassen sie ihre Heimat zurück. Das Leben ist zu kurz, um es im Büro zu verbringen."
Janusgesicht der Pandemie
Heimat als einzigartiger Ort mit einer besonderen Geschichte und mit unverwechselbaren Merkmalen, zu dem man eine tiefe, emotionale und dauerhafte Beziehung hat, war in dieser Welt obsolet. Heimat, da war man sich einig, war ein individuelles, subjektives, privates Gefühl. Sätze wie "Meine Heimat ist in mir selbst" oder "Ich kann überall zuhause sein" wurden fast schon zu Allgemeinplätzen. Doch die Vorstellung, dass den mobilen Menschen des 21. Jahrhunderts die ganze Welt offenstehe, wurde jäh unterbrochen und verlor zudem abrupt ihren Glanz, als im Zuge der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus immer mehr Staaten ihre Grenzen schlossen und Heimflüge für ihre Bürger organisierten, um zu verhindern, dass Reisende das Virus weiterverbreiteten.
Die Pandemie hatte ein Janusgesicht. Einerseits war sie ein weltumspannendes Ereignis, das demonstrierte, wie vernetzt die Welt war: Nicht nur das Coronavirus und die Furcht vor ihm verbreiteten sich auf der ganzen Welt, auch die politischen Maßnahmen waren weltweit vergleichbar. So betonten deutsche und europäische Politiker immer wieder, das Virus kenne keine Grenzen. Und doch kam es durch die Pandemie zu einer Renaissance der Grenze: Grenzen von National- oder Bundesstaaten, von Kommunen und Städten legten fest, bis zu welcher Linie bestimmte Regeln gültig waren und definierten nun wieder scharf die Verbindung von Territorien und Bewohnern.
Viele mussten sich für einen Aufenthaltsort entscheiden
Weltweit wurden Varianten des Satzes "Wir bleiben zuhause" zu Schlagworten und Hashtags. Nun galt es, sich festzulegen: alle mussten einen Aufenthaltsort wählen – den, an dem sie sich gerade aufhielten, oder einen, an den sie zurückkehren wollten, für wie lange, das war vollkommen ungewiss. Nicht nur die Digitalnomaden, sondern auch zahllose andere Menschen, die nicht in ihrem Heimatland leben – Expats, Austauschstudierende und andere Migranten – standen jetzt vor der Frage, wo sich eigentlich dieses 'Zuhause' befindet, an dem sie sich aufhalten sollten. Der bisherige Luxus, 'Heimaten' im Plural zu besitzen, verwandelte sich in eine Herausforderung. Die Vorstellung, ohne großen Aufwand multiple Heimaten bewohnen zu können, erwies sich für den Moment als Illusion.
In seinem eben erschienenen Buch über die Coronakrise "Ist heute schon morgen? Wie die Pandemie Europa verändert" beschreibt der Politologe Ivan Krastev die Implikationen dieser Disruption:
"Wir alle wissen instinktiv, dass in einem Moment größter Gefahr der Impuls da ist, die Schließung der Staatsgrenzen zu akzeptieren. […] Und die Menschen suchen nicht nur Zuflucht in ihrem Heimatland, sondern auch in ihrer Muttersprache. […] Die Aufforderung, 'zu Hause zu bleiben', hat die Menschen ermutigt, ihr Zuhause nicht nur pragmatisch zu definieren – als den besten Ort, um dort zu leben und zu arbeiten –, sondern auch metaphysisch. Das Zuhause ist der Ort, an dem wir uns in einer Zeit großer Gefahr am liebsten aufhalten möchten."
Verbundenheit plötzlich wichtiger als Selbstentfaltung
Es hatte also den Anschein, als würde durch die Krise Heimat nicht mehr allein als frei flottierendes Gefühl, sondern als spezifischer Ort wieder relevant, einerseits deshalb, weil sich viele überhaupt die Frage stellten, an welchem Ort sie sich in Zeiten großer Gefahr am liebsten aufhalten wollten, andererseits aber auch, weil das 'Zuhausebleiben' nun ein Akt der Solidarität und Rücksichtnahme war. Verbundenheit, Empathie und Fürsorge wurden in dieser Krise wichtiger als Selbstentfaltung, grenzenlose Freiheit und individuelle Mobilität.
Die Historikerin Ute Frevert beobachtete im Mai, dass "die große Mehrheit der Bevölkerung sich in diesen sechs Wochen in der Tat […] in einer Weise rücksichtsvoll, solidarisch und empathisch benommen hat, zueinander gefunden hat, wie ihr das viele auch nicht mehr zugetraut haben."
Schon zuvor war der Ortsbezug wiederholt als relevanter Faktor in einer zunehmend fragmentierten und individualisierten Gesellschaft und als Bedingung für die Entwicklung von Verantwortungsgefühl und für gemeinsames politisches Handeln beschrieben worden. In ihrer 1985 erschienenen Studie über Ortsverbundenheit und Lebensqualität konstatierte Waltraud Schmied: "Ortsverbundenheit dürfte eine Bedingung des Verantwortungsgefühls der Menschen für einen Ort und für die Bereitschaft zu Partizipation und Engagement sein."
Renaissance des Ortes
Die Coronakrise bot die Gelegenheit, sich intensiver mit dem Aufenthaltsort auseinanderzusetzen, die Bindung an ihn zu vertiefen, ein Gefühl der Zugehörigkeit und Identifikation zu entwickeln und den Wohnort tatsächlich als Heimat zu erleben: Die eingeschränkte Mobilität brachte es mit sich, dass viele Menschen vielleicht zum ersten Mal ihre Stadt oder ihren Stadtteil und dessen Geschichte erkundeten und bewusst wahrnahmen, ihre Nachbarn näher kennenlernten oder ein Interesse für heimische Landschaften und die Natur entwickelten – wobei sie allerdings auch sehen konnten, dass viele der Bäume in ihrer unmittelbaren Umgebung durch die Dürre der letzten Jahre stark geschädigt waren. Der Architekt Hans Kollhoff äußerte in einem Interview die Hoffnung, dass aus dieser Renaissance des Ortes auch eine Erneuerung der Städte erwachsen könnte:
"Was mir Hoffnung macht, ist die zunehmende Identifikation der Menschen mit ihrem Zuhause – und dass daraus endlich ein neuer Qualitätsanspruch am eigenen Wohnort erwächst. Dann muss man vielleicht nicht mehr massenweise in den Urlaub flüchten und mit Billigflügen fremde Länder überfallen und deren Charme verbrauchen. Man wird in Zukunft mehr darauf achten, dass es zu Hause schön ist."
Wie wichtig die Ortsbindung für die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls und damit auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, betont auch die Psychologin Bettina Wyss: "Ortsbeziehungen, also das Gefühl von Verbundenheit, Sicherheit und Wohlbefinden, das ein Ort vermittelt, [sind] gerade in der heutigen Zeit wichtig, wo Individualisierung und Globalisierung zur Anonymisierung in den Städten und dem Abnehmen von nachbarschaftlichen Beziehungen führen können."
Die Krise führte dazu, dass der Ort als Bezugspunkt und Heimat nicht mehr mit Enge und Spießigkeit konnotiert wurden. So plädiert der Benediktinermönch Anselm Grün für die "stabilitas loci", die Beständigkeit, Stabilität oder eben: Ortsgebundenheit der Benediktiner als Leitbild in der Krise.
In der "Süddeutschen Zeitung" konstatierte Astrid Becker verblüfft: "'Heimat' ist gar nicht so nervig wie gedacht"; Zeitungsberichte beschrieben, wie die so reisefreudigen Deutschen, von denen viele zum ersten Mal Ferien zuhause machten, Schönheit vor der Haustür entdeckten und "überrascht" waren, "was dieses Land zu bieten hat".
Durch den Urlaub in der Heimat oder durch den Kauf von Gutscheinen mit Namen wie "Heimatpräsent" konnte man seine Verbundenheit mit dem Heimatort zum Ausdruck bringen, gefährdete Gaststätten, Hotels und Geschäfte unterstützen und der befürchteten Verödung der Innenstädte etwas entgegensetzen. Vielleicht begann der eine oder die andere auch damit, die vertrocknenden Straßenbäume zu wässern.
Möglicherweise lag hier der Keim einer Wende hin zu einer "achtsamen Glokalisierung", die manche als Folge der Coronakrise für möglich hielten. Eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann-Stiftung im Sommer 2020 schien diese Tendenz zu bestätigen und kam zu dem Ergebnis, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt, das "Wir"-Element der Zugehörigkeit, durch die Krise gestärkt worden war:
"Die Menschen in Deutschland bewerten den gesellschaftlichen Zusammenhalt nach dem ersten Höhepunkt der Corona-Pandemie positiver als noch Anfang des Jahres. […] Ebenso nahm der Eindruck ab, die Bürger:innen würden sich nicht um ihre Mitmenschen kümmern."
Krise wird sehr unterschiedlich wahrgenommen
Doch bei genauerem Hinsehen zeigte sich, dass das Bild vielschichtiger war: Die Krise wurde je nach Wohnort, Alter, familiärer, beruflicher, sozialer und materieller Situation sowie psychischer Disposition äußerst unterschiedlich erlebt und bewertet. Noch einmal die Studie der Bertelsmann-Stiftung:
"Wer vorher ökonomisch schlechter gestellt war oder sich in prekären Lebenslagen befand, hat auch in der Corona-Zeit größere Lasten zu tragen, sowohl was die objektive Betroffenheit angeht als auch die subjektiv empfundenen Sorgen."
Anders gesagt: In einem Haus mit Garten fällt es leichter, zuhause zu bleiben, als in einer Zweizimmerwohnung in der Satellitenstadt. Man ist optimistischer und gelassener, wenn das Gehalt weiter gezahlt wird, als wenn man nicht weiß, ob man im Dezember noch seine Miete bezahlen kann. Ein Home-Office ist komfortabler, wenn es nicht nur aus einem Küchentisch besteht. Für sozial aktive junge Leute sind die Einschnitte gewiss besonders schmerzhaft, und mit Blick auf die Lebenssituation der Geschlechter befürchtete Jutta Allmendinger "einen Rückfall auf eine Rollenteilung wie zu Zeiten unserer Großeltern".
Noch einmal Heribert Prantl: "Neue Heimat in Corona-Zeiten? Es gibt nicht wenige Menschen, die in den Zeiten des Lockdowns und des Homeoffice ihre Familie als Heimat neu entdeckt haben. Es gibt aber auch die, die das Homeoffice und den Shutdown als unzuträgliche Überdosis und als fast schon haftähnliche Situation erlebt haben. Es gibt die Beamten, denen, Corona hin oder her, die monatlichen Bezüge garantiert sind. Und es gibt die Wirte und Restaurantbesitzer, die die Zahlungsaufforderungen und Mahnbescheide in ihrem Briefkasten finden. Die Entheimatung durch Corona wird auf sehr unterschiedliche Weise erlebt."
Die Krise hatte und hat also ganz konkret unterschiedliche Auswirkungen auf das Leben der Menschen und wird auch deshalb ganz unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet. Verstärkt wird dies dadurch, dass die Maßnahmen, die der Krise begegnen sollen, ohnehin zu größerer Isolation führen: Gerade gemeinsamkeitsstiftende Aktivitäten wie Singen, Tanzen, Feste oder Sport finden, wenn überhaupt, nur unter strengsten Auflagen statt, denn physische Begegnungen im Raum gelten nun vor allem als potentielle Bedrohung, menschliche Körper als mögliche Träger und Verbreiter von Viren. Parallel zu der Hoffnung auf eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts lässt sich daher auch die Sorge vor einer weiteren Spaltung der Gesellschaft beobachten, die auch in den vielfältigen und teils unvereinbaren Sichtweisen auf die Krise selbst zum Ausdruck kommt. Wer die Gegenwart als beängstigend und einengend erlebt und sorgenvoll in die Zukunft blickt, wird sich nach einer Rückkehr in die alte Normalität sehnen, versuchen, an Bewährtem festzuhalten oder nostalgisch auf die Zeit vor Corona zurückblicken.
Heimat im Bedrohungszustand
Sorge und Angst vor Verlusten bestimmen dann die Wahrnehmung: Wie sicher ist die eigene ökonomische Existenz? Werden Buchladen, Chor oder Stammkneipe die Krise überstehen? Wird es je wieder möglich sein, zu reisen, unbekümmert ein Konzert zu besuchen und anderen Menschen ohne Gesichtsmaske nahe zu kommen? Wie sehr werden Charakter und Identität des Wohnortes, der Nachbarschaft oder der Heimatstadt sich wandeln? Die Heimat wird vielleicht neu entdeckt, aber zugleich auch als bedroht wahrgenommen.
Paradox: Einerseits ist man an die Heimat oder doch an den Wohnort gebunden wie selten zuvor. Doch andererseits ist der Fortbestand dieser vertrauten Heimat fraglich. Damit löst die Coronakrise auch Heimweh, Nostalgie und Fernweh aus, Sehnsucht nach Geborgenheit und heiler – oder geheilter – Welt.
Nicht nur in Großstädten sehen die Menschen ganz verschiedene Wirklichkeiten: Die einen befürchten die Verödung der Städte, beobachten sorgenvoll den Müll in den Parks, nehmen verstärkte Aggressivität wahr und spielen mit dem Gedanken, aufs Land oder in eine Kleinstadt zu ziehen.
Andere hingegen hoffen auf innovative Nutzung der Stadträume, genießen die Gelegenheit, touristische Sehenswürdigkeiten ungestört besichtigen zu können und erleben eine nie dagewesene Rücksichtnahme ihrer Mitmenschen. Sie entdecken Achtsamkeit, Entschleunigung und Besinnung, sehen Corona als spirituelle Herausforderung oder erleben, in den Formulierungen von Matthias Horx, einen "Rausch des Positiven" oder gar "Corona-Euphorie".
Dieser Blick sieht in der Zukunft nicht primär Risiken und Gefahren, sondern die Verheißung, die Unzulänglichkeiten der Vergangenheit und Gegenwart jetzt endlich überwinden zu können. Daher wird auch im politischen und medialen Diskurs die 'neue Normalität' oftmals nicht als potentielle Verlusterfahrung, sondern vielmehr als möglicher Wendepunkt auf dem Weg in eine bessere, gesündere, klima- und umweltfreundlichere oder empathischere Gesellschaft präsentiert, die Krise erscheint geradezu als "Wiege der Zukunft".
Die Pandemie, so heißt es, sei ein erster Schritt hin "zur Transformation des Denkens und Handelns" und eröffne einen "Weg zu einer entschleunigten Lebensweise mit weniger Konsum". Eben durch die radikale, erzwungene, plötzliche Unterbrechung der bisherigen Normalität, so die Hoffnung, solle erkannt werden, dass diese vormalige Normalität mit Hypermobilität, Konsumzwang und Hektik doch eigentlich zutiefst problematisch war. So untersuchen Psychologinnen an der Universität Magdeburg, inwiefern sich die Coronakrise als Gamechanger für die Transformation zur Nachhaltigkeit erweisen könnte, und die Politikökonomin und Transformationsforscherin Maja Göpel meint, man solle den Moment nutzen, um sich darüber zu wundern...
"...wie der Kampf gegen das Virus manches möglich macht, was bis vor Kurzem noch als undenkbar galt. Darüber, dass vermeintliche Wahrheiten der Ökonomie sich plötzlich als große Irrtümer erwiesen haben. Und sich fragen, welche politischen Lehren die Corona-Pandemie für den richtigen Umgang mit der Klimakrise bietet."
Selbst das Weltwirtschaftsforum sieht in der Coronakrise einen Anlass, nun endlich, 50 Jahre nach seiner Gründung, die Fehler des alten Systems zu überwinden und zu einer nachhaltigeren Welt zu gelangen. Eine zentrale Rolle dabei spielt die Digitalisierung: Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Forums, nimmt die Krise als Beleg dafür, dass ein "Great Reset", ein "Großer Neustart" dringend nötig sei. Zugleich beschleunige diese Krise, so Schwab, den Übergang in ein von Künstlicher Intelligenz, automatisierter Produktion, Big Data und einer "Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Welt" bestimmtes "Zeitalter der Vierten Industriellen Revolution", das er allerdings schon beim Jahrestreffen in Davos 2016 ausgerufen hatte. Die Auswirkungen dieser digitalen Revolution klingen in seiner Beschreibung von 2016 durchaus ähnlich dramatisch wie die der aktuellen Coronakrise:
"Wir stehen am Rande einer technischen Revolution, die unsere Art zu leben, zu arbeiten und miteinander umzugehen grundlegend verändern wird. Die Vierte Industrielle Revolution wird unsere Identität und alles, was damit verbunden ist, erfassen: unseren Begriff von Privatsphäre und Eigentum, unsere Konsumgewohnheiten, die Zeit, die wir mit Arbeit oder Privatleben verbringen, wie wir unsere Karrieren planen, unsere Fähigkeiten entwickeln, uns mit anderen Menschen treffen und Beziehungen pflegen. Sie verändert bereits unsere Gesundheit und führt zu einem 'quantifizierbaren' Selbst."
"Neue" Heimat im Digitalen
Schnell wurde deutlich, dass die Coronakrise in der Tat die Chance barg, der Digitalisierung und der Vierten Industriellen Revolution einen gewaltigen Schub zu versetzen. Die Vorstellung, Arbeit und Bildung der Zukunft könnten zumindest zu einem erheblichen Teil ohne physische Begegnungen in Büros, Hörsälen und Klassenzimmern stattfinden, sondern stattdessen im virtuellen Raum, wurde denn auch keineswegs nur als pragmatische Lösung aktueller Probleme mit Vorzügen und Nachteilen gesehen, sondern als Vorschein der Zukunft. Vielleicht würden nun endlich weitere Teile der Gesellschaften ihre "Heimat im Digitalen" finden; vielleicht würde Heimat nun bald schlicht als der Ort definiert werden, wo sich das WLAN automatisch verbindet, potentiell also überall.
Besonders auch im Bereich der Bildung gab es neben Kritik an den bisher mangelhaften Fortschritten der Digitalisierung enorme Begeisterung angesichts der rasanten, nun unvermeidbaren Innovationen durch Zoom-Meetings, tausendfach angeklickte Lehrvideos und den großflächigen Einsatz digitaler Plattformen. Manche sahen voraus, dass diese Entwicklungen menschliche Arbeit zumindest teilweise obsolet machen würden; auch diese Perspektive erscheint in der Doppelgestalt einer einerseits düsteren, andererseits strahlenden Zukunftsvision einer Gesellschaft mit weniger Arbeit und der Notwendigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Eine radikale, aus marktliberaler Perspektive wohl als Verheißung verstandene Position vertrat der Ökonom Thomas Straubhaar: Für ihn hatte es den Anschein, als könne die Digitalisierung ein Ende der von ihm als problematisch gesehenen Massenuniversität, ja überhaupt das Ende der grundständigen universitären Lehre bewirken:
"Die Digitalisierung bietet unvorstellbare Möglichkeiten, orts- und zeitunabhängig, universitäre Studiengänge und akademische Bildungsprogramme zu nutzen. Corona-Politik erwirkt das Ende der Massenuniversität, die mit tausenden von Lehrkräften an hunderten Hochschulen in den Grundlagenfächern alle mehr oder weniger dasselbe unterrichten."
Andere, wie die amerikanische Soziologin Sherry Turkle oder die Wissenschaftsjournalistin Hildegard Kaulen, waren zurückhaltender und wiesen auf soziale Isolation und Einsamkeit in der Krise sowie auf die Grenzen und die Ambivalenz digitaler Kommunikationsmedien hin.
Wieder andere, wie die Philosophin Lisz Hirn, machten auf die Überforderung vor allem von Frauen durch berufliche und familiäre Aufgaben im Home-Office aufmerksam. Mediziner zeigten sich besorgt über Bewegungsmangel, der noch dadurch verstärkt wurde, dass viele Menschen nicht nur ihre Arbeit, sondern auch Konsum und Freizeitaktivitäten in die virtuelle Sphäre verlegten: Streaming statt Kino und Konzert, Intranet statt Cafeteria, Buchkauf bei Amazon anstelle des Stöberns im Buchladen, Chorprobe, Yoga und Gitarrenunterricht per Videokonferenz.
Fest steht: Bildschirme und Internetverbindungen wurden für nahezu alle Lebensbereiche essentiell. Fast fühlte man sich an einen Satz aus H.G. Wells utopistischem Roman "Jenseits des Sirius" erinnert:
"Dem Vordringen der Maschine im Leben scheint keine Grenze gesetzt zu sein."
Für viele Menschen, die nun zu Stubenhockern und Nerds geworden waren und zuhause auf ihre Bildschirme oder das grüne Kameralicht starrten, war das körperliche Erleben des physischen Raums in unvorstellbarem Maß eingeschränkt. Im digitalen Raum dagegen eröffneten sich ihnen scheinbar grenzenlose, körper- und ortlose Möglichkeiten der Unterhaltung, Information, Kommunikation und des Konsums. Die Welt schien auf paradoxe Weise virtuell grenzenlos verfügbar und zugleich physisch unerreichbar und entortet. Der rapide Bedeutungszuwachs dieser digitalen Welt der Nicht-Orte steht im diametralen Gegensatz zu der Hinwendung zum Ort als Heimat. Mehr noch: Die nun massenhaft verbreiteten digitalen Praktiken haben unmittelbare Konsequenzen für die konkreten Orte in der wirklichen Welt, für das Verhalten der Menschen und für ihr Verhältnis zu diesen Orten: Durch Online‑Handel, Streaming und Home-Office wird zumindest ein Teil der Ladengeschäfte, Kaufhäuser, Kinos und Bürogebäude in den Städten überflüssig, und noch ist völlig offen, welche langfristigen Konsequenzen das haben wird.
Eine äußerst düstere Zukunftsvision der Konsequenzen übermäßiger Abhängigkeit der Menschen von Maschinen und der Missachtung und Vernachlässigung der realen Welt findet sich in der dystopischen Novelle "Die Maschine steht still". Der britische Romancier E.M. Forster veröffentlichte sie im Jahr 1909 als kritische Replik auf die optimistischen, zutiefst technokratischen Zukunftsvisionen seines Zeitgenossen H.G. Wells. Bei Forster wird die Abhängigkeit von Wissenschaft und Technik zum Albtraum. Englischsprachige Kommentatoren haben schon vielfach auf die fast schon unheimlichen Parallelen zwischen diesem Text und der Corona‑Gegenwart hingewiesen. In Forsters Novelle ist die Erdoberfläche unbewohnbar geworden. Menschen, die sich dennoch dort aufhalten, benötigen Atemmasken und "Hygienekleidung". Alle leben isoliert in unterirdischen, identischen Zellen, in denen sie von der allmächtigen 'Maschine' mit Licht, Luft, Kleidung, Wasser, Nahrung und Medikamenten, aber auch mit Musik, Literatur und Vorträgen versorgt werden. Angepasst an diese neue Umwelt, in der es keine Außenwelt mehr gibt, sind nicht nur ihre Muskeln und ihr Raumgefühl verkümmert, sondern auch ihre Emotionen und ihre Kreativität. Der Kontakt mit anderen Menschen findet über Videokonferenzen statt, die "komplizierte öffentliche Versammlungspraxis" ist endgültig überwunden, Reisen sind weitestgehend überflüssig. Auch wenn die Maschine bei den Videokonferenzen nur ein unvollständiges Bild der Menschen überträgt und das "unwägbare Fluidum" der zwischenmenschlichen Begegnung verloren geht, gilt diese Form der Kommunikation doch den meisten als "gut genug". Wer gegen die Vorschriften verstößt, wird mit 'Heimatlosigkeit' bestraft, zum Aufenthalt auf der Erdoberfläche und damit zum Tod verurteilt. Die vollautomatisierte Geborgenheit unter der Obhut der Maschine stellt die letzte Schwundstufe von Heimat dar: Die Dynamik zwischen dem Hinausgehen in die Welt und der Heimkehr nach Hause gibt es nicht mehr. Am Ende steht die absolute Zerstörung von Heimat und Welt: Im Lauf der Handlung gerät die Maschine nach und nach außer Kontrolle und versagt schließlich ganz.
"Doch dann kam der Tag, an dem auf der ganzen Welt das gesamte Kommunikationssystem zusammenbrach und die Welt, so wie die Menschen sie kannten, ihr Ende fand."
Forsters dystopische Zukunftsvision mag wie eine Überzeichnung wirken, doch immerhin fand der Internet-Vordenker Jaron Lanier in ihr eine Vorwegnahme des Internets. Dystopien verwenden immer Übertreibungen, um auf potentiell problematische Entwicklungen der Gegenwart hinzuweisen. Wer also skeptische Überlegungen dazu anstellt, welche negativen Konsequenzen die Coronakrise in Verbindung mit der "Industriellen Revolution 4.0" für unser Verhältnis zu Orten, zur physischen Welt und für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen haben könnte, sollte nicht vorschnell der Nostalgie oder des Kulturpessimismus bezichtigt und als rückwärtsgewandt und ewiggestrig etikettiert werden. Sinnvoller wäre es, darüber zu diskutieren, wie sich Veränderungen ohne massive Entfremdungs- und Entheimatungsgefühle verkraften lassen, welche Veränderungen die Menschen dauerhaft akzeptieren und wo es auch sinnvoll sein mag, Vertrautes zu bewahren. Wenn wir nicht wollen, dass das Bild verwaister Orte und geisterhafter Stadtlandschaften ein Blick in die Zukunft ist, sollten wir zudem darüber nachdenken oder auch streiten, wie die Orte, an denen wir leben, beschaffen sein sollen, damit wir sie als Heimat erleben können. Denn auch das zeigte die Krise: Menschen brauchen Heimat – und Heimat braucht Orte.