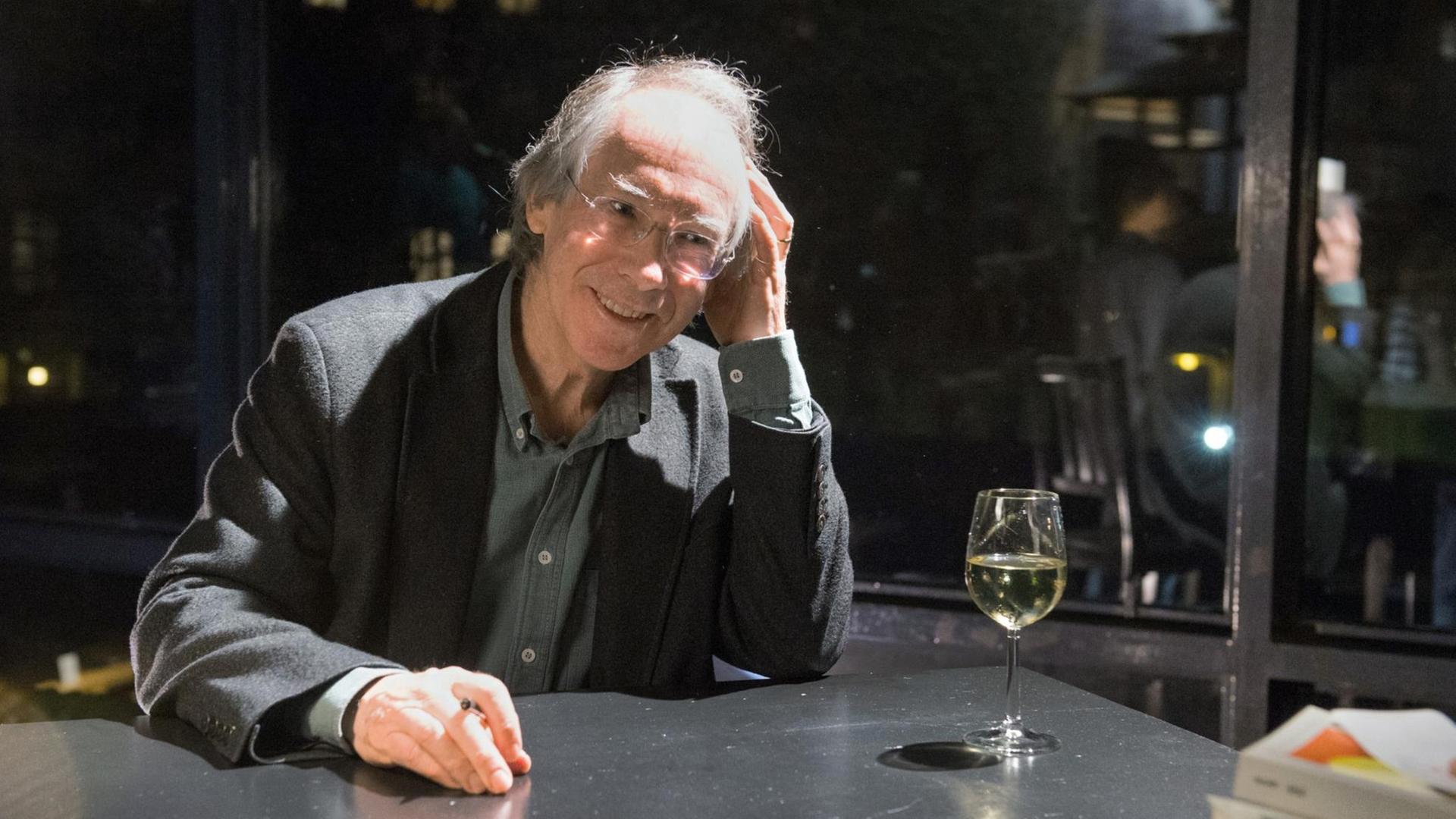
Damit auch der Unbelesenste versteht, wer in seinem neuen Roman spricht, stellt Ian McEwan ihm ein Motto aus Shakespeares Tragödie "Hamlet" voran.
"O Gott, ich könnte in eine Nussschale eingesperrt sein und mich für einen König von unermesslichem Gebiete halten, wenn nur meine bösen Träume nicht wären."
Hamlet also, der dänische Zauderprinz, der sich nicht entscheiden mag, seine Rachegedanken in die Tat umzusetzen und auch sonst manch einen Schwachpunkt offenbart. Seine Mutter heißt jetzt nicht mehr Gertrude, sondern Trudy und sein Onkel Claudius firmiert als Claude. Im Gegensatz zum Original lebt Hamlets Vater noch, wenn er auch das Ende des Romans nicht mehr erleben wird. Damit ist in diesem Falle nicht viel vorweggenommen, denn spannend gestaltet sich das Buch höchstens leidlich. Und das liegt vor allem an der nur auf den ersten Blick famosen Idee, einen ganzen Roman aus der Sicht eines Ungeborenen zu erzählen. Von einem also, der vermeintlich alles mitbekommt, ohne dabei gesehen zu werden.
"Außerhalb meiner warmen, lebendigen Wände schlittert eine eiskalte Geschichte ihrem schrecklichen Ende entgegen. Am Himmel schwere Hochsommerwolken, kein Mond, nicht die leiseste Brise. Mutter und Onkel aber reden einen Wintersturm herbei. Eine weitere Flasche wird entkorkt, und nur allzu bald noch eine ."
Wiedererkennungseffektfür "Hamlet"-Leser
Wie Tilman Rammstedt in seinem ebenfalls in diesem Jahr erschienenen Roman "Morgen mehr" wird hier ein Fötus zum Ich-Erzähler, wobei er bei McEwan auch oft zum "Wir" wechselt, schließlich befindet er sich ja noch im schwangeren Körper seiner Mutter und kann sich nicht ohne sie denken und fühlen. Die Idee, einen Roman aus dem Mutterbauch heraus zu erzählen, hört sich gewitzter an als der Roman sich liest. Dabei hätte es durchaus anregend sein können, dabei zu sein, wenn sich ein Ich zu konstituieren beginnt. Das mindeste, was man erwartet hätte, war zu erfahren, warum Hamlet so geworden ist, wie er ist oder vielmehr war. Ian McEwan aber nutzt seinen Einfall bloß für eine kleine Geschichte samt Krimiplot, eine Fingerübung, die für den mit "Hamlet" vertrauten Leser manchen Wiedererkennungseffekt bereit hält.
"Wer ist dieser Claude, dieser Betrüger, der sich zwischen meine Familie und meine Hoffnungen schlängelte? Ich hörte einmal und merkte mir: dieser schwachköpfige Tölpel. Trübe Aussichten für mich. Seine Existenz negiert meinen rechtmäßigen Anspruch auf ein glückliches Leben in der Obhut beider Eltern. Sofern ich keinen Plan schmiede."
Ian McEwan ist natürlich nicht der Erste, der literarisch in die Fänge Hamlets geraten ist. Zu erinnern ist etwa an Heiner Müllers längst zum modernen Klassiker avanciertes Theaterstück "Hamletmaschine", aber auch an F.K. Wächters mit Kasper und Bär grandios neu erzähltes und gezeichnetes Buch "Prinz Hamlet" und natürlich auch an John Updikes Roman "Gertrude und Claudius", der vorgibt, die Vorgeschichte des Shakespeare-Stückes zu erzählen. Ian McEwan scheint indirekt auf Updike anzuspielen, wenn er Hamlets Vater John nennt und ihn mit eben jener Hautkrankheit, Schuppenflechte, straft, unter der auch Updike zu leiden hatte. Aber das nur am Rande.
Betulich und brav
Diese Querverweise sind charmant, wie es auch das Spiel mit Shakespeare-Anspielungen und -zitaten ist. Und doch umgibt diesen Roman eine Art permanentes Augenzwinkern, das irgendwann bloß noch nervt. Das liegt auch daran, dass vieles sehr betulich und brav daherkommt. Zuweilen mag man gar nicht glauben, dass hier der Autor solcher großen Romane wie "Saturday" oder "Solar" am Werk war. Das betrifft in erster Linie die inhaltliche Ebene sowie die Konstruktion des Buches, nicht seine Sprache. Denn wie immer gelingen McEwan geschliffen scharfe Sätze, die sich in der Übersetzung von Bernhard Robben gut aufgehoben fühlen dürfen. Da erinnert die frisch zurechtgemachte Trudy etwa an ein "frisch vom Stapel gelaufenes Schiff". Dann aber ist es wieder der angestrengt wirkende Humor, der das Ende des Romans herbeisehnen lässt:
"Ich rede mir gern ein, dass sie sich draußen auf dem Balkon aufhält, um Vitamin D für meinen Knochenwuchs zu bilden, dass sie das Radio leiser gestellt hat, um besser über meine Existenz nachdenken zu können, und dass es ein Ausdruck von Zärtlichkeit ist, wenn ihre Hand jene Stelle streichelt, an der sie meinen Kopf vermutet. Womöglich aber will sie nur braun werden; außerdem ist ihr zu heiß, um einem Hörspiel über den Großmogul Aurangzeb zu folgen, und ihre Fingerspitzen lindern vielleicht nur das unangenehme Völlegefühl der späten Schwangerschaft. Kurz gesagt: Ich bin mir ihrer Liebe nicht sicher."
Da überzeugt schon eher das Unterfangen des altklugen Ungeborenen, sich schon einmal selbst pränatal von seiner zukünftigen Feigheit freizusprechen sowie später dann auch seine quasi bei vollem Bewusstsein erlebte eigene Geburtsstunde. Doch insgesamt gelesen hilft das alles nichts: Dieses kleine Buch wurde aus einer kleinen Idee heraus geboren, und es ist nicht über sich selbst hinaus gewachsen.
Ian McEwan: "Nussschale"
Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes Verlag. 277 Seiten. 22 Euro.
Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes Verlag. 277 Seiten. 22 Euro.
