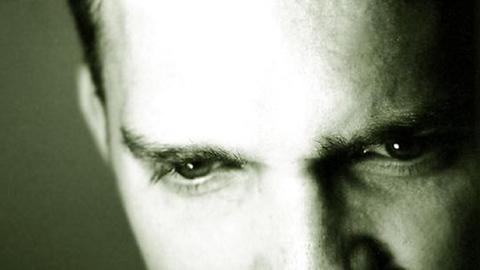Da sitzen sie und klagen ihr Leid. Sie können nicht mehr. Sind ausgebrannt. Stehen kurz vor der Depression, wissen nicht mehr, wie sie das weiter durchstehen lassen. "Das": Das ist die Arbeit, der Beziehungsstress, der Lärm, die Hektik oder alles zusammen. Kurz: das Leben. Die Frage ist nur: Wo liegt das Problem?
Beim Einzelnen, der einfach nicht mehr mitkommt, dem man ein paar aufmunternde Worte hinwirft, und vielleicht auch ein Psychopharmakon? Einen Tranquilizer, einen Muntermacher, Pillen, die beim Denken helfen? Therapien dieser Art stimmen in einem Punkt überein: Der Fehler liegt beim Einzelnen. Also muss man bei ihm ansetzen. Vieles spricht allerdings dafür, dass das Problem ganz woanders liegt, nämlich in den Strukturen des modernen Lebens - einem Leben, das feste Bindungen zu guten Teilen abgeworfen hat und den Einzelnen tagtäglich vor neue Entscheidungen stellt. Die Emanzipation, der Abschied von festen Lebensformen, ist mit einigen Kosten verbunden, erläutert der emeritierte Soziologe Hans-Georg Soeffner, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie:
"Es ist ein Freiheitsgewinn, der damit verbunden ist. Aber es ist auch ein hoher Verlust an Sicherheit durch vorgegebene Bindungen. Das heißt, wir leben in der Moderne in einer Zeit, in der die Einzelnen gefordert sind, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Bei Plessner heißt das mal so schön, man muss das Leben tatsächlich führen, das heißt also, die Führung selbst übernehmen. Und das ist das Schicksal moderner Gesellschaften. Dass wir dann daraus Emanzipationsideologien machen und das Ganze überwölben, indem wir das Individuum zum einzigen Wert einer Gesellschaft hochstilisieren, das ist sozusagen der Versuch, den Verlust abzufangen, den wir deutlich empfinden. "
Die rasenden Bewegungen der Moderne: Vielleicht, meint der in Jena lehrende Soziologe Hartmut Rosa, Autor eines Werkes zur Beschleunigung in der sozialen Welt, setzen sie den Menschen aber nicht nur zu, sondern entsprechen auch einem Sinn-Bedürfnis, das sich in nach-religiöser vor allem durch ein hohes Lebenstempo artikuliert.
"Jeder weiß dass der Tod ihm bevorsteht, und keiner weiß so genau, wie es danach weitergeht. Und so haben wir ein kulturelle Programm entwickelt, das sagt, ich will vor diesem Sterbenmüssen nicht ein metaphysisches oder substantielles Ziel verwirklichen, aber ich will ganz viel Welt ausschöpfen, ich will möglichst viel unterbringen. Ich weiß, dass ich sterben muss, aber bevor es soweit ist, will ich noch ganz viel mitnehmen, ganz viel in mir entfalten, ganz viele Möglichkeiten realisieren. Und so haben wir eine Art von Formalziel entwickelt, das uns dann irgendwann wie eine Lawine auch zu überwältigen droht."
Der Stress wäre dann auch so etwas wie ein verkappter Lebenshunger. Aber vielleicht geht es noch um etwas anderes, vermutet der am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen forschende Philosoph Ludger Heidbrink, Herausgeber eines Bandes zum Unternehmertum als neuer Lebensform. Vielleicht lässt sich der Stress ja auch lustvoll erfahren - indem wir lernen, intelligent mit ihm umzugehen:
" Wir leben eigentlich in einem hypernervösen Zeitalter, müsste man sagen. Auf der anderen Seite lernt man ja auch, mit diesen Prozessen umzugehen. Und die Eigenschaftslosigkeit kann ja eine positive Eigenschaftslosigkeit werden, wenn man diese vielen kleinen Ichs, die wir sind, auf eine sehr intelligente und geschickte Weise miteinander verknüpft. Und die Nervosität, die man verspürt erst mal am Grunde unserer Zeit, kann durchaus ein Stimulans sein, sich immer wieder neu auf die sich verändernden Umwelten einzustellen, ohne dass das jetzt als Überforderung wahrgenommen wird oder als Ich-Verlust oder Identitäts-Verlust."
Tatsächlich trifft sich die Rede vom Stress mit einem anderen Dauerbrenner der Kulturkritik: der vom Verlust der eigenen Identität. Von dieser Verlustgefahr ist vielfach die Rede: Der einzelne verliere seine Wurzeln durch die wilden Rhythmen des Arbeitslebens, das ständige Hin und Her zwischen verschiedenen Orten, durch fatal aufgeweichte Bindungen. Und im Großen etwa sei die kollektive Identität modernen Gesellschaften durch die Migration zumindest herausgefordert. Die Frage ist nur: Was ist Identität? Allzu leicht sitzen wir, wenn wir von ihr sprechen, einem Mythos auf, fürchtet der Soziologe Hans-Georg Soeffner:
"Identität ist ja auch nicht etwas, was man einfach so in der Tasche hat. Das ist nicht etwas, was man gewinnen oder verlieren kann. Also dieses Bild von der verlorenen Identität, als könne man die verlieren wie das Portemonnaie auf der Straße, das ist ein Unfug. Identität ist ein Prozess. Die entsteht, die Identität, als gesellschaftliche im Austausch zwischen Personen. Ich biete denen ein Bild von mir an, die bestätigen das, mein Gegenüber, oder auch nicht. Und ich werde zu dem geformt, was die aus mir machen oder was ich imstande bin aus mir zu machen im Austausch mit anderen. Das ist die soziale Identität. Das ist ein permanenter Austauschprozess."
Ein Prozess mit den Menschen - und auch einer mit den Dingen, mit den Bildern, Tönen, Ideen. Der Mensch lebt in einer Welt, die von allen Seiten auf ihn einstürmt, sein Interesse, seine Aufmerksamkeit zu wecken versucht - und darüber, weil die Konkurrenz groß ist, oft sehr laut und grell. Darum ist die Gefahr groß, dass wir uns ablenken lassen, erklärt Hartmut Rosa. Und geschieht das zu oft, bedroht das am Ende jede ernsthafte Kultur.
"2Es ist ganz schwierig, Relevanzstrukturen zu bestimmen. Es gibt keine sicheren und verlässlichen Programme, die Qualität unterscheiden können. So dass tatsächlich das hervorsticht und Aufmerksamkeit findet, was an der Oberfläche schillert und glitzert. Man kann sich das so vorstellen, dass wir fast durch unsere Welt, durch unsere Kultur gehen wie durch einen Supermarkt, durch dessen Regale. Und da werden unsere Blicke an den Produkten haften bleiben, deren Attraktivität ich von außen erkennen kann. Aber jene Tätigkeiten oder Praktiken oder Kulturprodukte, deren Wert sich nur enthüllt, wenn man sich lange damit beschäftigt, die drohen dabei unterzugehen.""
Immerhin lenken die lauten Botschaften davon ab, sich mit einem Umstand auseinanderzusetzen, der nun immer offensichtlicher wird: Das ganze Treiben bringt nichts. Es geht nicht mehr voran. Die Erfolgsgeschichte, die der Westen so lange von sich selbst erzählte, sie stimmt nicht mehr. Wir können nicht mehr sicher sein, dass die Zukunft eine bessere ist. Aber das, erläutert Rosa, treibt uns nur noch mehr an:
" Das kann man gut daran ablesen, dass zum ersten Mal eigentlich seit Jahrhunderten Eltern nicht mehr in dem Bewusstsein handeln, dass ihre Kinder es einmal besser haben soll, materiell, aber auch in sozialer Hinsicht, sondern dass sie ständig in Sorge leben, dass die Kinder es nicht mehr so gut haben werden, dass wir an Abhängen oder Abgründen sogar stehen. Also die Zukunftshorizonte haben sich massiv eingetrübt, so dass man das Gefühl hat, man muss sich jedes Har ein bisschen mehr anstrengen - nicht damit man ein besseres Leben verwirklicht, sondern damit man nicht in die Krise rutscht."
Über diese Gefahr ist ein neues Leitbild entstanden: Der flexible Mensch, neudeutsch: Die Ich-AG. Der Einzelne soll sich mehr um sich selbst kümmern, aktiv werden, sich als ganzen einbringen, zwischen Beruf und Freizeit nicht mehr unterscheiden. Der Einzelne wird zum Projektmanager seiner selbst. Ist das ausschließlich ein Schreckensbild? Nicht unbedingt, meint Ludger Heidbrink:
" Diese Idee des Unternehmertums hat sich dann in den letzten, sagen wir zwei Jahrzehnten sehr stark ausgeweitet in die Gesellschaft hinein, sodass man heute von einer unternehmerischen Gesellschaft sprechen kann. Wir sind alle mehr oder weniger Unternehmer unserer selbst. Es wird von uns erwartet, ein erfolgreiches Leben zu führen, mit knappen Ressourcen vernünftig zu haushalten, in einem permanenten Wettbewerb zu stehen. Also erfolgreich und wettbewerbsorientiert und leistungsorientiert zu handeln."
Natürlich handelt es sich hier auch um eine Behelfs-Ideologie, die heraushelfen soll aus der Not. Der Sozialstaat ächzt unter der Last der Zuwendungen, die er aufbringen muss. Und der Arbeitsmarkt vermag die Massen nicht zu fassen, die auf ihn drängen. Zugleich werden Spezialisten unterschiedlichster Art dringend gesucht. In diese Situation passt ein Menschenbild, das dem einzelnen höhere Selbstständigkeit unterstellt. Insofern, bemerkt Ludger Heidbrink, handelt es sich um ein höchst ambivalentes Menschenbild:
"Also diese Flexibilisierung des eigenen Lebens hat ja häufig auch sehr positive Seiten. Und ich glaube, dass man häufig denjenigen, die sich in solchen Berufs- oder sagen wir lieber: Quasiberufsformen selbst verwirklichter Arbeitsprozesse befinden, dass man denen häufig unterstellt, dass sie sich in einem prekären Arbeitsverhältnis befinden. Das sind häufig Formen der Selbstverwirklichung, die glaube ich, in Zukunft immer notwendiger werden, um mit geringen Mitteln das Beste daraus zu machen."
Das Beste daraus zu machen: Das gelingt ja auch, jedenfalls doch recht häufig. Und das wirft wieder einen kleinen Zweifel auf: Sind die Worte von der Orientierungslosigkeit, von der dauernden Überforderung, von der Unfähigkeit, sich zurecht zu finden - ist dieses Gerede nicht zumindest zum Teil auch schlichtes kulturkritisches Geplänkel, vielleicht auch Geschäftsgrundlage all der Berater unterschiedlichster Couleur, die ein Krisenszenario entwerfen, auf dem sie dann ihr Geld verdienen? Durchaus möglich, meint Hans-Georg Soeffner. Denn eigentlich klappt es mit unserer Orientierung doch recht gut.
"Wir haben eine Freizeitindustrie entwickelt, die es uns erlaubt, neben dem Beruf Freundeskreise permanent aufzubauen in einer Nebenwelt. Wir haben dann unsere Berufswelt, und wir wissen genau, wann wir von welchem Sektor in den anderen übergehen. Wir haben unsere Familien, die eine größere Bedeutung haben. Das heißt, wir leben in unterschiedlichen Sektoren, aber nicht so, als wären wir nun völlig verwirrt und würden automatisch multiple Persönlichkeiten. Nein, ganz im Gegenteil: Wir wissen, was wann wo zu tun ist. Wenn Sie sich das Leben eines modernen Menschen ansehen, einen Tagesablauf ansehen, dann werden sie feststellen, der ist alles andere als ungeordnet."
Und doch, das Unbehagen will nicht weichen, ob es nun zuviel unverdauter kulturkritischer Lektüre entstammt oder harter realer Erfahrung. Auf jeden Fall muss man sich einlassen auf die vielen Anforderungen der Gegenwart, auf all die Rollenspiele und kleinen Inszenierungen, die Tag für Tag gefordert sind. Sie, erklärt Hartmut Rosa, sind in der Tat unverzichtbar. Man muss sie annehmen, ansonsten wird man auch kulturell sehr schnell zum Freak und Außenseiter.
"Wer das also nicht will, wer nicht zu einem spätmodernen Spieler werden will, hat eine andere Strategiemöglichkeit, dass er nämlich an irgendeinem Punkt seines Lebens einen Parameter sozusagen als unveränderbar setzt. Zum Beispiel, indem er in irgendeiner Form fundamentalistische Neigungen entwickelt. Das kann religiöser Art sein, das kann auch ein politischer Fundamentalismus oder in einer anderen Art sein. Und wer weder zu dieser Art von stabiler Verankerung fähig ist oder auch nicht fähig ist, zum Spieler zu werden, der ist dann in der Tat bedroht, unterzugehen in der Welt und depressive oder an Burn-out erinnernde Symptome zu entwickeln."
Aktiv und auf der Höhe der Zeit zu bleiben, erfordert seinen Preis. Kein Wunder darum, dass die Kultur- und Zivilisationskritik nicht verstummt, die Bilder einer alternativen Gesellschaft die Menschen weiterhin faszinieren, teils auch zu politischen Programmen werden. Die Frage ist nur: Wie weit führt diese Kritik? Vermag sie tatsächlich etwas zu ändern? Das System? Der Philosoph Ludger Heidbrink ist skeptisch. Denn das System - das sind wir letzten Endes selbst.
"Wir haben ja eine sehr lange Tradition gerade in Deutschland, die man als antibürgerliche Kulturkritik bezeichnen könnte. Und was man beobachten konnte, ist, dass all diese Kritik, die sich ja auch gegen den Liberalismus, die Ökonomisierung der modernen Gesellschaft gerichtet hat, eine Kritik am Bürger selbst gewesen ist. Und das beobachtet man ja heute auch teilweise wieder. Wenn wir gegen ein bestimmtes Konsumverhalten zu Felde ziehen, wenn wir gegen unsere exzessive, Ressourcen verschlingende Wirtschaftskultur und -form zu Felde ziehen, kritisieren wir eigentlich uns selbst. Und das ist eben ein Ausfluss einer bürgerlichen Kultur, die heute sozusagen zur Diskussion gestellt wird von den Bürgern selbst."
Der Bürger, der sich selbst in Frage stellt. Eigentlich stellt er damit alles in Frage. Und wirklich lässt sich derzeit in Stuttgart eine Diskussion eröffnen, um der es zumindest unterschwellig und bei manchen der Teilnehmer um mehr geht als nur die Frage eines unterirdischen Bahnhofs. In dem Protest scheinen sich zumindest zu Teilen auch naturschützerische, konsumkritische Motive auf, ebenso Stimmen, die neue demokratische Verfahren fordern, weil die alten - angeblich - auf die Gegenwart nicht mehr passten. Das ist durchaus in Ordnung, erklärt Hans-Georg Soeffner. Nur gelte es zu bedenken, dass die Demokratie sich grundsätzlich selbst erneuere, nicht nach Umsturz und abruptem Wechsel verlange, sondern nach behutsamer Nachbesserung.
" Demokratie ist kein festes System. Sondern Demokratie ist ein Prozess, ein Anpassungsprozess, indem die Gesellschaft die bestmögliche Form des Lebens zu finden versucht innerhalb von Interessenkonflikten. Und in dem Augenblick, in dem Bürger sich schlecht repräsentiert fühlen durch die Politik in einem repräsentativen System oder ihre Interessen nicht wahrgenommen fühlen innerhalb eines Verbandes, in dem Augenblick gibt es natürlich Revolten - das ist vollkommen zwangsläufig. Und das heißt dann wiederum, besteht die Aufgabe der Zivilgesellschaft darin, das, was in dem demokratischen Apparat, den wir bisher haben, nicht funktioniert, mit den bisher geltenden Regeln evolutionär umzuformen. Nicht zu revoltieren, sondern die Evolution ernst zu nehmen und die Reparaturmaßnahmen vorzunehmen, die jetzt in der Gesellschaft von uns gefordert werden."
Beim Einzelnen, der einfach nicht mehr mitkommt, dem man ein paar aufmunternde Worte hinwirft, und vielleicht auch ein Psychopharmakon? Einen Tranquilizer, einen Muntermacher, Pillen, die beim Denken helfen? Therapien dieser Art stimmen in einem Punkt überein: Der Fehler liegt beim Einzelnen. Also muss man bei ihm ansetzen. Vieles spricht allerdings dafür, dass das Problem ganz woanders liegt, nämlich in den Strukturen des modernen Lebens - einem Leben, das feste Bindungen zu guten Teilen abgeworfen hat und den Einzelnen tagtäglich vor neue Entscheidungen stellt. Die Emanzipation, der Abschied von festen Lebensformen, ist mit einigen Kosten verbunden, erläutert der emeritierte Soziologe Hans-Georg Soeffner, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie:
"Es ist ein Freiheitsgewinn, der damit verbunden ist. Aber es ist auch ein hoher Verlust an Sicherheit durch vorgegebene Bindungen. Das heißt, wir leben in der Moderne in einer Zeit, in der die Einzelnen gefordert sind, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Bei Plessner heißt das mal so schön, man muss das Leben tatsächlich führen, das heißt also, die Führung selbst übernehmen. Und das ist das Schicksal moderner Gesellschaften. Dass wir dann daraus Emanzipationsideologien machen und das Ganze überwölben, indem wir das Individuum zum einzigen Wert einer Gesellschaft hochstilisieren, das ist sozusagen der Versuch, den Verlust abzufangen, den wir deutlich empfinden. "
Die rasenden Bewegungen der Moderne: Vielleicht, meint der in Jena lehrende Soziologe Hartmut Rosa, Autor eines Werkes zur Beschleunigung in der sozialen Welt, setzen sie den Menschen aber nicht nur zu, sondern entsprechen auch einem Sinn-Bedürfnis, das sich in nach-religiöser vor allem durch ein hohes Lebenstempo artikuliert.
"Jeder weiß dass der Tod ihm bevorsteht, und keiner weiß so genau, wie es danach weitergeht. Und so haben wir ein kulturelle Programm entwickelt, das sagt, ich will vor diesem Sterbenmüssen nicht ein metaphysisches oder substantielles Ziel verwirklichen, aber ich will ganz viel Welt ausschöpfen, ich will möglichst viel unterbringen. Ich weiß, dass ich sterben muss, aber bevor es soweit ist, will ich noch ganz viel mitnehmen, ganz viel in mir entfalten, ganz viele Möglichkeiten realisieren. Und so haben wir eine Art von Formalziel entwickelt, das uns dann irgendwann wie eine Lawine auch zu überwältigen droht."
Der Stress wäre dann auch so etwas wie ein verkappter Lebenshunger. Aber vielleicht geht es noch um etwas anderes, vermutet der am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen forschende Philosoph Ludger Heidbrink, Herausgeber eines Bandes zum Unternehmertum als neuer Lebensform. Vielleicht lässt sich der Stress ja auch lustvoll erfahren - indem wir lernen, intelligent mit ihm umzugehen:
" Wir leben eigentlich in einem hypernervösen Zeitalter, müsste man sagen. Auf der anderen Seite lernt man ja auch, mit diesen Prozessen umzugehen. Und die Eigenschaftslosigkeit kann ja eine positive Eigenschaftslosigkeit werden, wenn man diese vielen kleinen Ichs, die wir sind, auf eine sehr intelligente und geschickte Weise miteinander verknüpft. Und die Nervosität, die man verspürt erst mal am Grunde unserer Zeit, kann durchaus ein Stimulans sein, sich immer wieder neu auf die sich verändernden Umwelten einzustellen, ohne dass das jetzt als Überforderung wahrgenommen wird oder als Ich-Verlust oder Identitäts-Verlust."
Tatsächlich trifft sich die Rede vom Stress mit einem anderen Dauerbrenner der Kulturkritik: der vom Verlust der eigenen Identität. Von dieser Verlustgefahr ist vielfach die Rede: Der einzelne verliere seine Wurzeln durch die wilden Rhythmen des Arbeitslebens, das ständige Hin und Her zwischen verschiedenen Orten, durch fatal aufgeweichte Bindungen. Und im Großen etwa sei die kollektive Identität modernen Gesellschaften durch die Migration zumindest herausgefordert. Die Frage ist nur: Was ist Identität? Allzu leicht sitzen wir, wenn wir von ihr sprechen, einem Mythos auf, fürchtet der Soziologe Hans-Georg Soeffner:
"Identität ist ja auch nicht etwas, was man einfach so in der Tasche hat. Das ist nicht etwas, was man gewinnen oder verlieren kann. Also dieses Bild von der verlorenen Identität, als könne man die verlieren wie das Portemonnaie auf der Straße, das ist ein Unfug. Identität ist ein Prozess. Die entsteht, die Identität, als gesellschaftliche im Austausch zwischen Personen. Ich biete denen ein Bild von mir an, die bestätigen das, mein Gegenüber, oder auch nicht. Und ich werde zu dem geformt, was die aus mir machen oder was ich imstande bin aus mir zu machen im Austausch mit anderen. Das ist die soziale Identität. Das ist ein permanenter Austauschprozess."
Ein Prozess mit den Menschen - und auch einer mit den Dingen, mit den Bildern, Tönen, Ideen. Der Mensch lebt in einer Welt, die von allen Seiten auf ihn einstürmt, sein Interesse, seine Aufmerksamkeit zu wecken versucht - und darüber, weil die Konkurrenz groß ist, oft sehr laut und grell. Darum ist die Gefahr groß, dass wir uns ablenken lassen, erklärt Hartmut Rosa. Und geschieht das zu oft, bedroht das am Ende jede ernsthafte Kultur.
"2Es ist ganz schwierig, Relevanzstrukturen zu bestimmen. Es gibt keine sicheren und verlässlichen Programme, die Qualität unterscheiden können. So dass tatsächlich das hervorsticht und Aufmerksamkeit findet, was an der Oberfläche schillert und glitzert. Man kann sich das so vorstellen, dass wir fast durch unsere Welt, durch unsere Kultur gehen wie durch einen Supermarkt, durch dessen Regale. Und da werden unsere Blicke an den Produkten haften bleiben, deren Attraktivität ich von außen erkennen kann. Aber jene Tätigkeiten oder Praktiken oder Kulturprodukte, deren Wert sich nur enthüllt, wenn man sich lange damit beschäftigt, die drohen dabei unterzugehen.""
Immerhin lenken die lauten Botschaften davon ab, sich mit einem Umstand auseinanderzusetzen, der nun immer offensichtlicher wird: Das ganze Treiben bringt nichts. Es geht nicht mehr voran. Die Erfolgsgeschichte, die der Westen so lange von sich selbst erzählte, sie stimmt nicht mehr. Wir können nicht mehr sicher sein, dass die Zukunft eine bessere ist. Aber das, erläutert Rosa, treibt uns nur noch mehr an:
" Das kann man gut daran ablesen, dass zum ersten Mal eigentlich seit Jahrhunderten Eltern nicht mehr in dem Bewusstsein handeln, dass ihre Kinder es einmal besser haben soll, materiell, aber auch in sozialer Hinsicht, sondern dass sie ständig in Sorge leben, dass die Kinder es nicht mehr so gut haben werden, dass wir an Abhängen oder Abgründen sogar stehen. Also die Zukunftshorizonte haben sich massiv eingetrübt, so dass man das Gefühl hat, man muss sich jedes Har ein bisschen mehr anstrengen - nicht damit man ein besseres Leben verwirklicht, sondern damit man nicht in die Krise rutscht."
Über diese Gefahr ist ein neues Leitbild entstanden: Der flexible Mensch, neudeutsch: Die Ich-AG. Der Einzelne soll sich mehr um sich selbst kümmern, aktiv werden, sich als ganzen einbringen, zwischen Beruf und Freizeit nicht mehr unterscheiden. Der Einzelne wird zum Projektmanager seiner selbst. Ist das ausschließlich ein Schreckensbild? Nicht unbedingt, meint Ludger Heidbrink:
" Diese Idee des Unternehmertums hat sich dann in den letzten, sagen wir zwei Jahrzehnten sehr stark ausgeweitet in die Gesellschaft hinein, sodass man heute von einer unternehmerischen Gesellschaft sprechen kann. Wir sind alle mehr oder weniger Unternehmer unserer selbst. Es wird von uns erwartet, ein erfolgreiches Leben zu führen, mit knappen Ressourcen vernünftig zu haushalten, in einem permanenten Wettbewerb zu stehen. Also erfolgreich und wettbewerbsorientiert und leistungsorientiert zu handeln."
Natürlich handelt es sich hier auch um eine Behelfs-Ideologie, die heraushelfen soll aus der Not. Der Sozialstaat ächzt unter der Last der Zuwendungen, die er aufbringen muss. Und der Arbeitsmarkt vermag die Massen nicht zu fassen, die auf ihn drängen. Zugleich werden Spezialisten unterschiedlichster Art dringend gesucht. In diese Situation passt ein Menschenbild, das dem einzelnen höhere Selbstständigkeit unterstellt. Insofern, bemerkt Ludger Heidbrink, handelt es sich um ein höchst ambivalentes Menschenbild:
"Also diese Flexibilisierung des eigenen Lebens hat ja häufig auch sehr positive Seiten. Und ich glaube, dass man häufig denjenigen, die sich in solchen Berufs- oder sagen wir lieber: Quasiberufsformen selbst verwirklichter Arbeitsprozesse befinden, dass man denen häufig unterstellt, dass sie sich in einem prekären Arbeitsverhältnis befinden. Das sind häufig Formen der Selbstverwirklichung, die glaube ich, in Zukunft immer notwendiger werden, um mit geringen Mitteln das Beste daraus zu machen."
Das Beste daraus zu machen: Das gelingt ja auch, jedenfalls doch recht häufig. Und das wirft wieder einen kleinen Zweifel auf: Sind die Worte von der Orientierungslosigkeit, von der dauernden Überforderung, von der Unfähigkeit, sich zurecht zu finden - ist dieses Gerede nicht zumindest zum Teil auch schlichtes kulturkritisches Geplänkel, vielleicht auch Geschäftsgrundlage all der Berater unterschiedlichster Couleur, die ein Krisenszenario entwerfen, auf dem sie dann ihr Geld verdienen? Durchaus möglich, meint Hans-Georg Soeffner. Denn eigentlich klappt es mit unserer Orientierung doch recht gut.
"Wir haben eine Freizeitindustrie entwickelt, die es uns erlaubt, neben dem Beruf Freundeskreise permanent aufzubauen in einer Nebenwelt. Wir haben dann unsere Berufswelt, und wir wissen genau, wann wir von welchem Sektor in den anderen übergehen. Wir haben unsere Familien, die eine größere Bedeutung haben. Das heißt, wir leben in unterschiedlichen Sektoren, aber nicht so, als wären wir nun völlig verwirrt und würden automatisch multiple Persönlichkeiten. Nein, ganz im Gegenteil: Wir wissen, was wann wo zu tun ist. Wenn Sie sich das Leben eines modernen Menschen ansehen, einen Tagesablauf ansehen, dann werden sie feststellen, der ist alles andere als ungeordnet."
Und doch, das Unbehagen will nicht weichen, ob es nun zuviel unverdauter kulturkritischer Lektüre entstammt oder harter realer Erfahrung. Auf jeden Fall muss man sich einlassen auf die vielen Anforderungen der Gegenwart, auf all die Rollenspiele und kleinen Inszenierungen, die Tag für Tag gefordert sind. Sie, erklärt Hartmut Rosa, sind in der Tat unverzichtbar. Man muss sie annehmen, ansonsten wird man auch kulturell sehr schnell zum Freak und Außenseiter.
"Wer das also nicht will, wer nicht zu einem spätmodernen Spieler werden will, hat eine andere Strategiemöglichkeit, dass er nämlich an irgendeinem Punkt seines Lebens einen Parameter sozusagen als unveränderbar setzt. Zum Beispiel, indem er in irgendeiner Form fundamentalistische Neigungen entwickelt. Das kann religiöser Art sein, das kann auch ein politischer Fundamentalismus oder in einer anderen Art sein. Und wer weder zu dieser Art von stabiler Verankerung fähig ist oder auch nicht fähig ist, zum Spieler zu werden, der ist dann in der Tat bedroht, unterzugehen in der Welt und depressive oder an Burn-out erinnernde Symptome zu entwickeln."
Aktiv und auf der Höhe der Zeit zu bleiben, erfordert seinen Preis. Kein Wunder darum, dass die Kultur- und Zivilisationskritik nicht verstummt, die Bilder einer alternativen Gesellschaft die Menschen weiterhin faszinieren, teils auch zu politischen Programmen werden. Die Frage ist nur: Wie weit führt diese Kritik? Vermag sie tatsächlich etwas zu ändern? Das System? Der Philosoph Ludger Heidbrink ist skeptisch. Denn das System - das sind wir letzten Endes selbst.
"Wir haben ja eine sehr lange Tradition gerade in Deutschland, die man als antibürgerliche Kulturkritik bezeichnen könnte. Und was man beobachten konnte, ist, dass all diese Kritik, die sich ja auch gegen den Liberalismus, die Ökonomisierung der modernen Gesellschaft gerichtet hat, eine Kritik am Bürger selbst gewesen ist. Und das beobachtet man ja heute auch teilweise wieder. Wenn wir gegen ein bestimmtes Konsumverhalten zu Felde ziehen, wenn wir gegen unsere exzessive, Ressourcen verschlingende Wirtschaftskultur und -form zu Felde ziehen, kritisieren wir eigentlich uns selbst. Und das ist eben ein Ausfluss einer bürgerlichen Kultur, die heute sozusagen zur Diskussion gestellt wird von den Bürgern selbst."
Der Bürger, der sich selbst in Frage stellt. Eigentlich stellt er damit alles in Frage. Und wirklich lässt sich derzeit in Stuttgart eine Diskussion eröffnen, um der es zumindest unterschwellig und bei manchen der Teilnehmer um mehr geht als nur die Frage eines unterirdischen Bahnhofs. In dem Protest scheinen sich zumindest zu Teilen auch naturschützerische, konsumkritische Motive auf, ebenso Stimmen, die neue demokratische Verfahren fordern, weil die alten - angeblich - auf die Gegenwart nicht mehr passten. Das ist durchaus in Ordnung, erklärt Hans-Georg Soeffner. Nur gelte es zu bedenken, dass die Demokratie sich grundsätzlich selbst erneuere, nicht nach Umsturz und abruptem Wechsel verlange, sondern nach behutsamer Nachbesserung.
" Demokratie ist kein festes System. Sondern Demokratie ist ein Prozess, ein Anpassungsprozess, indem die Gesellschaft die bestmögliche Form des Lebens zu finden versucht innerhalb von Interessenkonflikten. Und in dem Augenblick, in dem Bürger sich schlecht repräsentiert fühlen durch die Politik in einem repräsentativen System oder ihre Interessen nicht wahrgenommen fühlen innerhalb eines Verbandes, in dem Augenblick gibt es natürlich Revolten - das ist vollkommen zwangsläufig. Und das heißt dann wiederum, besteht die Aufgabe der Zivilgesellschaft darin, das, was in dem demokratischen Apparat, den wir bisher haben, nicht funktioniert, mit den bisher geltenden Regeln evolutionär umzuformen. Nicht zu revoltieren, sondern die Evolution ernst zu nehmen und die Reparaturmaßnahmen vorzunehmen, die jetzt in der Gesellschaft von uns gefordert werden."