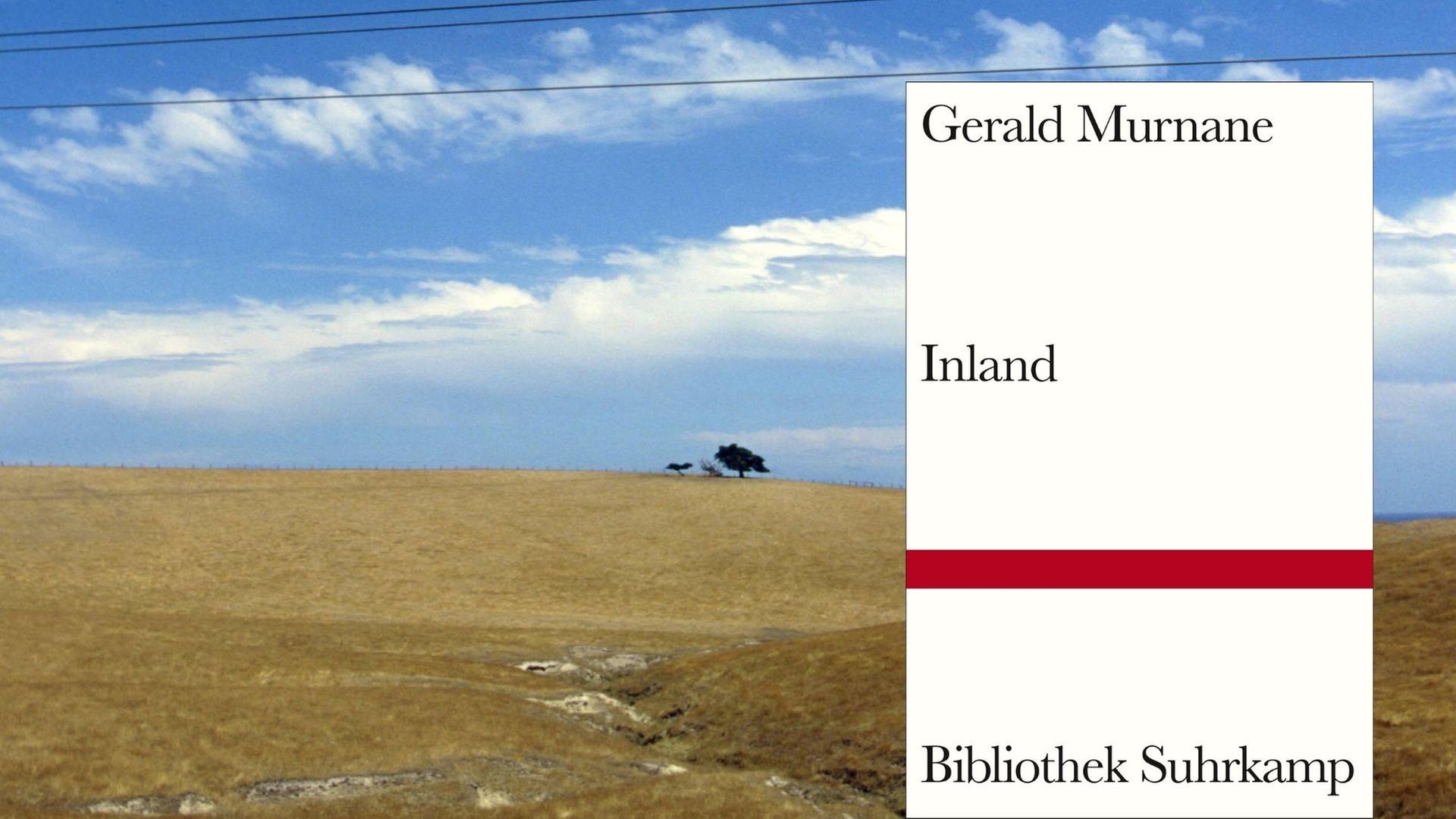
Mit Blick auf Gerald Murnanes Gesamtwerk könnte man den Prosatext „Inland“ aus dem Jahr 1988 als den ersten Anlauf des australischen Autors werten, sich aus den Konventionen des realistischen Erzählens zu befreien. Ein Erzähler sitzt an seinem Schreibtisch in Australien und schreibt über einen Autor, der sich in der Bibliothek seines Herrenhauses im ungarischen Komitat Szolnok befindet und Briefe an seine junge Lektorin zu schreiben beabsichtigt, die ihrerseits im Calvin O. Dahlberg Institute im amerikanischen South Dakota arbeitet. Aber ob dieser Autor tatsächlich an einem Buch schreibt und was eigentlich sein Thema sein könnte, bleibt unklar. Nach kurzer Zeit hält er inne:
„Mir gefällt es nicht, was ich soeben geschrieben habe. Ich glaube, dass es meiner Lektorin auch nicht gefallen wird, wenn sie es liest.“
Im Spiegelkabinett der Postmoderne
Und so geht es eine ganze Weile weiter. Der Autor denkt nach über das Schreiben an seine Lektorin, die er noch nie gesehen oder gesprochen hat. Er formuliert seine Angst vor einem fertigen Buch, das er als Auslöschung der Autorschaft begreift. Ja, er versetzt sich sogar in dieses ferne Calvin O. Dahlberg Institute und phantasiert über die Eifersucht des Ehemannes der Lektorin auf die Briefe, die er abschicken will, aber wahrscheinlich niemals schreiben wird.
Spätestens hier wird die Lage unübersichtlich. Australien, Ungarn, USA? Die Handlungsorte überlagern sich. Von einem Plot kann nicht die Rede sein. Zeitebenen schieben sich ineinander und es wird zunehmend schwierig, die Identität von Autor und Erzähler überhaupt noch zu unterscheiden.
Aber Murnane spart nicht mit Fingerzeigen. Der Australier liebt es, mit literarischen Zitaten und Schriftstellernamen zu spielen und damit Zeichen zu setzen. Da ist zum Beispiel eben dieses Calvin O. Dahlberg Institute. Nimmt man nur den Namen und macht aus Calvin O. „Calvino“, dann führt die Spur zu Italo Calvino, also dem italienischen Autor, der als Vertreter der Postmoderne der Instabilität von Identität und sogenannter Wirklichkeit das Wort redete und diese mit literarischen Techniken wie Metafiktionalität und Reflexionen über das Schreiben selbst aushebelte. Nichts Anderes betreibt Gerald Murnane in diesem Frühwerk in teilweise durchaus schalkhafter Manier.
Aber Murnane spart nicht mit Fingerzeigen. Der Australier liebt es, mit literarischen Zitaten und Schriftstellernamen zu spielen und damit Zeichen zu setzen. Da ist zum Beispiel eben dieses Calvin O. Dahlberg Institute. Nimmt man nur den Namen und macht aus Calvin O. „Calvino“, dann führt die Spur zu Italo Calvino, also dem italienischen Autor, der als Vertreter der Postmoderne der Instabilität von Identität und sogenannter Wirklichkeit das Wort redete und diese mit literarischen Techniken wie Metafiktionalität und Reflexionen über das Schreiben selbst aushebelte. Nichts Anderes betreibt Gerald Murnane in diesem Frühwerk in teilweise durchaus schalkhafter Manier.
„Ich schreibe über mich, wie ich im Garten eines großen Hauses – aber keineswegs eines Herrenhauses – stehe, zwischen Hopkins River und Russels Creek. (…) Es tut mir leid für dich, Leser, wenn du meinst, ich täusche dich. Ich kann schwerlich den Streich vergessen, den du mir gespielt hast. Du erlaubtest mir eine lange Zeit zu glauben, ich schriebe einer jungen Frau, die ich meine Lektorin nannte. (…) Jetzt liest du immer noch, und ich schreibe immer noch, aber keiner wird dem anderen vertrauen.“
Der träumende Erzähler
Dieses Spiel mit dem Leser bzw. mit der Leserin tritt im Verlauf des Buches zurück. Die Fragen nach Identität, Autorschaft und dem „Wahrheitsgehalt“ von Literatur aber begleiten den sich ständig verzweigenden Erzählfluss auch weiterhin. Und immer wird die „Schwere“, die „Last“ des Schreibens, „das Gewicht der Worte“ hervorgehoben. Murnanes schreibender, sich erinnernder, träumender Erzähler taucht nun in die Tiefen seiner Herkunft und Kindheit ab. Der Schauplatz wechselt nach Australien. Von einem Jungen ist die Rede, dessen Familie ständig mit ihren wenigen Habseligkeiten vor Gläubigern fliehen muss, da der Vater sich beim Wetten auf Rennpferde immer wieder verschuldet. Einem Jungen, der sich mit religiösen Konventionen schwertut wie auch mit seiner Sexualität und den Mädchen.
Die Vielschichtigkeit allen Seins
Details, die ein gewisses Außenseitertum markieren, und sich auch in Gerald Murnanes eigener Lebensgeschichte finden lassen. Wie sein Erzähler sitzt Gerald Murnane, dieser für den Nobelpreis gehandelte Einsiedler, in seiner Schreibklause mit Blick auf weite Grasebenen, umgeben von Büchern, Atlanten und Karten. Im freien, assoziativen Gedankenflug lässt dieser Autor Sehnsuchtsorte, Landschaften und Figuren ineinander verschwimmen. Den einen Ort, das eine Leben, die eine literarische Wahrheit, so muss man Murnanes Prosa wohl verstehen, gibt es nicht. Ironie und Listigkeit sind diesem ausgeklügelten Schreibverfahren eigen, aber auch eine melancholische Schwere:
„Jedes Jahr, wenn ich mich auf dem Friedhof von Fawkner umschaue, weiß ich, dass ich auf den Ort schaue, an dem all meine Leben, wirkliche und vermutete, enden werden. Wer immer ich bin, wer immer ich auf andere Weise gewesen sein könnte – die Leben all dieser Menschen werden in dem einen Grasland enden, nur vier Kilometer von der Straße entfernt, wo ich geboren wurde.“
Gerald Murnanes Buch „Inland“ ist, salopp gesagt, eine harte Nuss. Sie zu knacken wird jedoch zum intellektuellen Vergnügen, wenn man als Lesende weniger nach einem stringenten Handlungsverlauf sucht, als sich mehr auf die Fährten einlässt, die der australische Autor auslegt. Mit seiner kunstvollen Verwendung von Zeichen, Zitaten, sich wiederholenden Motiven, Bildern und Gedankenschleifen führt er uns in ein Spiegelkabinett der produktiven Verunsicherung. Letztendlich ist dieses Buch eine Demonstration der unendlichen Möglichkeiten von Literatur.
Gerald Murnane: „Inland“
Aus dem Englischen von Rainer G. Schmidt
Suhrkamp Verlag (Bibliothek Suhrkamp), Berlin.
240 Seiten, 22 Euro.
Aus dem Englischen von Rainer G. Schmidt
Suhrkamp Verlag (Bibliothek Suhrkamp), Berlin.
240 Seiten, 22 Euro.


