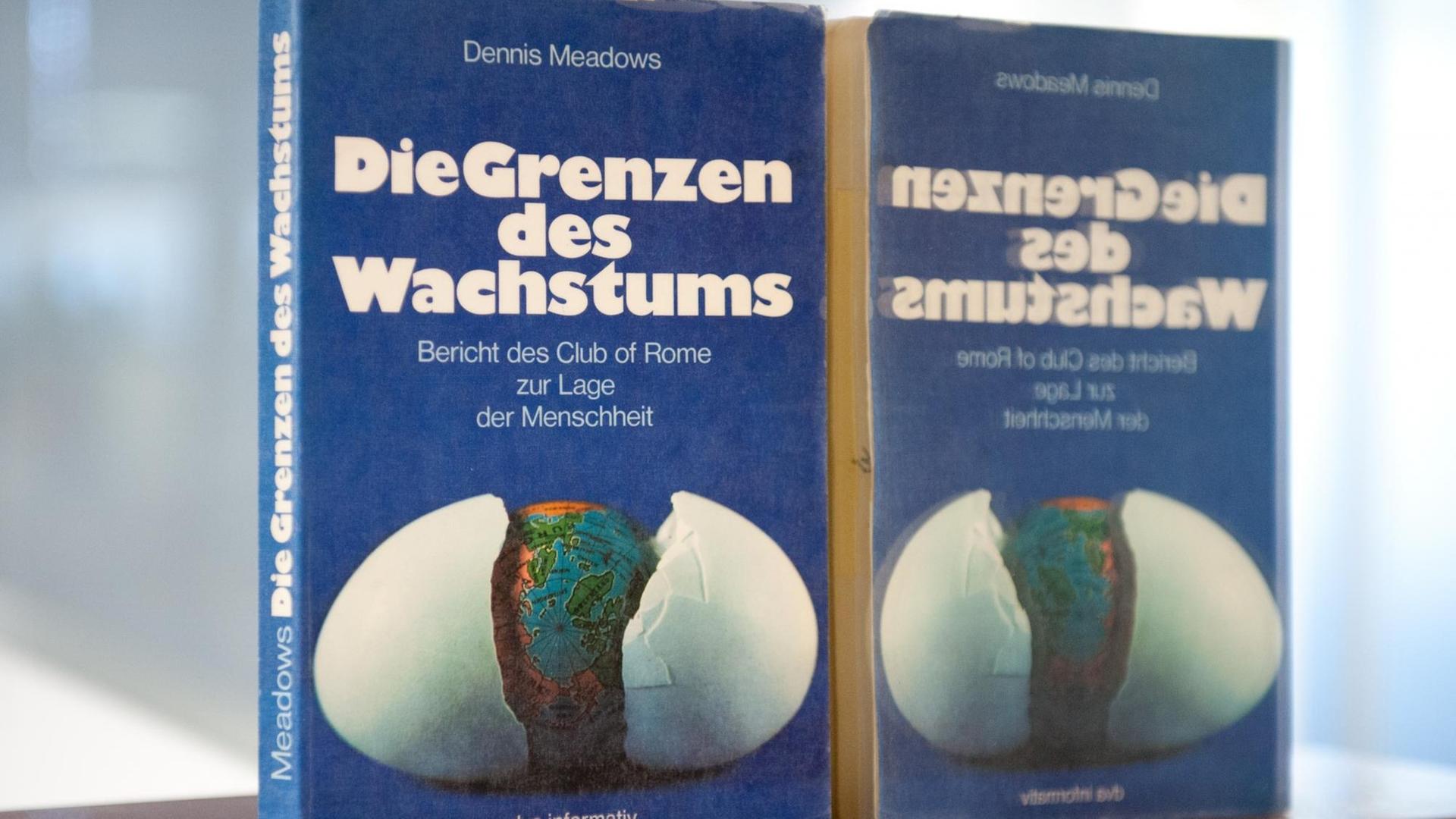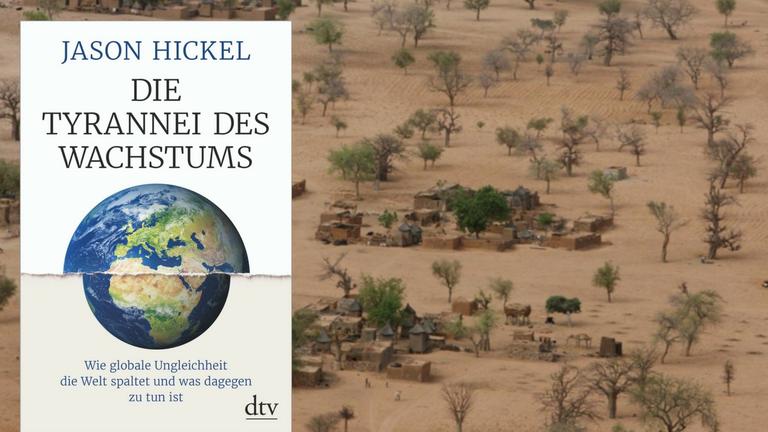
"Wenn Mythen zerfallen, entstehen Revolutionen", schreibt der britische Anthropologe Jason Hickel, und gleich darauf zertrümmert er einige Mythen. Beispiel globale Armut: Internationale Organisationen wie die Weltbank oder die Vereinten Nationen sprechen immer wieder von Erfolgen im Kampf gegen den Hunger. Jason Hickel nimmt dieses gängige Bild auseinander: Seiner Ansicht nach sind die zugrunde gelegten Zahlen schlicht falsch.
Für die Vereinten Nationen ist ein Mensch unterernährt, wenn er weniger als 1600 bis 1800 Kalorien am Tag zu sich nimmt. Allerdings gehen die Statistiker der UN von einem sitzenden Lebensstil aus. Was weltfremd ist: Gerade wer arm ist, muss meist körperlich schwer schuften. Ein Rikscha-Fahrer in Indien braucht drei- bis viertausend Kalorien pro Tag.
Zahlen können täuschen
Wissenschaftliche Erkenntnisse sprächen dafür, die Armutsgrenze nicht wie die Weltbank lange Zeit bei 1,25 Dollar und heute bei 1,9 Dollar zu ziehen, sondern bei fünf Dollar, schreibt der an der London School of Economics lehrende Hickel:
"Dann würden wir feststellen, dass etwa 4,3 Milliarden Menschen in Armut leben. Das ist mehr als das Vierfache dessen, was Weltbank und Milleniums-Kampagne uns glauben machen wollen. Es wären über 60 Prozent der Weltbevölkerung. Und noch wichtiger: Wir würden sehen, dass die Armut im Laufe der Zeit immer schlimmer wird. Unter Wissenschaftlern besteht völlige Einigkeit, dass die Armutsgrenze von 1,25 Dollar pro Tag viel zu niedrig ist. Sie wird jedoch weiterhin verwendet, weil sie die einzige Grenze ist, die Fortschritte bei der Armutsbekämpfung erkennen lässt, zumindest, wenn China mitgezählt wird. Daher ist sie auch die einzige Grenze, die die jetzige wirtschaftliche Ordnung rechtfertigt."
Die Lebensverhältnisse auf der Erde haben sich nach Hickels Erkenntnissen voneinander entfernt: So habe sich etwa die Einkommenslücke zwischen Nord und Süd seit 1960 verdreifacht. Der Süden könnte heute besser da stehen, wenn der Norden sich nicht eingemischt hätte, schreibt der Autor. Denn als die Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika ab den 1950er Jahren unabhängig wurden, taten sie, was die früh industrialisierten Länder wie England oder die USA anfangs auch gemacht hatten.
Wohlstandsmodell des Westens
Sie förderten durch Zölle, Subventionen und andere Schutzmaßnahmen den Aufbau einer eigenen Industrie - mit Erfolg. In den 60er Jahren hatten diese Länder hohe Wachstumsraten, was auch Umverteilung ermöglichte. Die Lage für die Bevölkerung verbesserte sich deutlich, für Jason Hickel ein "postkoloniales Wirtschaftswunder".
Die Länder organisierten sich in der Gruppe der 77 und entwarfen sogar eine neue Weltwirtschaftsordnung, die aber am Widerstand des Nordens und den Umständen des Kalten Kriegs scheiterte. Das Wohlstandsmodell des Westens beruhte seit der Kolonialzeit wesentlich auf dem Süden als billigem Rohstofflieferanten und Absatzmarkt für Produkte.
Jason Hickel schreibt: "Die developmentialistische Revolution - und die wachsende politische Macht des Südens - nagte an den Fundamenten des Weltsystems, von dem Europa und die Vereinigten Staaten sich abhängig gemacht hatten."
Der Autor beschreibt die Rolle der reichen Länder im armen Süden: Etliche progressive Regierungschefs in Entwicklungsländern wurden gestürzt oder ermordet: Mohammad Mossadegh im Iran, Thomas Sankara in Burkina Faso oder Patrice Lumumba im Kongo. Der Westen verhalf reihenweise Diktatoren zur Macht.
Explodierende Staatsschulden
Zu Pass kam dem Westen dann - so eine zentrale These des Autors - die Schuldenkrise der Entwicklungsländer. Zum Aufbau ihrer Industrien hatten sie begierig Kredite aufgenommen, die ihnen westliche Banken offerierten, die wiederum händeringend nach Anlagemöglichkeiten für die Petrodollars der Ölscheichs suchten. Kredite gab es mit variablen Zinsen, die sich an den US-Zinsen orientierten. Als die US-Notenbank Mitte der 70er Jahre zur Inflationsbekämpfung daheim die Zinsen auf bis zu 21 Prozent anhob, explodierten die Staatsschulden im globalen Süden.
Jetzt traten der IWF und die Weltbank auf den Plan. Hilfskredite gewährten sie nur gegen die Umsetzung sogenannter Strukturanpassungen. Was harmlos klingt, waren sozial folgenreiche Einschnitte. Die Länder mussten Märkte öffnen, Ausgaben kürzen und öffentliche Unternehmen veräußern.
"Das heißt, dass staatliche Vermögenswerte und Sozialausgaben rückwirkend als Sicherheiten für die Tilgung von Auslandsschulden herangezogen wurden - ein Arrangement, dem der Kreditgeber natürlich nicht zugestimmt hatte, als er den Kreditvertrag unterschrieb. Letztlich lief das Ganze auf einen riesigen Wohlstandtransfer aus den Staatskassen der verarmten Länder des Globalen Südens an die reichen Banken des Westens hinaus. Außerdem wurden sie gezwungen, ihre Volkswirtschaften auf Export auszurichten, um mehr Devisen für den Schuldendienst einzunehmen. Das heißt, dass sie die Importsubstitutionsprogramme aufgeben mussten, die sie während der developmentialistischen Ära so erfolgreich umgesetzt hatten."
Angesichts heutiger Migrationsbewegungen wird man bei dieser Lektüre nachdenklich und fragt sich, wie die Welt wohl aussähe, wenn man dem Süden nicht die neoliberale Politik aufgezwungen hätte.
Radikale politische Forderungen
Wie soll es weitergehen? Von Entwicklungshilfe hält der Autor wenig. Die Lösung sieht er unter anderem in radikalen politischen Veränderungen, etwa fairen Welthandelsregeln, einem globalen Mindestlohn, einem bedingungslosen Grundeinkommen und einem Schuldenschnitt für Entwicklungsländer. Aber selbst solche Entscheidungen könnten die Menschheit nur voranbringen, wenn sie sich vorher von der Tyrannei des Wachstums verabschiede.
Der Autor schreibt pointiert und kurzweilig, aber teilweise auch zu eindimensional. Viel zu kurz kommt bei Jason Hickel die Bedeutung des Kalten Krieges und die Verantwortung der Eliten in den Ländern des Südens.
Trotzdem ist es ein großartig ernüchterndes Buch. Die Analyse mag deprimierend sein, aber der Autor schafft es, die Vorstellung beim Leser zu wecken, dass eine andere und bessere Welt möglich ist.
Jason Hickel: "Die Tyrannei des Wachstums. Wie globale Ungleichheit die Welt spaltet und was dagegen zu tun ist"
dtv, 430 Seiten, 28 Euro.
dtv, 430 Seiten, 28 Euro.