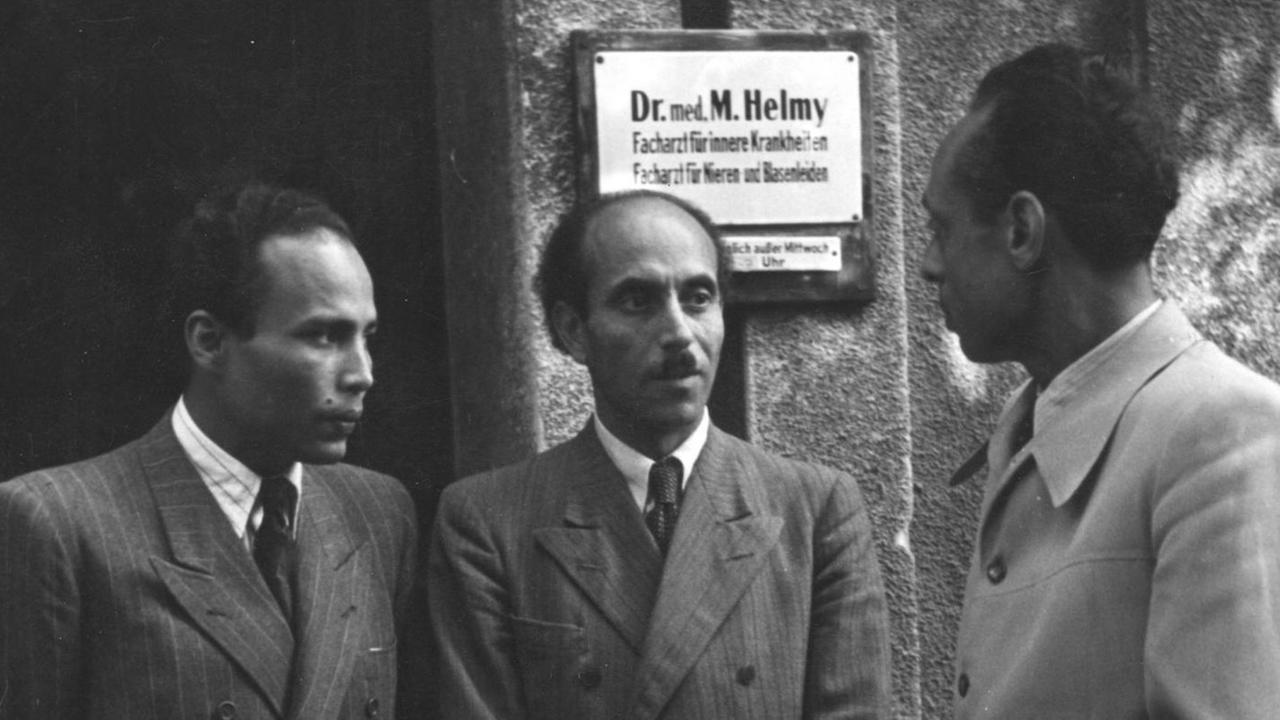Es dauert nicht lang, bis Amro seine Scheu abgelegt hat. Die Fremdenführerin zeigt der Gruppe gerade die zweite Baracke, die Latrinen, die aus 180 Löchern im Boden bestanden - da hakt Amro nach:
"Ich habe eine Frage - das ist ein bisschen komisch: Aber als sie auf der Toilette waren, wie haben sie sich sauber gemacht?"
Die Fremdenführerin antwortet:
"Sie haben sich nicht sauber gemacht. Das war egal. Außerdem: Viele Häftlinge hatten keine Gelegenheit, auf die Toilette zu gehen oder keine Kraft mehr. Vielen, auch weil sie psychisch krank waren wegen Abmagerung, war es egal, ob sie auf die Toilette gingen oder in die Hose gemacht haben. Man kann sich vorstellen, wie furchtbar es im ganzen Lager stinken musste - in diesen Baracken, in den Wohnungsbaracken und auch draußen auf dem Gelände."
"Es gibt keine Worte, solche Gefühle zu beschreiben"
Amro erfährt von den unmenschlichen Bedingungen, unter denen die Gefangenen, die meisten von ihnen Juden, im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau lebten und Sklavenarbeit verrichten mussten. Wieder draußen, auf dem Kiesweg, zeigt sich der 24-jährige Syrer entsetzt:
"Ich weiß nicht, es gibt keine Worte, die man sagen kann, um solche Gefühle zu beschreiben. Es ist sehr schrecklich. Die Leute werden die ganze Zeit umgebracht, verhungern, die waren immer krank. Das fasst mich sehr an."
Amro gehört zu einer Gruppe muslimischer Flüchtlinge und junger Juden, die seit gestern das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz besucht. Vor drei Jahren ist er nach Deutschland gekommen, inzwischen studiert er Architektur in Erfurt.
"Wir sind hier, um voneinander zu lernen"
Ein wenig später ist die Gruppe bei den Trümmern der Gaskammern und Krematorien angekommen. Die Deutschen hatten sie kurz vor ihrem Abzug aus Auschwitz gesprengt, um die Spuren von ihrem Massenmord an den Juden zu verwischen. Auch hier stellt Amro eine Frage: Warum sich die Juden hierher, in diesen Teil des Lagers treiben ließen, will er wissen. Sicher hätten sie doch den süßlichen Geruch des verbrannten Fleisches wahrgenommen, der von hier strömte? Irith Michelsohn von der "Union progressiver Juden", eine der Veranstalterinnen der Reise, versucht zu erklären:
"Aber es gab doch hier kein Entkommen mehr. Das war Endstation. Es war doch nicht die Chance da für jemanden zu sagen: Ich will das nicht. Es wollte keiner sterben. Und du musst immer denken: Die Leuten waren krank, die Leute waren schwach. Du konntest kaum Widerstand leisten."
Hier hatte Amro ein heikles Thema berührt. Viele überlebende Juden stellten sich nach dem Holocaust die Frage, ob ihr Volk nicht mehr Widerstand hätte leisten können oder leisten müssen.

Aber genau diese Momente seien wichtig, meint Dan Rattan, 26 Jahre alt, der in Passau Journalismus und strategische Kommunikation studiert:
"Ich sage mal, ich als Jude in Deutschland habe mich mein Leben lang mit der Geschichte der Shoa auseinandergesetzt. Während jemand, der seit zwei Jahren in Deutschland ist, wahrscheinlich eher weniger damit zu tun hat. Aber das ist ja auch in Ordnung. Darum sind wir ja auch hier, um nicht nur durch Führungen zu lernen, sondern auch voneinander zu lernen. Ja, ich habe das Gefühl, es ist eine recht offene Gruppe. Man redet viel miteinander. Man kann sich auch alles fragen."
Direkt vor den Trümmern der Gaskammern hält die Gruppe eine kleine Andacht. Zwei Kerzen flackern im Wind. Die Muslime sprechen die Al-Fatiha, die erste Sure des Koran mit ihrem Lobpreis Gottes und der Bitte um göttliche Führung. Die Juden sprechen das Kaddisch, das Totengebet. Eine der beiden Kerzen bläst der Wind aus, aber die Teilnehmer setzen alles daran, auch sie wieder anzuzünden.
Eine Botschaft für das Zusammenleben
Die gemeinsame Reise von Juden und Muslimen nach Auschwitz ist ein Pilotprojekt. Letztendlich gehe es dabei nicht in erster Linie um Geschichte, sondern um das Zusammenleben der beiden Glaubensgemeinschaften in Deutschland, erklärt Irith Michelsohn bei einer Pause auf dem Marktplatz der Stadt Auschwitz:
"Die Muslime, die geflüchtet sind, also nicht in Deutschland geboren, ich sage mal aus Syrien kommen, die haben etwas anderes gelernt. Das ist vorurteilsfrei. Die haben gelernt, dass wir Juden ins Meer gehören, dass der Staat Israel vernichtet gehört. Das haben die gelernt, so wie ich als geborene Jüdin mein Judentum, sage ich mal salopp, mit der Muttermilch aufgesaugt habe."
Zum Hintergrund der gemeinsamen Reise gehört also auch der Vorwurf, der oft erhoben wird: Viele Muslime aus dem Nahen Osten hätten antisemitische Vorurteile mit nach Deutschland gebracht. Thaer Issa vom Zentralrat der Muslime in Deutschland, der andere Veranstalter der Reise, widerspricht:
"Ich bekomme auch immer zu hören: Wir haben noch nie einen Juden gesehen. Wir wissen nicht, wie sie leben, wie sie denken, wie sie über uns auch denken. Ich denke, die Reise, das ist auch eine Botschaft, dass wir das machen können, dass ein Zusammenleben gelingen kann."
"Wir haben viele Gemeinsamkeiten"
Thaer Issa betont, dass auch das auch das Interesse am Holocaust groß sei. Er selbst organisiert schon seit zwei Jahren immer wieder Besuche von Flüchtlingen in Buchenwald, zum dortigen ehemaligen Konzentrationslager. Er habe meistens gar nicht genug Plätze für alle, die teilnehmen wollten.

Nicht nur die Muslime lernen etwas bei der gemeinsamen Reise. Amro, der Architektur-Student, erzählt auf dem Weg zum Ausgang des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, wie ihn Nachrichten aus Syrien immer wieder nervös machen. Etwa, wenn seine Schwester in Tränen aufgelöst anruft - und es dann glücklicherweise doch nur um einen Streit in der Familie geht. Amanda Pidgornij, 18 Jahre alt aus Hamburg, hört ihm aufmerksam zu. Die beiden haben sich angefreundet:
"Ich habe über seine Religion etwas erfahren, und er hat ein bisschen was über mich und meine Religion etwas erfahren. Und so haben wir auch gemerkt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir in vielen Dingen gleich denken und auch gleich glauben. Wir beide zum Beispiel glauben, dass es ein und derselbe Gott ist in allen drei monotheistischen Religionen, im Christentum, im Judentum und im Islam. Dass wir an den gleichen Gott glauben und deshalb auch gemeinsam beten können."