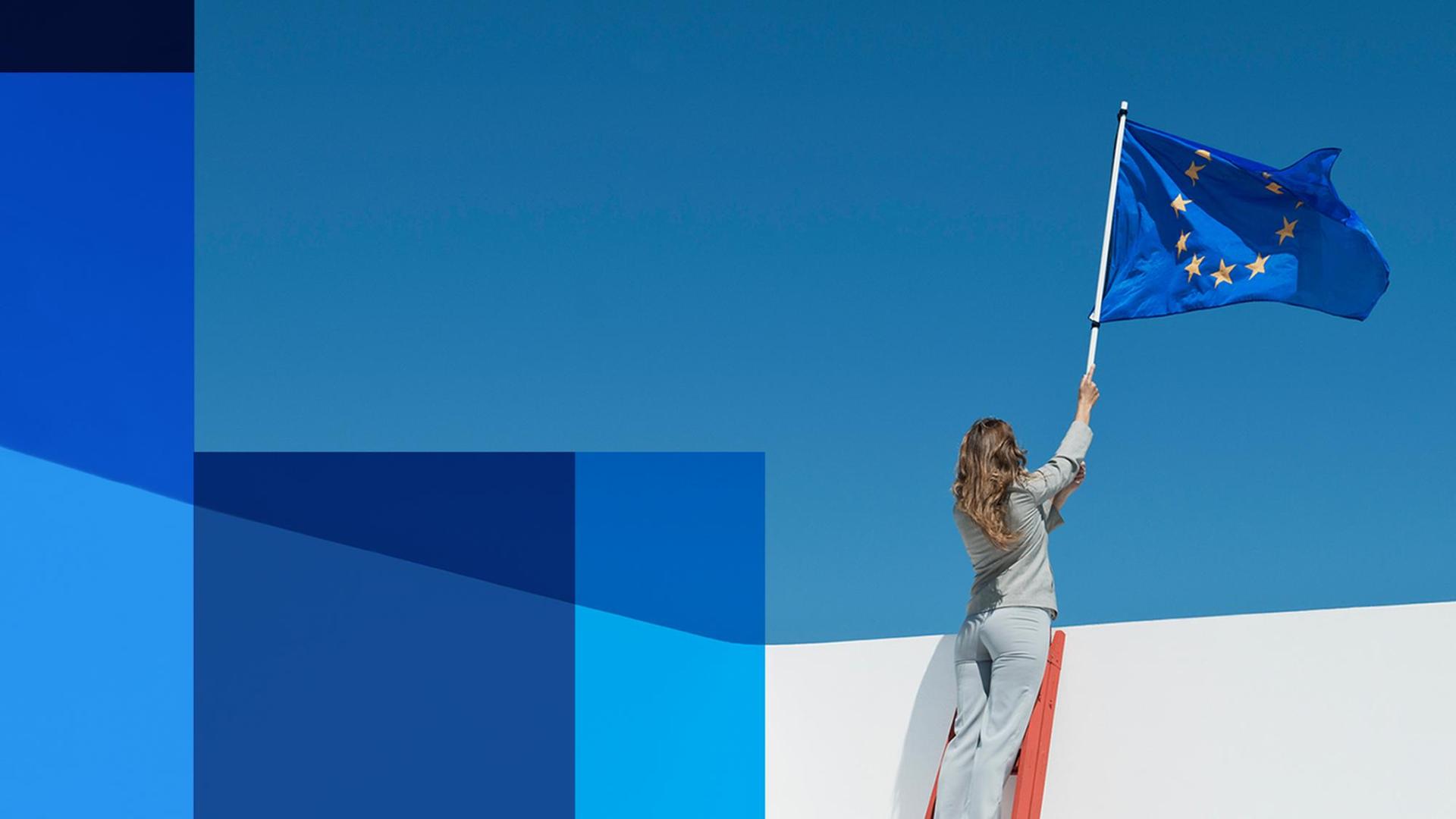Das Leben eine Entgleisung, ein Scheitern, ein ewiges Verheddern in immer neuen Netzen: Man kann wieder wunderbar die Schultern hängen lassen zu den Songs von Kristofer Aström. Man wird diesmal zugleich unweigerlich an den Rock der 70er-Jahre denken: an Tom Petty oder Jackson Browne, und dahinter steckt Methode. Zu der nicht nur, aber auch gehörte, dass Aström im Göteborger Studio nur Gitarren, Verstärker, Mikrofone und sonstiges Equipment bis jüngstens Jahrgang 1978 zugelassen hat.
"Eigentlich wollten wir 1977 als Grenze festlegen, aber dann hätten wir den Drummer feuern müssen, der ist 1978 geboren."
Natürlich hört dieser leise, dünne Mann mit der blonden Matte und der Lederjacke die Songs, die ihn so inspirieren, nicht per Streaming oder sonst wie digital, sondern von Schallplatte. Ohne Liebhaber-Schnickschnack.
"Ich brauch kein 180-Gramm-Vinyl, die alten Platten klingen nicht schlechter. Ich kaufe Ein-Euro-Platten auf dem Flohmarkt: ‚Hey, Deep Purple!' Die alten Klassiker."
"Die alten Klassiker." Wobei Aström mit seinen eigenen Songs da weniger an Deep Purple als an die Eagles oder Fleetwood Mac anknüpft. Den klassischen Westcoast-Rock eben.
"Ihre Songs haben eine dunkle und eine helle Seite. Abends kam das Dunkle raus, da haben sie getrunken und sonst etwas genommen und Musik gemacht. Und am nächsten Morgen gingen sie surfen."
Einfluss der Vaterrolle auf den Musiker
Einem melancholischen Schweden sind Surfen und kalifornische Sonne naturgemäß eher fern, wobei Kristofer Aström als Skateboarder den Asphalt den Wellen ohnehin vorzieht. Seit der 41-jährige vor zwei Jahren Vater wurde, haben sich die exzessiven Nächte allerdings auch erledigt. Kristofer Aström wird deshalb nicht ausgiebig auf Tour gehen mit seinen neuen Songs. Und aufnehmen musste er sie binnen einer Woche, weil nicht nur er, sondern auch die halbe Band familiäre Verpflichtungen hatte. Schreibblockaden kenne er eigentlich nicht, sagt er - trotzdem sei es schwer genug gewesen, Zeit für Kreativität zu finden.
"Ich hab dann einfach jeden Abend gebadet. Wenn meine Tochter und meine Freundin schliefen, lag ich in der Wanne und tippte Texte in mein iPhone und überlegte mir die Songs. Einmal die Woche ging ich in den Proberaum und nahm ein Demo nach dem anderen auf. Das war ziemlich hart für meine Familie, weil ich einfach 15 Wochen lang mit dem Kopf woanders war."
Das Thema schlich sich natürlich auch in seine Texte. Er habe aufgepasst, deswegen nicht lieblich oder niedlich zu werden, sagt Aström. Der Song, der sich ganz explizit an seine kleine Tochter richtet, heißt vielsagend "A Battle" - "Ein Kampf". Aber er meint eher die kommenden Kämpfe, die einem das Leben so aufgibt.
"Irgendwann wird sie einen Typen treffen - oder ein Mädchen, weiß man ja nie -, der oder die ihr das Herz bricht. Wie wird das wohl für mich? Bestimmt hart. Aber, so schreib ich da, ich werde immer für sie da sein. Das ist jetzt halt meine Lebensaufgabe: Der beste Vater zu sein, der ich sein kann. Nicht der Beste der Welt, das wäre schwierig. Aber der Beste, der ich sein kann."
Verzicht auf Experimente
Man kann "The Story Of A Heart's Decay" beim ersten Hören harmlos finden. Die ganz unmodischen Arrangements, die gezähmten Gitarren, die Retro-Beschränkung: Kristofer Aström hat schon viel radikaler und experimentierfreudiger geklungen. Aber nach einer Weile wird klar, dass er sehr kompetent genau das Album gemacht hat, das er machen wollte: eine Art nordischen Westcoast-Sound; klassisches Songwriting, aber mit seiner eigenen Handschrift.
"Früher waren Songs von mir auch mal elf Minuten lang, kein Problem. Diesmal hab ich mir sehr genau angehört, wie die Sachen von Jackson Browne, von Bob Dylan, von Tom Petty funktionieren. Von ihnen wollte ich lernen. Und das hat nichts mit Kompromissen zu tun. Ich wollte meinen Stil zugänglicher machen. Die Disziplin war: gerade nicht zu experimentieren."