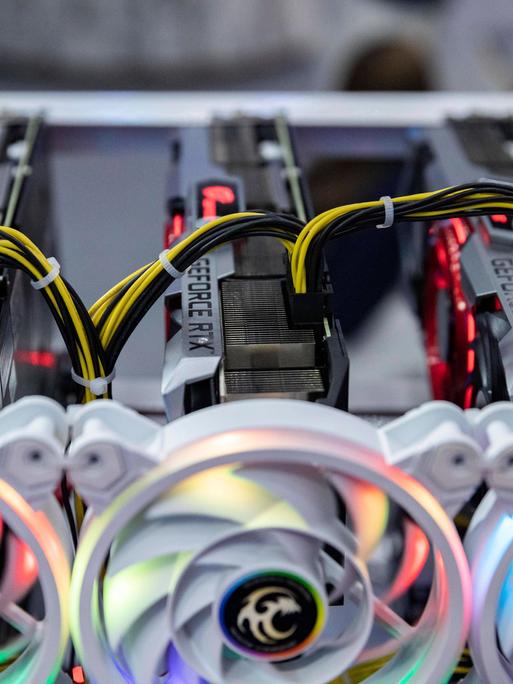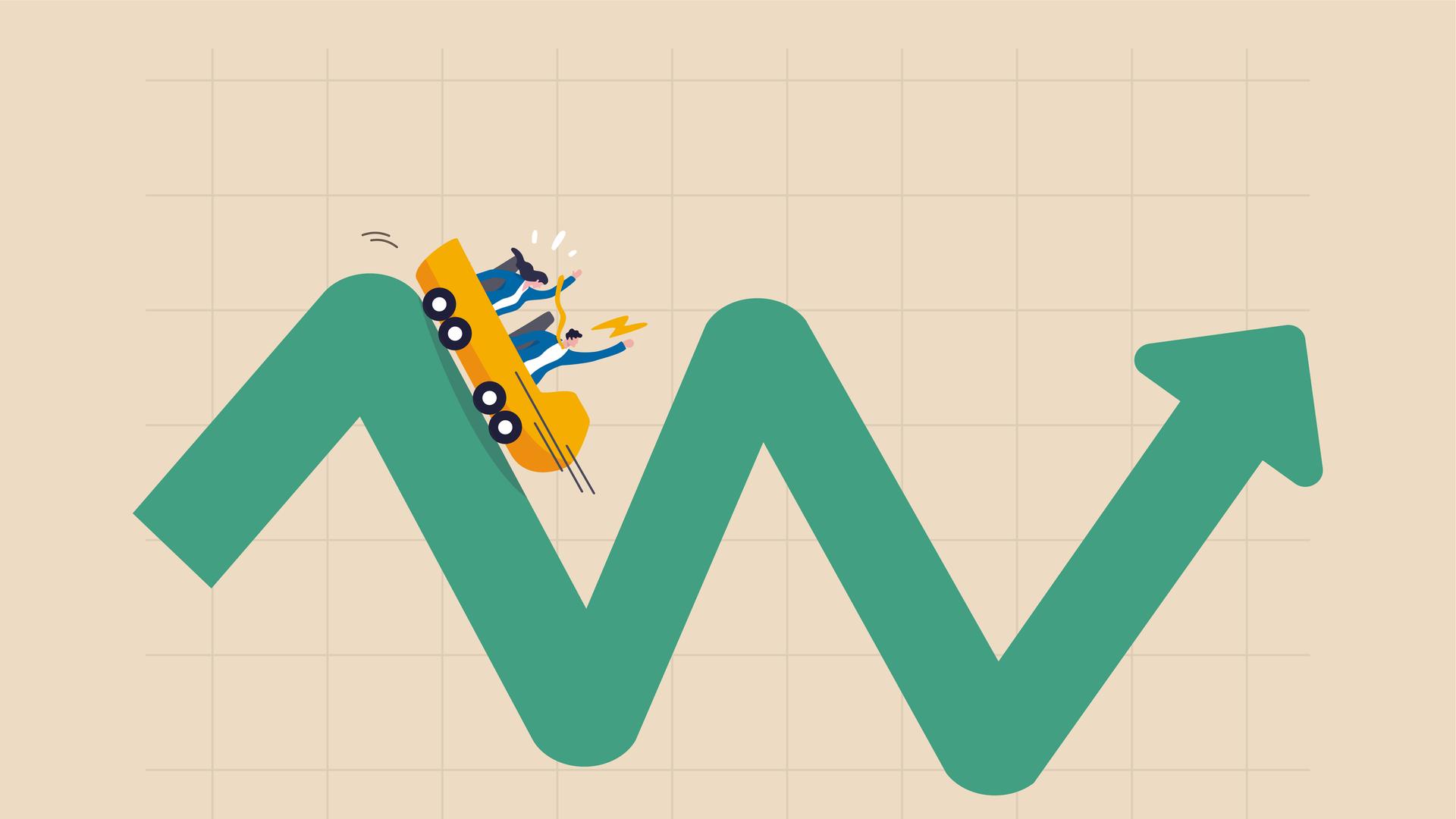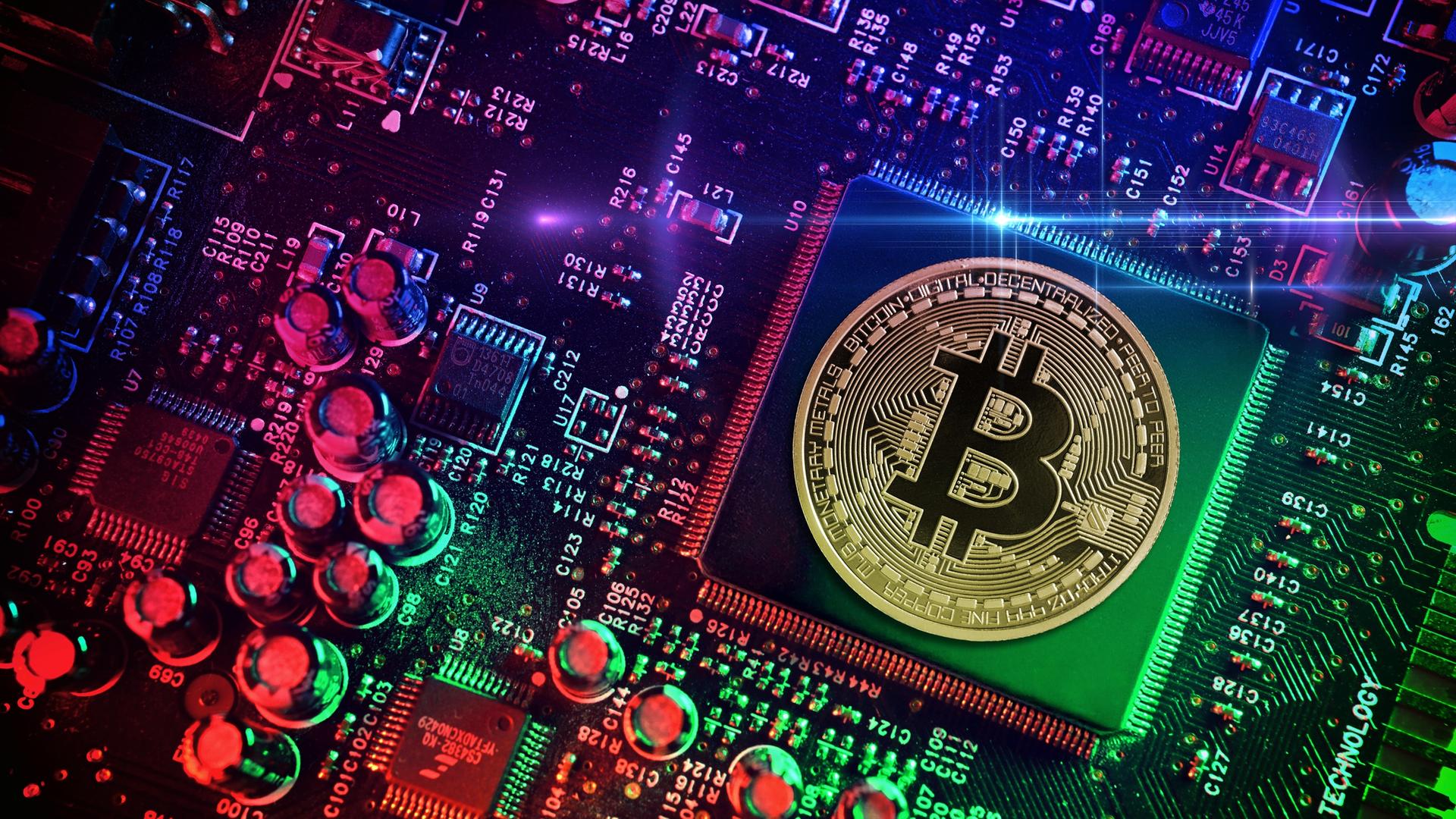
Weltweit entstehen Schäden in Milliardenhöhe durch Betrug mit Kryptowährungen. Die Polizeiorganisation Europol erwartet, dass Onlinebetrug bald alle anderen Formen organisierter Wirtschaftskriminalität übertreffen wird.
Auch in Deutschland nehmen die Fälle zu, wie auch Zahlen der Verbraucherzentralen zeigen. Im ersten Halbjahr 2025 gingen bundesweit über 250 Beschwerden ein – doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2024.
Inhalt
- Was Kryptowährungen für Betrüger interessant macht
- So finden die Kriminellen ihre Opfer
- Der Hype ums schnelle Geld verändert die Betrugsmaschen
- Die Strategie der Betrüger: Anlocken, mästen, schlachten
- Die Organisation hinter dem Betrug
- Das Ausmaß der Schäden durch Kryptobetrug
- Das Schicksal der Opfer
Was Kryptowährungen für Betrüger interessant macht
Dass gerade die sogenannten Kryptowährungen bei Kriminellen so beliebt sind, hat mehrere Gründe. Zum einen hat dieses Thema 2025 noch einmal einen richtigen Hype erlebt, als US-Präsident Trump seine Unterstützung für Kryptowährungen bekundete.
Hinzu kommt: Für die meisten Menschen sind Kryptowährungen nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. Sie können nicht nachvollziehen, was beim Investment genau geschieht – und sind dadurch leichter zu täuschen.
Das ist auch nicht verwunderlich, denn es gibt inzwischen wohl mehr als 10.000 verschiedene Kryptowährungen, die bekannteste ist Bitcoin. Aber auch dabei handelt es sich im eigentlichen Sinne nicht um eine Währung, denn bis auf El Salvador ist der Bitcoin in keinem Land der Welt als offizielles Zahlungsmittel, also Währung, anerkannt.
Hinter einer Kryptowährung steht auch kein materieller oder immaterieller Wert, der Wert bemisst sich daher ausschließlich danach, wie viel Anlegerinnen und Anleger bereit sind, dafür zu zahlen, erklärt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Am ehesten kann man Kryptowährungen noch als digitalen Vermögenswert bezeichnen, der gehandelt werden kann. Alle Transaktionen werden dabei in der sogenannten Blockchain registriert, einer digitalen Kette (Chain) aus Datenblöcken, eine Art digitalem Kassenbuch, die verschlüsselt und so vor Betrug geschützt werden. Dabei bleiben die Beteiligten anonym. Zudem gibt es technische Möglichkeiten, Spuren zu verwischen.
So finden die Kriminellen ihre Opfer
Beim Onlinebetrug kann es jede und jeden treffen. Internetbetrüger nutzen alle erdenklichen Wege, um mit ihren Opfern in Kontakt zu treten: gefälschte Anzeigen, Videos mit vermeintlichen Prominenten, die angeblich sichere Wege zu schnellem Reichtum versprechen.
Andere versuchen über Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram, ihre Opfer zu ködern – oder sprechen sie scheinbar beruflich auf Plattformen wie LinkedIn an.
Die Täter gehen dabei psychologisch geschickt vor, erklärt Kriminalhauptkommissarin Iris Kehrer von der bayerischen Polizei. Viele der späteren Opfer befinden sich in einer Überforderungssituation oder erleben private Umbrüche – und sind dadurch besonders verletzlich.
Auch Fachkenntnis schützt nicht unbedingt: Selbst Menschen mit Hochschulabschluss und IT-Erfahrung, die bereits in Kryptowährungen investiert haben, fallen auf die Masche herein, sagt Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck von der Zentralstelle Cybercrime der bayerischen Polizei in Bamberg.
Sie berichten glaubhaft, dass alles „von hinten bis vorne einen seriösen, authentischen und ganz sicherlich nicht betrügerischen Eindruck“ gemacht hat. Das zeigt, wie professionell diese Betrugsmaschen umgesetzt werden.
Der Hype ums schnelle Geld verändert die Betrugsmaschen
Der klassische „Love Scam“, bei dem eine vermeintlich attraktive Person auf einem Dating-Portal Geld für eine angebliche Arztrechnung erbittet, ist inzwischen weniger verbreitet. Stattdessen heißt die Masche immer öfter: Ich habe eine tolle Geschäftsidee – wollen wir gemeinsam investieren?
Die Täter versuchen inzwischen oft, ganz langsam und bloß nicht zu aufdringlich Vertrauen aufzubauen, sagt Oberstaatsanwalt Goldbeck. Stattdessen wird subtil das Interesse an einem lukrativen Investment geweckt, etwa durch die Darstellung eines scheinbar erfolgreichen Lebensstils.
So kommt das Gespräch allmählich auf Finanzen und Vermögen. Das Vertrauen wird gezielt ausgenutzt. Allein in Bayern wurden in den letzten fünf Jahren rund 1000 solcher Fälle registriert – in anderen Bundesländern dürfte es ähnlich aussehen.
Die Strategie der Betrüger: Anlocken, mästen, schlachten
Die Methode wird umgangssprachlich als „Pig Butchering“ – also „Schweineschlachten“ – bezeichnet. Sie stammt ursprünglich aus China, wo sie als „sha zhou pan“ bekannt ist.
Der Betrug läuft drei Phasen, sagt Oberstaatsanwalt Goldbeck. Am Anfang steht das Anlocken. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen. "Dann kommt die Phase des Mästens. Das heißt, dann wird möglichst viel Geld investiert. Und schließlich kommt die Phase des Schlachtens, nämlich dann, wenn nichts mehr zu holen ist und wenn am Ende feststeht, die Geschädigten können abgestoßen werden, weil sie maximal ausgenutzt wurden.“
Goldbeck betont, dass die Polizei den Begriff Pig Butchering eigentlich nicht mag und dass Interpol Ende 2024 appelliert hat, doch besser stattdessen „Romance Bait“ zu verwenden. Aktivisten nutzen jedoch bewusst den Begriff „Pig Butchering“, um die Brutalität und Menschenverachtung dieser Masche zu verdeutlichen.
Die Organisation hinter dem Betrug
Hinter dem Betrug steht kein Einzelner, sondern ein arbeitsteilig organisiertes Unternehmen. Verschiedene Abteilungen sind auf unterschiedliche Phasen des Betrugs spezialisiert.
Die ehemalige US-Staatsanwältin Erin West beschreibt die Struktur so: Da sind am Anfang die „Finder“, die den Kontakt zu den potenziellen Betrugsopfern herstellen. Diese „Finder“ geben den Kontakt an die „Chatter“ weiter, die lange Gespräche führen und Vertrauen aufbauen, „Closer“ leiten die Opfer dann zur Investition auf gefälschten Plattformen an.
West hat mehrfach Callcenter in Südostasien besucht, aus denen diese Scams gesteuert werden. Sie beschreibt sie als überfüllte Wohnheime, in denen Menschen bis zu 17 Stunden täglich arbeiten – mit dem Ziel, neue Opfer zu finden.
Alles nur Fassade – Crime-as-a-Service
Beim „Pig Butchering“ ist nichts echt: Die Fotos in den Chats stammen aus dem Internet oder aus Bilddatenbanken, die man kaufen kann. Die Nachrichten folgen Drehbüchern oder stammen von KI-Systemen. Die Trading-Plattformen sind gefälscht.
Es gibt eine regelrechte Zulieferindustrie für Betrugsbausteine. Staatsanwalt Goldbeck spricht von „Crime-as-a-Service“: Dienstleister liefern Komponenten wie gefälschte Facebook-Accounts, Fake-Apps oder Geldwäschesysteme.
Das Ausmaß der Schäden
Untersuchungen aus den USA schätzen den weltweiten Schaden durch „Pig Butchering“ in den vergangenen Jahren auf 75 bis 80 Milliarden Dollar. Ein lukratives Geschäftsfeld für die organisierte Kriminalität.
Richtig in Schwung kam es während der Corona-Lockdowns, als viele Menschen online nach Nähe suchten – das trieb die Entwicklung voran. In Südostasien entstanden große Scam-Zentren mit teils Tausenden Mitarbeitern.
Zunächst waren Täter und Opfer meist Chinesen, später wurden auch Menschen aus Südostasien, Nordamerika und Europa ins Visier genommen. Fortschritte bei Sprach-KI machen das möglich. Laut Goldbeck wird „Pig Butchering“ weiterhin von Südostasien aus betrieben – es gibt aber Hinweise auf eine Ausbreitung nach Westafrika.
Europol warnt in seinem Lagebericht 2025: Onlinebetrug könnte bald alle anderen Formen organisierter Wirtschaftskriminalität übertreffen. Noch nie war die Vielfalt, Reichweite und Raffinesse der Online-Betrugssysteme so groß.
Das Schicksal der Opfer
Viele Opfer machen das Spiel bis zum bitteren Ende mit – oft trotz eines unguten Gefühls. Wenn ihnen das Ausmaß bewusst wird, bricht für sie eine Welt zusammen.
„Viele wollen sich nicht eingestehen, dass sie betrogen wurden, dass sie emotional ausgenutzt wurden", sagt Iris Kehrer. „Und sie haben auch in gewisser Weise Angst, sich ihrer Familie zu öffnen, weil sie teilweise ihre Rente, ihre Zukunft investiert haben.“
Für viele ist das sehr belastend. Manche finden Unterstützung in der Familie oder in Selbsthilfegruppen. Andere entwickeln Depressionen oder Suizidgedanken – einige begehen tatsächlich Suizid.
Die Scham führt oft dazu, dass die Taten nicht angezeigt werden. Die Dunkelziffer ist hoch. Und wer sich erst spät meldet, hat kaum Chancen, sein Geld zurückzubekommen – denn dann ist es meist schon verschwunden.