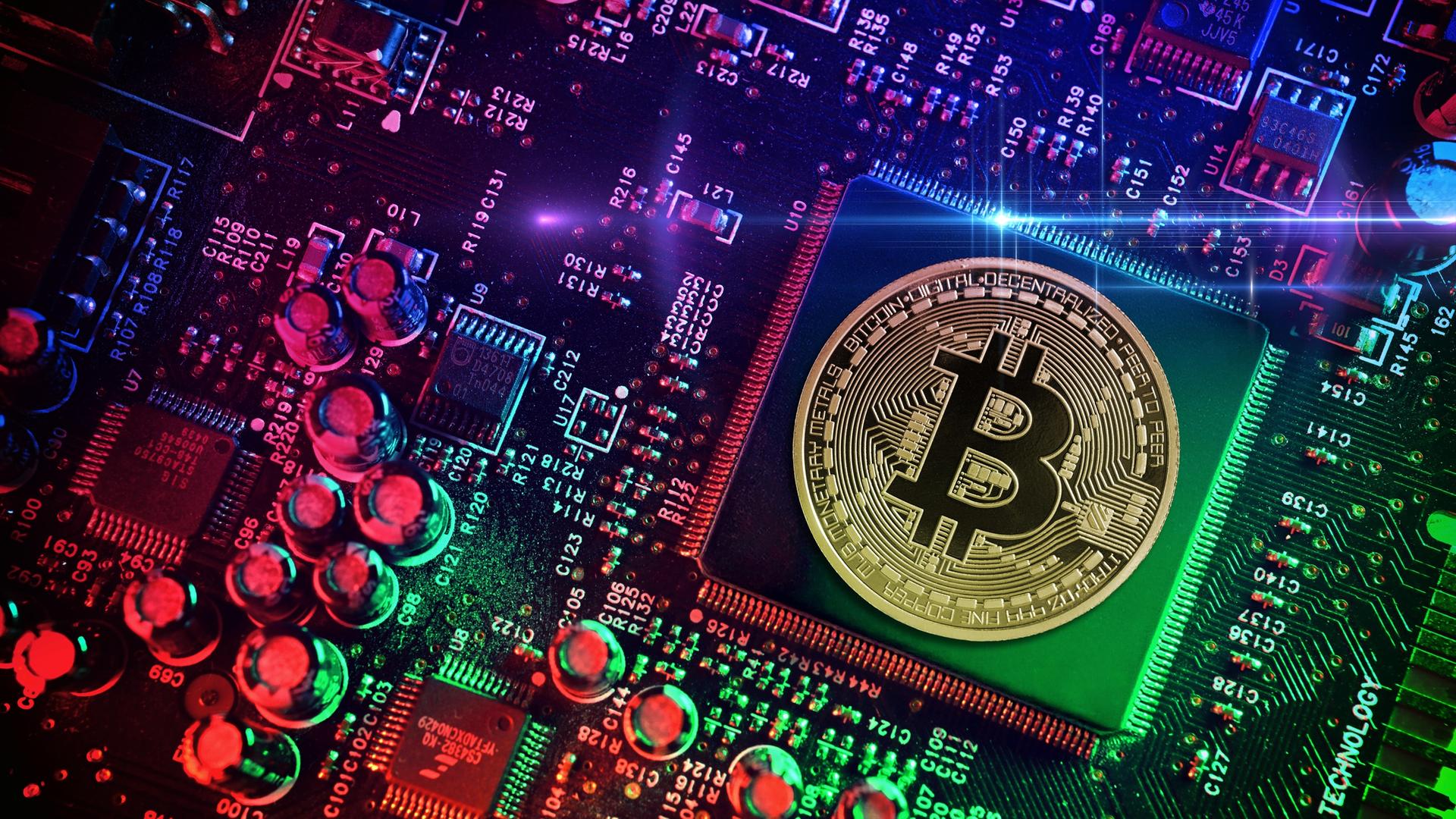Es war eine Panne, die im Oktober 2025 weltweit Schlagzeilen machte. Durch ein Versehen waren Einheiten einer Digitalwährung im theoretischen Wert von 300 Billionen Dollar generiert worden. Eine gigantische Summe also – das Zehnfache des Bruttoinlandsprodukts der USA. Die herausgebende Firma teilte mit, der Fehler sei bei einer internen Transaktion passiert und umgehend korrigiert worden.
Es handelte sich um einen sogenannten Dollar-Stablecoin des Bezahldienstes Paypal (Paypal USD). Der Fall wirft ein Schlaglicht auf Stablecoins, die eine andere Art der Kryptowährung und damit eine Alternative zum Bitcoin darstellen sollen.
Was sind Stablecoins?
Stablecoins heißt wörtlich übersetzt „stabile Münzen“. Diese virtuellen Münzen sind in eine Blockchain eingebunden, was sie kryptographisch vor Fälschungen schützen soll. Zum Spekulieren eignen sie sich kaum, denn ihr Wert soll ja stabil bleiben.
Stablecoins sind 1:1 an einen bestimmten Wert gekoppelt – wie etwa den US-Dollar. Stablecoins sollen praktisch nicht im Wert schwanken und sich deshalb besser als digitales Zahlungsmittel eignen als etwa der Bitcoin. Befürwortern zufolge könnten Stablecoins die Finanzwelt modernisieren und effizienter machen. Stablecoins sollen schnelle und kostengünstige internationale Transaktionen ermöglichen.
Es gibt sie schon seit Jahren – aber sie gewinnen an Bedeutung. Stablecoins wurden bisher genutzt, um Geld möglichst schnell von einer Kryptobörse zu einer anderen zu schicken - etwa, weil sich Bitcoin und Co. dort günstiger kaufen ließen. Doch zunehmend spielen Stablecoins laut Experten auch außerhalb der Krypto-Szene eine Rolle - etwa für grenzüberschreitende Überweisungen zwischen Firmen oder Privatpersonen. Sie gelten als Alternative zum etablierten internationalen Zahlungssystem Swift.
Wer bietet Stablecoins an?
Einer der größten Stablecoin-Anbieter ist Circle - ein milliardenschweres Digital-Unternehmen in einem boomenden Geschäftsfeld. Ein weiteres wichtiges Unternehmen ist Tether mit Sitz in El Salvador.
Außerdem planen mehrere große Unternehmen die Einführung eines eigenen Stablecoins – unter anderem wohl der Online-Konzern Amazon. Der Zahlungs-Dienstleister Paypal hat bereits einen Stablecoin auf Dollar-Basis – dort kam es zu der eingangs geschilderten Panne.
Auch Western Union will einen eigenen Stablecoin herausbringen. Anbieter Visa und Mastercard befassen sich ebenfalls verstärkt mit dem Thema. Im September 2025 kündigten neun europäische Banken einen an den Euro gebundenen Stablecoin an.
Wo liegen die Risiken bei Stablecoins?
Kritiker befürchten durch Stablecoins Risiken für die Stabilität des Finanzmarktes. Dieses Risiko sieht zum Beispiel der Ökonom Markus Demary. Ein Szenario: Würde der Markt für US-Staatsanleihen unter Druck geraten, dann könnte auch das Vertrauen gegenüber Stablecoins sinken, für die diese Anleihen als Sicherheit hinterlegt sind. “Dann kann es ja sein, dass die Anleger massenhaft ihr Geld da rausziehen wollen, was so einen Stablecoin dann in die Knie zwingen könnte. Und wenn das ein sehr großer Stablecoin ist, in dem auch viele andere angelegt haben, kann das natürlich auch zu Verlusten führen, die sich über das Finanzsystem dann ausbreiten”, warnt Demary.
Das Verbraucher-Portal „Finanztip“ wies außerdem darauf, dass es bei Stablecoins keinen Schutz durch die gesetzliche Einlagensicherung gibt - anders als hierzulande beim Giro-, Tagesgeld- oder Festgeldkonto. Stablecoins seien „keine sicheren Geldanlagen“.
Auf die Rolle von Stablecoins für kriminelle Aktivitäten weist die Ökonomin Carolina Melches von der Organisation „Bürgerbewegung Finanzwende“ hin. Aus Daten und Statistiken lässt sich laut Melches herauslesen, „dass Stablecoins seit 2022 das Mittel der Wahl sind, wenn es um illegale Transaktionen im Kryptobereich geht“. Dabei gehe es nicht nur Geldwäsche, sondern auch um Terrorfinanzierung.
Welche Regulierung gibt es für Stablecoins?
In den USA hat die Trump-Regierung ein Gesetz zur Regulierung von Stablecoins durchgesetzt – den sogenannten Genius Act. Unter anderem müssen Anbieter ihre digitalen Münzen jetzt vollständig mit liquiden Mitteln besichern. Diese sollen entweder direkt zur Verfügung stehen oder schnell in Bargeld umgewandelt werden können. Es gibt in den USA Kritik, die Regulierung der Stablecoins sei unzureichend.
Die US-Regierung fördert zugleich den Stablecoin-Sektor. Das lässt die Nachfrage nach Staatsanleihen steigen, die zur Besicherung gekauft werden. Und das sorgt wiederum dafür, dass der amerikanische Staat seine Schulden günstiger finanzieren kann. Und es trägt dazu bei, die Dominanz des Dollars zu sichern.
Der Boom von Stablecoins hilft Trump aber nicht nur bei der Finanzierung der Regierungspolitik. US-Präsident Donald Trump verfolgt auch persönliche Interessen. Denn das Unternehmen “World Liberty Financial”, das auch von Mitgliedern aus Trumps Familie betrieben wird, hat den Stablecoin USD1 herausgegeben. Der hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von über zwei Milliarden Dollar - ein lukratives Geschäft.
Wie gehen europäische Staaten mit Stablecoins um?
In der EU gilt eine Verordnung mit dem Titel “Markets in Crypto-Assets Regulation”. Diese Verordnung gilt für weite Teile der Krypto-Branche und deckt den Bereich der Stablecoins mit ab.
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde warnte allerdings vor dem Fall, dass ein Stablecoin innerhalb und außerhalb der EU ausgegeben würde und es bei einer Krise zu einem Ansturm käme. Investoren würden ihre digitalen Münzen dann wohl vorzugsweise in der EU zurücktauschen wollen, weil die Regeln hier vorteilhafter seien. Doch die hier gehaltenen Geld-Reserven könnten möglicherweise nicht ausreichen, um die Nachfrage zu bedienen.
Kritiker werfen der Zentralbankchefin vor, nicht neutral zu sein. Denn die EZB will künftig einen digitalen Euro herausbringen. Stablecoins sind dagegen schon jetzt auf dem Markt - und für das EZB-Projekt eine Konkurrenz.
Die britische Zentralbank geht davon aus, dass Stablecoins in der Zukunft "eine bedeutende Rolle im Zahlungsverkehr spielen" werden. Die Bank of England will Regeln für Stablecoins auf Basis des Pfunds einführen. Sie schlägt unter anderem vor, dass systemrelevante Stablecoin-Emittenten "bis zu 60 Prozent ihrer Sicherheiten in kurzfristigen britischen Staatsanleihen halten dürfen".
Hörfunkbeitrag: Felix Wessel, Onlinetext: tei, mit Material von dpa und AFP