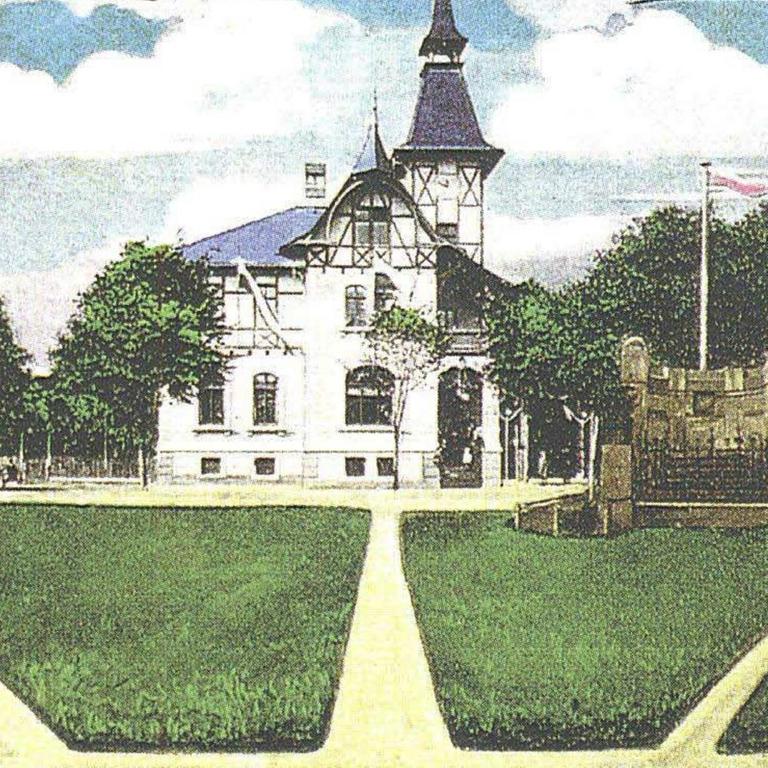"So, soweit oben war ich schon lange nicht mehr. Das ist jetzt Garten. Normalerweise stehen die Nummern oben dran, das ist die 14 und die 15…"
Annet Harpke und Rolf Schwahn schreiten Gang 1 ab in ihrem Kleingartenverein, der Kleingartensparte-Unterdorf-Niederndodeleben in der Gemeinde Hohe Börde in Sachsen-Anhalt. Akkurat gemähte Rasenflächen, abgezirkelte Beete, gepflegte Lauben. Die Tore der Kolonie sind auch am Tag abgeschlossen. Man bleibt hier unter sich. Die beiden halten vor einer etwas windschiefen Pforte an. Dahinter ist die Ordnung vorbei. Es wuchert in den Büschen, auf den Bäumen und am Boden.
"Sie sehen, da ist längere Zeit nichts getan worden. Ich meine, der sieht gar nicht so schlecht aus, aber wenn man hier die Bäume, die Büsche vernünftig beschneidet und dann wieder durchgucken kann, hat man ein ganz anderes Bild. Das wollen wir jetzt durch Arbeitseinsätze steuern, dass solche Gärten schnell wieder auf Vordermann gebracht werden."
Annet Harpke und Rolf Schwahn schreiten Gang 1 ab in ihrem Kleingartenverein, der Kleingartensparte-Unterdorf-Niederndodeleben in der Gemeinde Hohe Börde in Sachsen-Anhalt. Akkurat gemähte Rasenflächen, abgezirkelte Beete, gepflegte Lauben. Die Tore der Kolonie sind auch am Tag abgeschlossen. Man bleibt hier unter sich. Die beiden halten vor einer etwas windschiefen Pforte an. Dahinter ist die Ordnung vorbei. Es wuchert in den Büschen, auf den Bäumen und am Boden.
"Sie sehen, da ist längere Zeit nichts getan worden. Ich meine, der sieht gar nicht so schlecht aus, aber wenn man hier die Bäume, die Büsche vernünftig beschneidet und dann wieder durchgucken kann, hat man ein ganz anderes Bild. Das wollen wir jetzt durch Arbeitseinsätze steuern, dass solche Gärten schnell wieder auf Vordermann gebracht werden."
Vor allem junge Pächter und Familien sollen angelockt werden
Für diese Arbeitseinsätze, die sie ins Leben gerufen haben, wollen Annett Harpke und Rolf Schwahn so viele Vereinsmitglieder wie möglich zusammentrommeln. Sie sollen die verwaisten Gärten wieder in Ordnung bringen. 15 der insgesamt 138 Parzellen stehen leer. Annett Harpke weist auf einen Garten, in dem die Äste der Apfelbäume fast bis auf den Boden hängen. In dem von Geäst und Efeu überwucherten Gartenhäuschen zieren noch vergilbte Spitzengardinen die Fenster. Die Tür ist aus den Angeln gerissen, am Boden stapelt sich zerschlagenes Porzellan.
"Das ist zum Beispiel auch ein Leergarten, da ist eine Laube drauf. Wo wir aber wissen, dass die Laube sehr sanierungsbedürftig ist. Das Dach, da müssen wir auch ran, damit die Bausubstanz nicht weiter darunter leidet. Weil: Damit helfen wir keinem Neupächter."
"Das ist zum Beispiel auch ein Leergarten, da ist eine Laube drauf. Wo wir aber wissen, dass die Laube sehr sanierungsbedürftig ist. Das Dach, da müssen wir auch ran, damit die Bausubstanz nicht weiter darunter leidet. Weil: Damit helfen wir keinem Neupächter."
Rolf Schwahn hat seit 20 Jahren einen Garten in der Anlage. Er trägt einen ergrauten Schnauzbart, kurze Hosen und Gummipantoffeln. Annett Harpke hat rosa Strähnen in den kurzen blonden Haaren, passend dazu ein knallpinkes Trägerhemd. Sie hat ihren Garten vor einem Jahr bezogen. Vor einigen Wochen wurde sie im Vereinsheim zur Vorsitzenden gewählt, mit Schwahn als Stellvertreter. Nun wollen sie vor allem junge Pächter und Familien anlocken.
"Wir wissen heute aus Erfahrung: Wenn jüngere Leute kommen, die wollen einen fertigen Garten haben."

Das Bundeskleingartengesetz verlangt, dass sich, wer eine Parzelle nutzt, nicht nur erholt, sondern auch Obst und Gemüse anbaut. Nur dann wird ein Kleingarten als solcher anerkannt - und günstig verpachtet. Ende des 18. Jahrhunderts entstanden die ersten Gärten, damit die wachsende arme Bevölkerung selbst Kartoffeln und Kohl anbauen konnte. Auch in der DDR waren Kleingärten besonders beliebt, weil die Pächter sich dort selbst versorgen konnten. Angesichts fehlender Reisefreiheit dienten die Gärten auch als Naherholungsgebiet. Durch die Deutsche Einheit wurde das weniger wichtig. Hinzu kommt: Die Mehrheit der Kleingärtner sind Rentner. Wenn die Alten ihre Gärten aufgeben, fehlt besonders auf dem Land der Nachwuchs.
"Wir haben Gänge, wo jüngere Mitglieder sind, also jüngere zwischen 40 und 60 Jahren. Und es gibt Gänge, wo alteingesessene Mitglieder sind, die also schon 30, 40 Jahre ihren Garten hier haben und die jetzt altersbedingt an die Grenze 80 stoßen und die sagen: wir können nicht mehr. Und dann Leute zu finden, die die Gärten übernehmen, ist nicht einfach."
"Wir haben Gänge, wo jüngere Mitglieder sind, also jüngere zwischen 40 und 60 Jahren. Und es gibt Gänge, wo alteingesessene Mitglieder sind, die also schon 30, 40 Jahre ihren Garten hier haben und die jetzt altersbedingt an die Grenze 80 stoßen und die sagen: wir können nicht mehr. Und dann Leute zu finden, die die Gärten übernehmen, ist nicht einfach."
Leerstand ist ein großes Problem für Kleingartenvereine
Seit 1928 schon besteht diese Kleingartenkolonie. Nun könnten die leeren Parzellen ihr gefährlich werden. Das Land ist von der Gemeinde gepachtet, wie bei der großen Mehrheit der Kleingärten in Deutschland. Der Verein hat mit der Gemeinde bereits vereinbart, dass er einen Teil der Gärten wieder zurückgibt. Annett Harpke weiß aber: Die Gemeinde würde am liebsten noch weitere Flächen zurückfordern, weil sie ein angrenzendes Wohngebiet vergrößern will.
"Das ist bekannt, dass man das Wohngebiet erweitern möchte. Von der Gemeinde aus. Da müssen wir als Gartenverein versuchen, dem entgegenzuwirken und das können wir nur, indem wir langfristige Pachtverträge haben, der Leerstand muss runtergehen von der Anzahl her. Dass das hier nicht irgendwann einmal nur noch von den 138 Parzellen nur noch 70 sind. Das wollen wir nicht. Und ich werde so gut es geht kämpfen, dass die Anlage so bestehen bleibt, wie sie ist."
Leerstand ist ein großes Problem für Kleingartenvereine besonders in ländlichen, strukturschwachen Gebieten in Ostdeutschland. Während die Wartelisten für Schrebergärten in wachsenden Großstädten wie Berlin und Hamburg auf Jahre voll sind, geht das Interesse vor allem auf dem Land zurück. Und kein Bundesland ist so sehr vom Leerstand betroffen wie Sachsen-Anhalt. Rund 106.000 Kleingärten zählt der Landesverband der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt. Aber gut 17.000 davon werden nicht bewirtschaftet. Jan Korte, der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion im Bundestag, hört in seinem Wahlkreis Anhalt häufiger von den Problemen der Kleingärtner.
"Ich habe schon seit vielen Jahren immer wieder Kleingartenvereine besucht und gerade in den sehr strukturschwachen Gegenden, wenig Bewohner, war es bei allen Vereinen so: je ländlicher, umso größer die Probleme, vor allem, was den Leerstand angeht."
"Das ist bekannt, dass man das Wohngebiet erweitern möchte. Von der Gemeinde aus. Da müssen wir als Gartenverein versuchen, dem entgegenzuwirken und das können wir nur, indem wir langfristige Pachtverträge haben, der Leerstand muss runtergehen von der Anzahl her. Dass das hier nicht irgendwann einmal nur noch von den 138 Parzellen nur noch 70 sind. Das wollen wir nicht. Und ich werde so gut es geht kämpfen, dass die Anlage so bestehen bleibt, wie sie ist."
Leerstand ist ein großes Problem für Kleingartenvereine besonders in ländlichen, strukturschwachen Gebieten in Ostdeutschland. Während die Wartelisten für Schrebergärten in wachsenden Großstädten wie Berlin und Hamburg auf Jahre voll sind, geht das Interesse vor allem auf dem Land zurück. Und kein Bundesland ist so sehr vom Leerstand betroffen wie Sachsen-Anhalt. Rund 106.000 Kleingärten zählt der Landesverband der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt. Aber gut 17.000 davon werden nicht bewirtschaftet. Jan Korte, der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion im Bundestag, hört in seinem Wahlkreis Anhalt häufiger von den Problemen der Kleingärtner.
"Ich habe schon seit vielen Jahren immer wieder Kleingartenvereine besucht und gerade in den sehr strukturschwachen Gegenden, wenig Bewohner, war es bei allen Vereinen so: je ländlicher, umso größer die Probleme, vor allem, was den Leerstand angeht."
Besonders dort, wo hohe Arbeitslosigkeit herrscht und viele Menschen wegziehen, verschwindet auch das Interesse an den Kleingärten. In manchen Gegenden stehen 40 Prozent der Parzellen leer.
"Dort kann man demographischen Wandel anhand der Kleingärten besichtigen, wie es konkret ist, wenn immer mehr Menschen wegziehen."
"Dort kann man demographischen Wandel anhand der Kleingärten besichtigen, wie es konkret ist, wenn immer mehr Menschen wegziehen."
Korte stellte im Mai eine kleine Anfrage im Bundestag. Er wollte wissen, wie es um die Kleingärten in Deutschland bestellt ist. Denn seine Sorge war: Wenn auf dem Land im Osten auch noch die Kleingärten wegfallen, welche Orte bleiben den Menschen dann noch, um sich zu begegnen?
"Bei mir im Wahlkreis hast du oft nur noch die Feuerwehr, die überhaupt was macht, wo Treffen sind, wo Gesellschaft zusammenkommt. Ganz wichtig im Kleingarten ist das Feiern, Grillen, zusammen Streiten, denn auch das tut man ja im Kleingartenverein, ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion."
"Bei mir im Wahlkreis hast du oft nur noch die Feuerwehr, die überhaupt was macht, wo Treffen sind, wo Gesellschaft zusammenkommt. Ganz wichtig im Kleingarten ist das Feiern, Grillen, zusammen Streiten, denn auch das tut man ja im Kleingartenverein, ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion."
Kleingärten haben einen etwas angestaubten Ruf
Die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Linksfraktion zeigte: Auch bundesweit hat die Zahl der Kleingärten abgenommen. 1990 gab es in Deutschland demnach rund 1,3 Millionen Kleingärten, knapp Zweidrittel davon in den ostdeutschen Bundesländern. Das Bundesinnenministerium zählt seither einen Schwund von 200.000 Gärten. Immerhin: Im vergangenen Jahr sei die Nachfrage wegen der Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt wieder etwas gestiegen, sagt Olaf Weber vom dortigen Landesverband der Gartenfreunde. Aber so viele Gärten wie noch vor 30 Jahren werde es nicht mehr geben, sagt Weber.
"Ergo muss man da über eine Frist von 25 bis 30 Jahren nachdenken, wie man diese Flächen renaturiert, an den Eigentümer zurückgibt, eventuell auch Umnutzungskonzepte entwirft. Da sind wir dran."
Kleingärten haben einen etwas angestaubten Ruf: Vorgeschriebene Heckenhöhe, ein Drittel Obst- und Gemüseanbau, Vereinsmeierei, Kleinbürgertum. Aber mancherorts wandelt sich das Image durch neue Pächter. Nicht überall wird mit dem Zollstock nachgemessen. Mehr Kinder kommen hinzu. Immerhin zwölf Prozent der Neupächter sind Einwanderer oder kommen aus einer Einwandererfamilie. Die Mehrheit der Pächter lebt in ihrer Wohnung zur Miete. Nur rund ein Drittel hat einen Job. Politiker lassen sich - besonders in Wahlkampfzeiten - gern in Kleingartenvereinen blicken.
"Hallo! Guten Tag! Na, wie geht’s, was macht das Schulkind? Letztes Mal, als ich hier war, war doch Einschulung."
Halle an der Saale. Karamba Diaby bahnt sich seinen Weg durch einen schmalen Gang entlang überschaubarer Parzellen in den Kleingartenverein "Grüner Winkel". Nur 34 Pächter gibt es hier, eingepfercht zwischen zwei Bahntrassen im Süden von Halle. Der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Halle trägt weißes Hemd, schwarze Hose - und dazu gartengerecht Treckingsandalen. Diaby ist gern gesehener Gast in den Vereinen seiner Heimatstadt, insbesondere, seitdem er im vergangenen Jahr selbst unter die Laubenpieper gegangen ist.
"Ich bin im Rahmen meiner Wahlkreisbetreuung, wenn Ende April das Wetter schön ist, mindestens alle zwei Wochenenden unterwegs bei Kleingartenfreunden. Denn ich denke, das ist ein Ort des Dialogs, ein Ort des Austausches. Wir reden ja nicht nur übers Kleingartenwesen, wir reden auch über andere Themen, das Thema gesellschaftliches Zusammenleben, das Thema Rente, das Thema Corona-Krise, das Thema Ausbildung und Arbeitsplatz. Da stehe ich zur Verfügung als Politiker, dass man mich da auch fragen kann. Und es gibt keinen besseren Ort als über den Kleingartenzaun."
"Ergo muss man da über eine Frist von 25 bis 30 Jahren nachdenken, wie man diese Flächen renaturiert, an den Eigentümer zurückgibt, eventuell auch Umnutzungskonzepte entwirft. Da sind wir dran."
Kleingärten haben einen etwas angestaubten Ruf: Vorgeschriebene Heckenhöhe, ein Drittel Obst- und Gemüseanbau, Vereinsmeierei, Kleinbürgertum. Aber mancherorts wandelt sich das Image durch neue Pächter. Nicht überall wird mit dem Zollstock nachgemessen. Mehr Kinder kommen hinzu. Immerhin zwölf Prozent der Neupächter sind Einwanderer oder kommen aus einer Einwandererfamilie. Die Mehrheit der Pächter lebt in ihrer Wohnung zur Miete. Nur rund ein Drittel hat einen Job. Politiker lassen sich - besonders in Wahlkampfzeiten - gern in Kleingartenvereinen blicken.
"Hallo! Guten Tag! Na, wie geht’s, was macht das Schulkind? Letztes Mal, als ich hier war, war doch Einschulung."
Halle an der Saale. Karamba Diaby bahnt sich seinen Weg durch einen schmalen Gang entlang überschaubarer Parzellen in den Kleingartenverein "Grüner Winkel". Nur 34 Pächter gibt es hier, eingepfercht zwischen zwei Bahntrassen im Süden von Halle. Der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Halle trägt weißes Hemd, schwarze Hose - und dazu gartengerecht Treckingsandalen. Diaby ist gern gesehener Gast in den Vereinen seiner Heimatstadt, insbesondere, seitdem er im vergangenen Jahr selbst unter die Laubenpieper gegangen ist.
"Ich bin im Rahmen meiner Wahlkreisbetreuung, wenn Ende April das Wetter schön ist, mindestens alle zwei Wochenenden unterwegs bei Kleingartenfreunden. Denn ich denke, das ist ein Ort des Dialogs, ein Ort des Austausches. Wir reden ja nicht nur übers Kleingartenwesen, wir reden auch über andere Themen, das Thema gesellschaftliches Zusammenleben, das Thema Rente, das Thema Corona-Krise, das Thema Ausbildung und Arbeitsplatz. Da stehe ich zur Verfügung als Politiker, dass man mich da auch fragen kann. Und es gibt keinen besseren Ort als über den Kleingartenzaun."
Prompt bleibt er an einem Gartenzaun stehen und landet bei den Themen, die den Kleingärtner umtreiben: Wie wachsen die Gurken und die Kartoffeln?
"Hast du mal probiert, Süßkartoffeln anzubauen?"
"Ich habe noch gar keine gegessen, Süßkartoffeln, schmeckt das?"
"Das kann ich nur empfehlen, schmeckt lecker. Ja, dafür sind wir da, dass wir uns auch austauschen als Kleingärtner."
"Kartoffeln - wir essen gern mehlig kochende."
Karamba Diaby gilt einigen als Retter der Kleingärten in Ostdeutschland. Nachdem er Mitte der 80er-Jahre aus Senegal zum Chemie-Studium in die DDR gekommen war, untersuchte er direkt nach der Wende für seine Promotion die kontaminierten Böden von Kleingartenvereinen in Halle.
"Ich freue mich sehr, dass damals, als ich die Untersuchung gemacht habe, Schwermetallbelastung von Kleingarten-Böden in Halle, dass es gelungen ist, deutlich zu machen, wo die dominante Belastung war. Die dominante Belastung der Böden war in der Luft."

Einige junge Pächter haben Angst
Das Schwermetall in der Luft kam aus der Chemieindustrie, aus den Kohleöfen und den Trabis, fand Diaby heraus. Eine gute Botschaft für die Kleingärtner. Denn damit war klar, dass die Böden sich wieder erholen konnten, wenn erst die Luft besser wird. Es durfte also weiter gegärtnert werden. Heute kommt die Bedrohung der Kleingärten aus anderer Richtung. Mit dem Leerstand wie die Vereine in der Peripherie haben die Gärten in Halle kaum noch zu kämpfen. Mit Beginn der Corona-Pandemie war der "Grüne Winkel" ausgebucht. Der Verein hat in seiner städtischen Lage andere Probleme: Der Stadtrat will zwei nahegelegene Hauptstraßen miteinander verbinden. Und einer der Vorschläge, die erörtert werden, würde das Aus für seine Gartenanlage bedeuten, sagt Vereinsvorstand Michael Helbig.
"Die Variante 3, die man dort vorgestellt hat und die man erst einmal fast einstimmig beschlossen hat, ist halt eben, diese Trasse durch unsere Anlage zu bauen, das kann und darf nicht passieren, weil wir Kleingärtner bleiben müssen."
"Die Variante 3, die man dort vorgestellt hat und die man erst einmal fast einstimmig beschlossen hat, ist halt eben, diese Trasse durch unsere Anlage zu bauen, das kann und darf nicht passieren, weil wir Kleingärtner bleiben müssen."
Einige junge Pächter, die Karamba Diaby, auf seinem Rundgang begleiten, haben Angst. Sie wohnen nur ein paar Minuten entfernt und haben ihre Parzellen in der Corona-Krise wegen ihrer Kinder übernommen. Sie haben ihre Lauben und Gärten gerade erst hergerichtet und fürchten nun, sie bald schon wieder zu verlieren.
"Weil wir halt viel reingesteckt haben, körperliche Arbeit und auch viel Geld, und deswegen haben wir ein bisschen Angst: Was passiert jetzt?"
"Wir haben viel Herzblut hier reingesteckt."
"Man macht da ja mit Liebe."
Karamba Diaby kann als Bundespolitiker nicht viel tun in diesem kommunalen Konflikt. Aber er verspricht, dass er sich für einen Bürgerdialog stark machen will, damit zumindest alle Seiten gehört werden. Kleingärten haben auf dem Land wie in der Stadt wichtige Funktionen. Sie sind sozialer Treffpunkt und Ausgleich zur Etagenwohnung. Viele Vereine öffnen sich auch für öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kitas oder Altenheime. In den dichter werdenden Städten dienten die unversiegelten Flächen zudem als "grüne Lunge", sagt Heike Gerth-Wefers. Sie ist Sozialforscherin beim Institut "Weeber+Partner für Sozialforschung und Stadtplanung". Sofern öffentlich zugänglich, seien sie auch wichtiger Durchgang für die Stadtbewohner.
"Wir haben immer von den städtebaulichen, ökologischen und sozialen Funktionen des Kleingartenwesens gesprochen. Und daran halten wir fest, weil sich das in diesen Zeiten, wo schwierigere soziale Verhältnisse und mehr Spannungen sind, wo das Thema Klima, Klimawandel, Klimaanpassung wichtiger wird und wo gerade in verdichteten Städten die Frage nach Flächen für Nutzung, die die Städte brauchen, interessanter wird, ist die Bedeutung nicht zurückgegangen, sondern wichtiger geworden."
Gerth-Wefers hat diese Daseinskonflikte der Kleingärtner für das "Bundesinstitut für Bau-Stadt- und Raumforschung" untersucht. Vor allem in den großen, wachsenden Städten steht der Fortbestand von Kleingärten trotz steigender Nachfrage immer wieder in Frage. Die Verwaltungen stehen unter dem Druck, mehr Wohnraum zu schaffen. Da die Grundstücke der Schrebergärten oft in öffentlicher Hand sind, ist die Versuchung groß, sie als lukratives Bauland zu nutzen. So wie im Norden von Hamburg.
"Und das hier?" "Das ist quasi so eine wilde Pastinake. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommt. Aber wir fanden die so ganz hübsch …"
"Weil wir halt viel reingesteckt haben, körperliche Arbeit und auch viel Geld, und deswegen haben wir ein bisschen Angst: Was passiert jetzt?"
"Wir haben viel Herzblut hier reingesteckt."
"Man macht da ja mit Liebe."
Karamba Diaby kann als Bundespolitiker nicht viel tun in diesem kommunalen Konflikt. Aber er verspricht, dass er sich für einen Bürgerdialog stark machen will, damit zumindest alle Seiten gehört werden. Kleingärten haben auf dem Land wie in der Stadt wichtige Funktionen. Sie sind sozialer Treffpunkt und Ausgleich zur Etagenwohnung. Viele Vereine öffnen sich auch für öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kitas oder Altenheime. In den dichter werdenden Städten dienten die unversiegelten Flächen zudem als "grüne Lunge", sagt Heike Gerth-Wefers. Sie ist Sozialforscherin beim Institut "Weeber+Partner für Sozialforschung und Stadtplanung". Sofern öffentlich zugänglich, seien sie auch wichtiger Durchgang für die Stadtbewohner.
"Wir haben immer von den städtebaulichen, ökologischen und sozialen Funktionen des Kleingartenwesens gesprochen. Und daran halten wir fest, weil sich das in diesen Zeiten, wo schwierigere soziale Verhältnisse und mehr Spannungen sind, wo das Thema Klima, Klimawandel, Klimaanpassung wichtiger wird und wo gerade in verdichteten Städten die Frage nach Flächen für Nutzung, die die Städte brauchen, interessanter wird, ist die Bedeutung nicht zurückgegangen, sondern wichtiger geworden."
Gerth-Wefers hat diese Daseinskonflikte der Kleingärtner für das "Bundesinstitut für Bau-Stadt- und Raumforschung" untersucht. Vor allem in den großen, wachsenden Städten steht der Fortbestand von Kleingärten trotz steigender Nachfrage immer wieder in Frage. Die Verwaltungen stehen unter dem Druck, mehr Wohnraum zu schaffen. Da die Grundstücke der Schrebergärten oft in öffentlicher Hand sind, ist die Versuchung groß, sie als lukratives Bauland zu nutzen. So wie im Norden von Hamburg.
"Und das hier?" "Das ist quasi so eine wilde Pastinake. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommt. Aber wir fanden die so ganz hübsch …"
Hamburg: Statt zwei Kleingartenvereinen sollen es Wohnhäuser geben
Schrebergartenkolonie Diekmoor 2. Mahin Abad Dar hat die dunklen Haare zum Zopf gebunden und beugt sich mit zwei Besuchern über ihre Pflanzen. Nur ein schmaler Pfad schlängelt sich durch die Staudenbeete in Abad Dars Garten. Lichtnelke, Glockenblume und Geißraute sprießen so üppig, dass sie eher an eine Wildwiese erinnern als an ein Beet in einem Kleingarten.
"Wir sehen wirklich, wenn hier volle Blüte ist, dass Schmetterlinge kommen, unterschiedliche Bienenarten, Käfer, Fliegen usw., also wir haben hier wirklich eine unglaubliche Bandbreite an Insekten."
Mahin Abad Dar hat den Garten vor zweieinhalb Jahren mit ihrem Mann gepachtet, einem Biologen. Doch nun sehen sie ihre Arbeit gefährdet.
"Unser Garten würde laut der Pläne, so wie ich es verstanden habe, auch eliminiert werden. Und das ist natürlich für die ganzen Pflanzen und Tiere, die wir hier haben, sehr tragisch."
"Wir sehen wirklich, wenn hier volle Blüte ist, dass Schmetterlinge kommen, unterschiedliche Bienenarten, Käfer, Fliegen usw., also wir haben hier wirklich eine unglaubliche Bandbreite an Insekten."
Mahin Abad Dar hat den Garten vor zweieinhalb Jahren mit ihrem Mann gepachtet, einem Biologen. Doch nun sehen sie ihre Arbeit gefährdet.
"Unser Garten würde laut der Pläne, so wie ich es verstanden habe, auch eliminiert werden. Und das ist natürlich für die ganzen Pflanzen und Tiere, die wir hier haben, sehr tragisch."
Hamburg will auf dem Gebiet von zwei Kleingartenvereinen Wohnhäuser bauen, da wo jetzt noch Mahin Abad Dars bedrohte Parzelle liegt, eine von insgesamt 240. Initiator ist Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz von den Grünen, der bundesweit von sich reden gemacht hat, weil er in seinem Bezirk keine Einfamilienhäuser mehr genehmigen will. Hamburg hat das Ziel, jedes Jahr 10.000 neue Wohnungen zu bauen. Werner-Boelz verspricht, dass Menschen in den 700 geplanten Wohnungen am Diekmoor eine Bleibe finden würden, die sich die teuren Mieten anderswo nicht leisten könnten. Die Grünfläche sei eines der letzten zusammenhängenden Gebiete, das ihm für Wohnungsbau zur Verfügung stehe. Seine Kritiker widersprechen. Dafür gebe es ausreichend Industriebrachen. Sie halten es für eine ökologische Sünde, hier zu bauen.
"Wir haben ein Moorgebiet, wir haben Feuchtwiesen, wir haben Wald, wir haben den Bornbach mit dem Rückhaltebecken als Biotopsystem, und wir haben die Schrebergärten. Wir haben ein sehr hohes Regenaufkommen hier, also dieses Gebiet fängt den Regen auf. Das ist auch noch so eine Sache, weswegen gar nicht versiegelt werden sollte oder darf."
Sagt Michael Heering, einer der Initiatoren der Kampagne "Rettet das Diekmoor". Besonders sauer sind die betroffenen Kleingärtner am Diekmoor, weil sie sich um ihr Mitspracherecht betrogen fühlen.
"Der große Aufschrei ist ja hier erfolgt, weil der Herr Werner-Boelz, der Bezirksamtsleiter, uns ja gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, ein Bürgerbegehren zu starten."

Aktivisten kämpfen dafür, dass das Grün erhalten bleibt
Normalerweise ist Wohnungsbau Sache der Bezirke. Und die Bürger können gegen ein Vorhaben des Bezirks vorgehen. Es sei denn, der Hamburger Senat zieht die Sache durch Weisung an sich. In diesem Fall ist es anders: Bezirksamtschef Werner-Boelz hat selbst um diese Weisung gebeten. Er hat seinem eigenen Bezirk die Entscheidungsgewalt entziehen lassen, und so die Bürgerbeteiligung verhindert. Kleingarten-Aktivist Heering fühlt sich von den Grünen verraten.
"Wir haben die Grünen gewählt, weil sie immer dafür standen, dass Grün wirklich geschützt sein soll. Dass Bürger eben Bürgerrechte haben und ein Bürgerbegehren das höchste Gut mit ist."
Alle, die durch den geplanten Wohnungsbau ihren Kleingarten verlieren, müssen eine Ersatzparzelle erhalten. Die steht Kleingärtnern in Hamburg gesetzlich zu. Der Ersatz wird allerdings durch sogenannte Nachverdichtung geschaffen. Und die hält Benny Rimmler für fatal:
"Das System funktioniert folgendermaßen: Bestehende Parzellen werden geteilt, das heißt, aus einer Parzelle werden zwei gemacht, aus 100 werden 200 oder auch mal 300, je nach Größe."
"Wir haben die Grünen gewählt, weil sie immer dafür standen, dass Grün wirklich geschützt sein soll. Dass Bürger eben Bürgerrechte haben und ein Bürgerbegehren das höchste Gut mit ist."
Alle, die durch den geplanten Wohnungsbau ihren Kleingarten verlieren, müssen eine Ersatzparzelle erhalten. Die steht Kleingärtnern in Hamburg gesetzlich zu. Der Ersatz wird allerdings durch sogenannte Nachverdichtung geschaffen. Und die hält Benny Rimmler für fatal:
"Das System funktioniert folgendermaßen: Bestehende Parzellen werden geteilt, das heißt, aus einer Parzelle werden zwei gemacht, aus 100 werden 200 oder auch mal 300, je nach Größe."
Rimmler hat mit Gleichgesinnten die "Schreberrebellen" gegründet, weil er seine Interessen durch den herkömmlichen Kleingartenverband nicht vertreten sah. Im Fall von Diekmoor hieße die Nachverdichtung: In den umliegenden Gartenkolonien, die bestehen bleiben, sollen die Parzellen neu aufgeteilt und verkleinert werden. Wer seinen bisherigen Garten verliert, soll dort eine neue, kleinere Parzelle als Ersatz erhalten.
"Das ist die Ursache, warum die Zahl der Parzellen in Hamburg gleichbleibt, die Fläche aber jedes Jahr um 20 Fußballfelder zurückgeht."
Benny Rimmler von den Schreberrebellen und die Aktivisten im Diekmoor halten das für Etikettenschwindel. Sie wollen weiter dafür kämpfen, dass nicht nur die Parzellen gezählt werden, sondern auch das Grün erhalten bleibt, das die Kleingärten in ihren Augen so wertvoll macht.