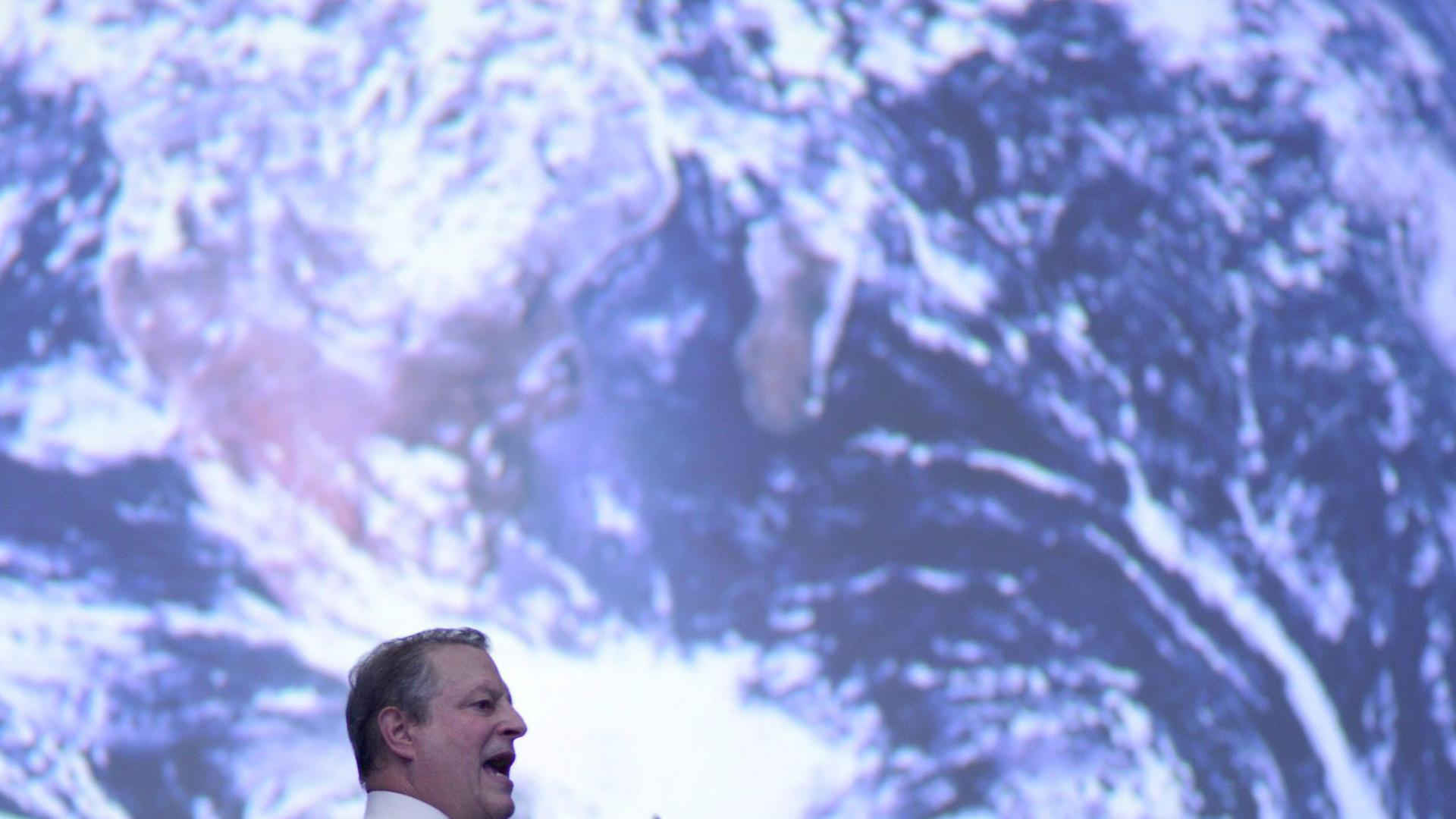Barbara Hendricks sieht den Schwarzen Peter beim Klimaschutz nicht mehr nur im Lager der Industriestaaten. Wenige Tage nach dem Ende der Weltklimakonferenz von Lima wurde die Bundesumweltministerin im Bundestag heute sehr deutlich:
"Wer mehr zur Erhitzung der Erde beiträgt, muss auch mehr beim Klimaschutz tun. Und wer wirtschaftlich leistungsfähiger ist, muss mithelfen, die ärmeren Länder bei Anpassung und klimaverträglicher Wirtschaftsentwicklung zu unterstützen. Alte Kampfparolen bringen uns da nicht weiter."
Denn: Die alte Trennung zwischen ärmeren Schwellenländern und den reichen Industrieländern gebe es so nicht mehr. Wenn China inzwischen der größte und Indien der drittgrößte CO2-Verursacher seien, dann brenne es inzwischen auf beiden Seiten der Grenze zwischen ärmeren und reicheren Ländern, so Barbara Hendricks. Und wenn ein Land wie Malaysia inzwischen gemessen am Pro-Kopf-Einkommen reicher sei als Rumänien, dann müssten die alten Grabenkämpfe einfach überwunden werden, um bei der nächsten entscheidenden Klimakonferenz Ende nächsten Jahrs in Paris zu einer Ergebnis zu kommen. Hendricks räumte ein, Lima habe hierfür noch nicht den großen Durchbruch gebracht. Ähnlich schnörkellos und unprätentiös bewerte Hendricks auch das nationale Klimaschutzprogramm, das Anfang Dezember und damit kurz vor Beginn von Lima noch verabschiedet worden war. Es beschreibt, wie Deutschland bis 2020 seinen CO2-Austoß um 40 Prozent reduzieren will.
"Nie zuvor hat eine Bundesregierung ein so umfassendes Klimaschutzprogramm erarbeitet, das alle Sektoren und alle Akteure gleichermaßen in die Pflicht nimmt. Egal, ob Energiewirtschaft, Verkehr oder Landwirtschaft: Alle müssen ihren Beitrag leisten."
Finger in die Wunde
Während Hendricks betonte, Deutschland könne mit dem Klimaschutzprogramm die minus 40 Prozent beim CO2-Ausstoß erreichen, legte Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, den Finger genau in diese Wunde. Für einen Erfolg in Paris im nächsten Dezember sei entscheidend, wie viel die einzelnen Staaten am Ende tatsächlich einsparten und da, so Hofreiter, sei man auch in Deutschland mitten im Elend der Klimaschutzpolitik. Schließlich hätten Wirtschaftsminister Gabriel und Kanzlerin Merkel dafür gesorgt, dass das nationale Klimaschutzprogramm überwiegend Prüfaufträge enthalte und wenig konkrete Maßnahmen. Damit aber werde die Bundesregierung im nächsten Jahr nicht weit kommen.
"Und wissen Sie, wenn Sie im nächsten Jahr letztendlich dann in Richtung UNO gehen müssen, in Richtung Meldung der verbindlichen Klimaschutzziele, in Richtung dieser Meldung, da müssen sie eine konkrete Zahl nennen, diese konkrete Zahl sollte hinterlegt sein, da kommen Sie am Ende nicht mehr mit lauter Prüfaufträgen durch!"
Kontroverse Einschätzung
Ähnlich kontrovers die Einschätzung beim Green Climate Fund. In Lima war es gelungen, diesen mit 10 Milliarden Dollar zu füllen, um ärmere Länder bei Klimaschutzanstrengungen zu unterstützen. Während Umweltministerin Hendricks diese Einmalzahlung von zehn Milliarden Dollar als Erfolg wertete, kritisierte Annalena Baerbock von den Grünen:
"Der Green Climate Fund hat jetzt zehn Milliarden, und wir brauchen 100 Milliarden, und die Green-Climate-Fund-Einzahlungen, die sind einmalig, und Sie haben versprochen, 100 Milliarden jährlich zu zahlen, diese Versprechen wurden nicht gehalten."
"Der Green Climate Fund hat jetzt zehn Milliarden, und wir brauchen 100 Milliarden, und die Green-Climate-Fund-Einzahlungen, die sind einmalig, und Sie haben versprochen, 100 Milliarden jährlich zu zahlen, diese Versprechen wurden nicht gehalten."
Weshalb das Misstrauen der ärmeren Länder gegenüber den Industriestaaten fortbestehe. Letztere haben zugesagt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Geldern für den Klimaschutz in ärmeren Ländern bereit zu stellen.