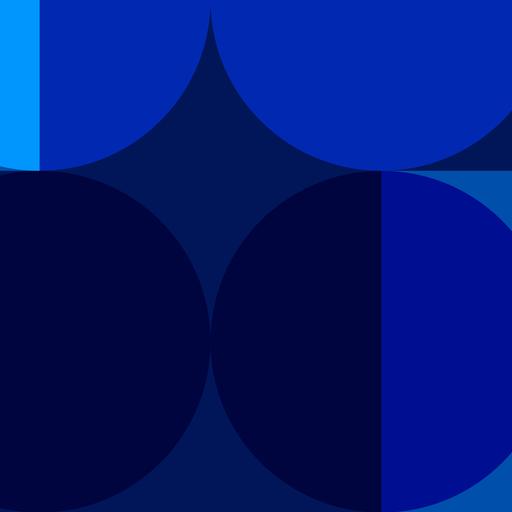Es müssen die apokalyptischen Reiter sein, es ist wohl der Tag des Weltuntergangs. Aus den Tiefen der Wälder zieht es heran, dieses unheilvolle Grollen, es braust über die Lagune, die im sanften Dunst liegt, steigert sich zum zum Fauchen eines Höllenofens und will und will nicht enden: Die Brüllaffen begrüßen den Morgen.
Der Tag beginnt früh im Napo Wildlife Center im Yasuni-Nationalpark von Amazonien. Schon um halb sechs klopft Naturführer Bolivar Cerda an die Tür der Hütte.
Die Lodge liegt eine halbe Flug- und drei Bootsstunden östlich der Hauptstadt Quito im Yasuni-Nationalpark im Dschungel. Wie große, graue Pilze ragen die Palmstrohdächer der Bungalows aus dem Grün. Die Anlage gehört der Gemeinde Anangu vom Stamm der Kachwa. Gegründet wurde sie 1998. Pancho Tapuy, einer der beiden Geschäftsführer, erinnert sich:
"Mein Kollege Jiovanni Rivadeneira war der Motor hinter allem. Seine Idee war, eine Arbeitsmöglichkeit zu schaffen, die es den Männern erlaubte, nahe bei ihren Familien zu bleiben. Und dabei aber auch genügend Geld zu verdienen, dass niemand mehr sein Land an die Ölgesellschaften verkaufen musste. Nach und nach hat er sechs andere Männer davon überzeugt, dass man die Ressourcen des Waldes nutzen könnte, um nachhaltigen Tourismus zu betreiben."
Die Sieben ließen sich von einem Architekten eine Lodge planen, schlugen während zweier harter Jahre gemeinsam Holz und errichteten 16 Bungalows und ein großes Zentralgebäude. Bäume für Bretter und Balken und Palmblätter für die Dächer fanden sie vor Ort.
"Aber den Zement, die ganzen Möbel, die Badezimmerarmaturen, das Geschirr - all das mussten wir uns außerhalb besorgen und mit Kanus den Fluss hoch paddeln - alles in Handarbeit. Für den Generator haben wir sogar aus zwei Booten einen Katamaran gebaut."
Und auch heute noch kommen alle Vorräte auf diesem Weg an: Motorboote sind auf dem Gemeindegebiet verboten. Fischen und Wilderei, anderswo im Park durchaus gang und gäbe, wird strikt geächtet. Der gesamte Müll wird getrennt und in die Stadt Coca verbracht.
Nach dem Frühstück geht es mit dem Kanu hinaus auf einen der vielen Wasserarme, hinein in das große Labyrinth namens Dschungel. Überhängende Bäume spiegeln sich im tiefschwarzen Wasser, Helikonien blühen, eine Süßwassermangrove steht schräg im Morast, als wäre sie im Begriff, eben davonzuwandern. Ein Zimt-Attila, ein kleiner Singvogel, liefert sich mit Naturführer Bolivar einen akustischen Wettstreit.
Totenkopfäffchen und Riesenotter
Von einem Baum hängen wie graue Riesentropfen die Nester lärmender Webervögel und hinter der nächsten Biegung lebt der Wald richtig auf. 50, 60 Totenkopfäffchen plündern einen Guavenbaum. Wie Kamikazeakrobaten toben sie zwischen den Ästen hindurch und wieder und wieder fängt einer sich nach seinem Sprung erst am allerletzten, dünnen Zweig und guckt blasiert herüber: cool, was? In einem Seitenarm legt Bolivar plötzlich den Finger auf den Mund.
Schon taucht ein schwarz-weißer Kopf aus dem Wasser, ein glitschiger Körper, länger als einen Meter, folgt. Und plötzlich prusten und planschen gleich fünf Riesenotter wie Schuljungen durcheinander. Führerin Caro Toapanta hat die wendigen Schwimmer schon öfter gesehen.
"Fünf Tiere sind es, schau mal, es ist eine ganze Familie. Da drüben rechts, das ist das Junge. Sein Kopf ist kleiner, es ist viel verspielter als die anderen und noch weniger scheu. Riesenotter ernähren sich hautsächlich von Fisch und gehören zu den größten Säugetieren in Amazonien. Leider werden sie wegen ihres Fells gejagt, und sie haben auch immer weniger ruhigen Lebensraum. Hier am Anango-Fluss ist eines der wenigen Gebiete in Ecuador, wo man sie noch zu Gesicht kriegt."
Sie jagen sich, sie kämpfen spielerisch, doch irgendwann hat einer einen Fisch erbeutet und aus dem fröhlichem Schnaufen wird ein abwehrendes Fauchen und Knurren.
Anderntags führen Bolivar und Caro ihre Gäste in den Wald auf den sogenannten Tiputini-Pfad.
"Bitte passt auf, wo ihr eure Hände und Füße hinsetzt im Wald. Ihr könntet versehentlich eine Riesenameise anfassen, oder möglicherweise liegt eine Schlange auf dem Weg. Deswegen geht Bolivar immer voran, und der zweite Führer macht den Schluss."
Der Pfad führt in eine Säulenhalle aus grün-weißen Pfeilern, die mit mächtigen Dreieckswurzeln im Grund verankert sind. Die Kaopkbäume leben auf großem Fuß. Aber die Wurzeln reichen nicht tief, weil alle Nahrung sich in dem dünnen, verrottenden Teppich aus Blättern und Zweigen findet und über ein feines Pilzgeflecht im Boden aufgenommen wird. Die beiden Führer entdecken in dieser grünen Welt immer wieder etwas Neues.
"Da sehen wir einen Pipra. Hinten, auf dem weißen Stamm, ein bisschen rechts, dieser kleine schwarze Vogel mit weißem Kopf, etwas weiter oben - das ist ein Weißscheitel-Pipra, ein Schnurrvogel."
Lebensmittellager, Apotheke und Schmuckboutique in einem
Für die Einheimischen ist der Dschungel Lebensmittellager, Apotheke und Schmuckboutique in einem. Bolivar entdeckt eine Taguanuss und erzählt in Kichwa, der Sprache seines Volkes, wozu er und seine Leute die kastaniengroßen, braunen Kugeln nutzen.
"Tagua - das ist eine Frucht, die Kapuzineraffen und Tukane gern fressen. Sie ist so hart wie Stein oder Elfenbein und lässt sich prima schnitzen. Wir machen Halsketten daraus, Anhänger und vor allem Knöpfe."
Und darüber hinaus exportiert Ecuador jedes Jahr 30 000 Tonnen dieses "pflanzlichen Elfenbeins".
Im Inneren einer Palme wachsen die Maiones heran, drei, vier Zentimeter lange, weiße Maden. Auf dem Markt im Flussdorf Pompeya kann man sie probieren: Sie werden gegrillt und schmecken wie angebrannter Gummi mit glitschigem Inhalt, aber sie sind ein wichtiger Eiweißlieferant.
Auf die Besucher wirkt dieser Dschungel wie eine Mischung aus Zoo und botanischem Garten. Wie schnell er aber auch zur grünen Hölle werden kann, verrät Bolivar bei der Rast.
"Ich habe hier am Tibutini-Pfad gearbeitet. Es hat geregnet, so stark, dass ich nicht gehört habe, wie eine Herde Pekaris auf mich zukam, Nabelschweine. Ich habe noch versucht, wegzulaufen, bin aber über eine Wurzel gestolpert. Und dann hat mir einer der Eber das Bein mit seinen Hauern aufgeschlitzt. Es hat gebrannt wie Feuer, überall war Blut. Ich habe geschrien und geschrien, aber natürlich war niemand in der Nähe. Ich musste die Nacht im Wald schlafen und bin am nächsten Morgen zurückgehumpelt und -gekrochen. Meine Frau hat Blätter von Heilpflanzen aufgekocht und auf die Wunde gelegt. Und die ist tatsächlich wieder verheilt."

Etwas weiter im Wald befindet sich eine sogenannte Salzlecke. Man hört den Lärm schon geraume Zeit, bevor man ankommt. Dann glaubt man seinen Augen kaum zu trauen: Dutzende von Papageien und Sittichen drängen sich in einer braunen Kuhle am Fuß einer Lehmwand. Eine Gruppe deutscher Touristen beobachtet das Geschwirr und Geschrei versteckt von einem Unterstand aus. Ihr Führer Marco Cisneros versteht es, in dem großen Durcheinander die einzelnen Arten zu unterscheiden.
"Wir müssen jetzt ganz ruhig hier sein, weil die sind sehr nervös. Den wir jetzt gerade sehen, heißt Goldwangenpapagei. Und die andere Kobaltflügelsittich. Die kleine andere mit rote Flügel heißen "scarlet shoulder parakeet". Das ist ein Spiel: Sie fliegen weg, kommen wieder, fliegen weg. Das sind ungefähr, wir schätzen, so 300 bis 400 kleine Papageien."
Neuankömmlinge suchen sich flügelschlagend einen Platz in dem Gewirr, andere heben Wasser stiebend wieder ab. Die Luft flirrt von Grün und Gelb und Türkis und manchmal leuchtet es tieforange dazwischen auf. Tatsächlich gibt es einen guten Grund für diese tägliche Versammlung. Es ist eine medizinische Notwendigkeit.
"Die Papageien, die haben diese kleine Karte in dem Kopf, weil die fliegen tagsüber 80 bis 100 Kilometer im Kreis und jeden Morgen die müssen zuerst hier kommen und die Mineralien lecken hier. Die Mineralien neutralisieren, was die fressen tagsüber. Die fressen Samen, Früchte, Blätter, das kann viele Toxine haben und das hilft zum Neutralisieren und auch für eine gute Verdauung."
80 Familien aus dem Dorf arbeiten inzwischen in irgendeiner Form für den Tourismus. In der Lodge sind es nur Männer. Die Frauen haben ein eigenes Projekt aufgebaut: Curimuyo ist ein Kulturzentrum, drei im alten Stil gebaute, nach den Seiten hin offene Häuser im Wald.
Schüchtern führen vier Frauen zwischen 30 und 70 einen einfachen Tanz zu einem Lied vor, das Maibel Cerda, eine von ihnen, selbst geschrieben hat.
Die Begegnung scheint den Frauen Spaß zu machen. Wie im Freilichtmuseum führen sie den Besuchern selbstbewusst ein wenig Leben von früher vor: So wurden einst Netze aus Palmfasern geknüpft! Auf diesem Herd räucherte man Affen und Gürteltiere! Und in den Mörsern und Schalen stampfte und rieb man Yucca-Wurzeln. Aus dem dabei produzierten Maniokmehl wird auch heute noch unter anderem Chicha gewonnen, das Dschungelbier. Es schmeckt ein wenig metallisch und nach Gerste. Mit einem Muschelhorn wurden die Dorfbewohner einst für gemeinsame Arbeiten zusammengerufen.
Mittlerweile hat es zu schütten begonnen, der Regenwald macht seinem Namen jetzt alle Ehre. Die Palmdächer aber lassen keinen Tropfen durch, auch im Souvenirladen bleibt es trocken. Hier verkaufen die Frauen Andenken, die sie ausnahmslos selbst hergestellt haben:
Armbänder, die aus Fasern geflochten sind, sind im Angebot. Schöne Ketten mit schwarz-roten Anamara-Samen. Und farbenprächtige Aras und Tukane aus Balsaholz.
Mit dem heutigen Leben der Kichwa hat diese Folklore nicht allzu viel zu tun. Der Alltag findet nahebei im Dorf statt. Anangu liegt direkt am Napo-Fluss, hat 220 Einwohner und ist picobello sauber. Die Kinder besuchen eine neue Schule, in der Sanitätsstation sind Behandlung und Medikamente kostenlos. Müll wird getrennt, Alkohol ist verboten. Und am Sonntag spielen die Jugendlichen "Ecuavolley", die landestypische Variante von Volleyball. Und sie achten dabei sorgfältig auf ihre Haare, in die sie heute Gel schmieren durften, was während der Woche nicht erlaubt ist.
Angst vor Ölkonzernen
Dem Dorf geht es gut - dank der Lodge und den Touristen. Die Zukunft könnte allerdings ein paar Probleme bereithalten, meint Pancho Tapuy, der Manager.
"Wir können nicht ausschließen, dass uns irgendwann die Ölkonzerne auf den Leib rücken. Und dass es dann zu Konflikten kommt. Sie dürfen schon jetzt in einem kleinen Teil des Nationalparks bohren, und eine Firma sitzt direkt gegenüber auf der anderen Seite des Napo. Je weiter sie vorrücken, desto mehr Auswirkungen hat das auf die Natur. Noch gibt es keine Probleme, aber wir müssen wachsam sein."
Am letzten Tag geht es hoch hinaus. Mitten im Dschungel haben Spezialisten neben einem Kapok-Baum ein stählernes Turmgestell errichtet - und die ganze Bewunderung gilt den Männern, die sich in diese schwindelerregende Höhe vorgearbeitet haben. Treppen führen 38 Meter hoch und hinüber auf eine Plattform im Wipfel des Riesen.
"Diese Welt hier oben ist eine Welt ganz für sich, vollkommen verschieden von der am Boden. Wir finden hier besondere Fledermäuse, Eidechsen, Moose und Orchideen. Manche Bromelien bilden sogar ein eigenes Habitat. Baumfrösche leben in dem Wasser, das sie speichern. Und Affen trinken davon und müssen dann nicht hinunter auf die Erde."
Rundum zu Füßen erstreckt sich das grün-graue Meer des Waldes bis zum Horizont. Die Sonne glitzert metallisch auf Milliarden von Blättern. Caro baut das Spektiv auf, und wieder gelingt es ihr, im grünen Einerlei farbige Abweichungen auszumachen: Da sitzt ein Tukan, einer jener bunten Vertreter, bei denen man sich immer fragt, wie sie es mit ihrem mächtigen Schnabel fertigbringen, nicht vornüber zu kippen. Und direkt gegenüber schillert noch etwas im Grün:
"Schau mal, rechts von dem dicken Stamm, so ein, zwei Meter und ein bisschen nach oben, siehst du den blauen Fleck mit dem Gelb im Mittelpunkt - das ist ein Gelbbrustara. Oh, jetzt fliegt er hoch, schau, schnell. Aras leben immer in Paaren, sie fressen hauptsächlich Samen und haben deshalb diesen großen Schnabel. Sie sind sehr gefährdet, weil sie als Haustiere so beliebt sind. Sie fliegen fast immer in Gruppen - tatsächlich, jetzt sind sie zu dritt, die beiden Alten und ein jüngerer."
Von einem Moment zum anderen setzt der Abend ein. Es geht zurück, aus der klaren, moskitofreien Luft hinunter ins Dumpf-Modrig-Süße, anschließend mit dem Kanu durch den Sumpf. Der schwarze Spiegel des Wassers verdoppelt Palmen, Helikonien und Mangroven. Große Fledermäuse sind jetzt unterwegs, die Frösche huldigen den ersten Sternen.
Das Glucksen und Gurgeln aus der braun-amphibischen Welt ringsum besagt vor allem eines: Draußen bleiben, Mensch! Dieser Lebensraum ist nicht für dich gemacht.
Und während das Kanu der Lodge zu gleitet, erfüllen zwei Arten von Gefühlen den Besucher: Dankbarkeit, dass er dieses grüne Universum kennenlernen durfte. Und eine vage Hoffnung, dass die Welt irgendwann doch versteht, welchen Verlust sie erlitte, sollte ihr diese Kostbarkeit eines Tages abhandenkommen.