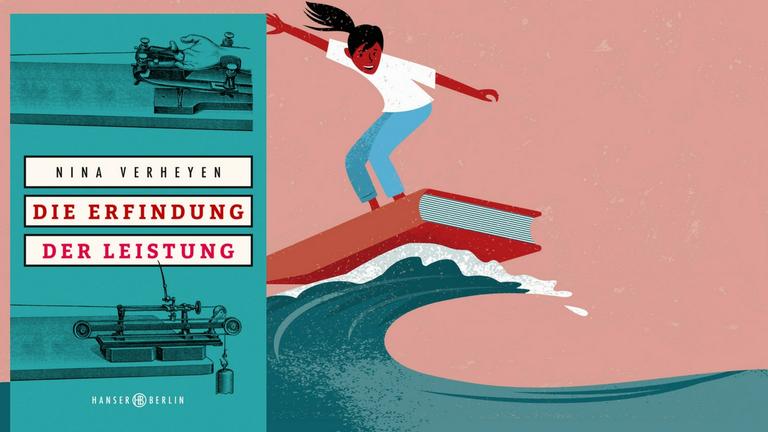
Wie gut es uns geht, das ist nicht nur vom Zufall abhängig. Wir leben in einem meritokratischen Zeitalter mit dem zentralen Versprechen, dass höhere Leistung sich auszahlt.
Doch der Begriff ist schillernd. Ist es eine größere Leistung, wenn ein ohnehin begabter Schüler mit viel Hilfestellung von zuhause eine eins schreibt? Oder ist die drei eines prekär aufwachsenden Schülers ohne Rückendeckung die größere Leistung? Die Autorin positioniert sich hier gleich zu Beginn: Eine individuelle Leistungszuschreibung, wie sie gang und gäbe ist, hält sie für eine Illusion, weil
"[...] hinter dem, was vermeintlich eine Person leistet, immer ganz viele andere stehen, die dieser Person geholfen haben, und da wird eben manchen sehr viel mehr geholfen als anderen. Und ich finde, das sollte man berücksichtigen, wenn man sich überlegt, wen man befördert oder wen man wie gut benotet, als Lehrer etwa, und indem man daran denkt, welche Rolle man selber spielt als Leistungsbewerter."
Leistung außerhalb des Arbeitskontexts
Leistung, so macht eines der heitersten Kapitel des Buches klar, war in der Neuzeit längst nicht immer mit individuellem Ehrgeiz und Geracker verbunden. Die Autorin legt überzeugend dar, dass das gehobene deutsche Bürgertum bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eine entspannte und soziale Definition von Leistung hatte:
"Das Selbstverständnis bürgerlicher Männer [...] zwischen [...] Spätaufklärung und [...] Vormärz [...] erscheint gegen die Folie des heutzutage üblichen Bemühens um stromlinienförmige Selbstoptimierung [...] als regelrechter Gegenentwurf, [...] gelebt von Träumern und Rebellen, die manchmal nur halbtags arbeiteten, viel Zeit mit ihren Freunden, Ehefrauen und Kindern verbrachten, gemeinsam musizierten, spazieren gingen und sich wohltätig engagierten. Dabei nahmen sie durchaus für sich in Anspruch, etwas zu leisten. Sie leisteten einander zum Beispiel Gesellschaft."
Wann aber verschob sich dann der Leistungsbegriff in Richtung individuelle Konkurrenz? Nina Verheyen datiert den Umbruch ins 19. Jahrhundert. Der Kult der Effizienz begann mit der damals noch jungen Disziplin der Physiologie. Auch der Mensch wurde zunehmend als Maschine betrachtet, getrieben von einem Motor, dessen Leistung sich steigern ließ.
Von Doping bis Segregation
Passé war das ganzheitliche Verständnis des Menschen als Einheit von Leib und Seele, die Bahn war frei für "Kollaps und Karriere" im 20. Jahrhundert, wie die Autorin ihr Kapitel über die Leistungssteigerung betitelt. Das führte in den 30er-Jahren zu den Anfängen eines systematischen Dopings. Und zum großflächigen Einsatz des in Deutschland erfunden "Christal Meth", damals noch "Pervitin" genannt, als Durchhaltedroge bei deutschen Soldaten an der Kriegsfront.
Doch Leistungsdruck und Durchhaltezwang entstanden bereits lange vor den Weltkriegen. Das mechanistischer werdende Weltbild des Fin de siècle setzte die Menschen ebenso unter Druck wie die erste Phase internationaler Konkurrenz.
Zudem bekam das deutsche Bürgertum Druck von unten, weil eine aufstrebende Arbeiterklasse nachdrängte. Besonders interessant liest sich, wie diese etablierte Klasse versuchte, sich die Aufsteiger vom Leib zu halten: Das Bürgertum nutzte die damals entstehenden Leistungsmessungen - Schulnoten, standardisierte Aufnahmeprüfungen für die Uni-, um seinen Bildungsvorsprung als Leistungsvorsprung zu objektivieren. Das sprechendste Beispiel der Autorin stammt aus Frankreich, wo ausgerechnet Napoleon der offene Zugang zu Universitäten so suspekt wurde, dass er Studiengebühren einführte und einen Teil des Auswahlverfahrens auf Latein stattfinden ließ:
"Voilà! Diese Sprache lernten nur Sprösslinge aus gebildeten Familien, und schon hatte Napoleon eine stärkere soziale Kontinuität erreicht."
Die Kritik am Leistungsbegriff
Zudem stempelten arrivierte Mittel- und Oberschicht die konkurrierenden Aufsteiger oft als "krankhaft ehrgeizig" ab - um so den meritokratischen Aspekt des neuen Leistungsbegriff zu desavouieren.
"Dieses Argument wurde besonders lautstark im Umgang mit bildungshungrigen und karriereorientierten Frauen eingesetzt. […] Wenn sie ihre begrenzten Kapazitäten für geistige Anstrengungen einsetzen, so das misogyne Argument, fehlten diese den Reproduktionsorganen."
In dieser schrillen Abwehr zeigt sich: Auch die Kritik am ewigen Leistungsdruck ist so alt wie der neue Leistungsbegriff der sich auflösenden ständischen Gesellschaft. Und, das betont Nina Verheyen mehrfach, diese Kritik sei selten "edel" motiviert.
"Die Kritik ist meines Erachtens oft sehr problematisch, weil sich dadurch unter anderem auch die Eliten abschotten. An solche Mechanismen oder solche Denkmuster, finde ich, muss man auch erinnern, wenn man die Kritik an Leistungsstandards oder an Formen der Leistungsbelohnung in den Blick nimmt."
Hier zeigt sich: Nina Verheyen belässt es nicht bei einer überzeugenden und zudem gut lesbaren historischen Analyse der rasanten Karriere des Leistungsgedankens in den vergangenen 200 Jahren. Sie ist, für eine Historikerin, erfrischend meinungsfreudig.
"Den Muße-Predigern der Gegenwart sei [...] gesagt, dass sich viele ihrer Ratschläge vor allem von Gutsituierten realisieren lassen, die sich - wie einst der Adel und dann auch das Bürgertum - über ihre Freizeitpraktiken von anderen sozialen Gruppen abgrenzen und längst zu einer globalen Elite der Ferienhausbesitzerinnen und Ecolodge-Touristinnen avanciert sind."
Doch was ist mit dem grundsätzlichen Einwand, dass längst nachgewiesen ist, dass die Elite sich nicht nur durch Leistungen, sondern durch Habitus und Netzwerke in privilegierten Positionen halte? Höhlt das den Leistungsgedanken nicht so sehr aus, dass er längst auf den Müllhaufen der Geschichte gehört?
Nina Verheyen hält vehement dagegen. Gerade im Namen des Leistungsgedankens - nur erholte Arbeitnehmer sind gute Arbeitnehmer - hätten linke Politiker und Gewerkschafter große Erfolge eingefahren. Außerdem helfe der Leistungsbegriff, Pflege- und Erziehungsarbeit aufzuwerten. Gerade Linke, so die Autorin, sollten "Leistung" als Leitgedanken daher weiterhin im Schilde führen.
Nina Verheyen: "Die Erfindung der Leistung"
Hanser Berlin 2018, 256 Seiten, 23 Euro
Hanser Berlin 2018, 256 Seiten, 23 Euro

