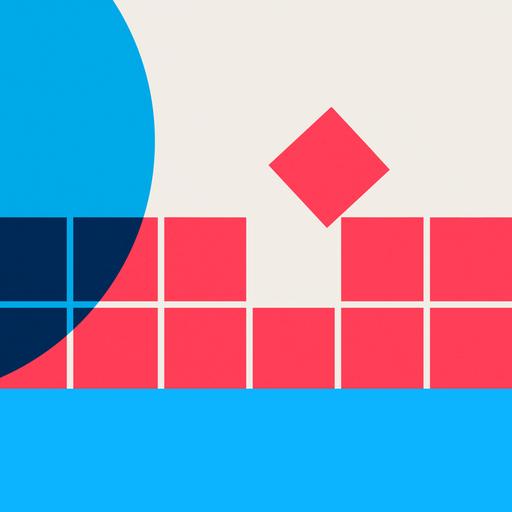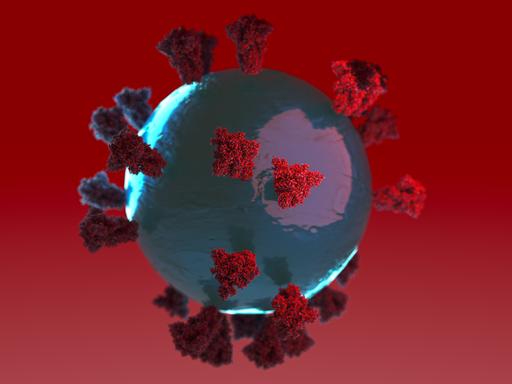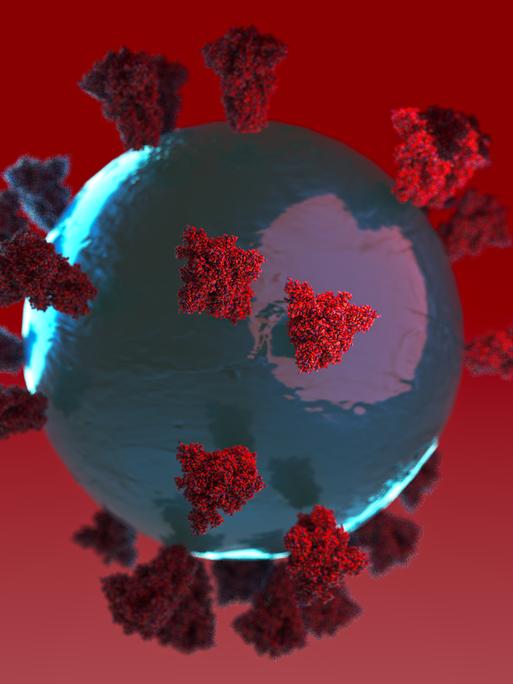Im Frühjahr 2020 kam das Virus auch nach Deutschland. Zunächst waren es einzelne Corona-Fälle, dann schossen die Infektionszahlen in die Höhe. Die Pandemie stellte Wissenschaft, Politik und die gesamte Gesellschaft auf eine enorme Probe. Mit Abstandsgeboten, Maskenpflicht und Lockdowns wurde der Ausbreitung des Virus hierzulande begegnet. Es war ein Mittelweg: bei Weitem nicht so strikt wie beispielsweise in China, Australien oder zeitweise auch Italien, aber deutlich restriktiver als in Schweden, wo es in der ganzen Zeit keinen Lockdown gegeben hat.
Über einen viel strikteren Kurs, den die sogenannte No-Covid-Strategie vorsah, wurde in Deutschland diskutiert. Er wurde jedoch nur in Teilen umgesetzt. Welche Belastungen bringen solche Konzepte mit sich? Darauf können Soziologen und Mediziner heute anhand von Daten Antworten geben. Eine Erkenntnis: Soziale Unterschiede beeinflussen die Infektionszahlen. Das könnte eine wichtige Lektion zur Bekämpfung künftiger Pandemien sein.
Was steckte hinter der No-Covid-Strategie?
No-Covid war ein Ansatz zum Infektionsschutz während der Pandemie. Den ersten Entwurf haben 13 Forschende aus verschiedenen Disziplinen wie Medizin, Ökonomie und Sozialwissenschaften im Januar 2021 formuliert. Ihr Hauptziel: mit strikten Maßnahmen die Corona-Fälle im Idealfall auf null zu reduzieren. Dafür sollten Lockdowns aufrechterhalten werden, bis die Inzidenz in einem Gebiet unter den Wert zehn gefallen ist.
Konkret bedeutet das, dass es dort pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage weniger als zehn Neuinfektionen hätte geben dürfen. Danach sollte gelockert werden. Präsenz-Unterricht in den unteren Klassenstufen sollte wieder möglich sein, Treffen mit einer festgelegten Anzahl von Personen oder Vor-Ort-Arbeit für Berufe, die nicht im Homeoffice tätig sein können. Nach zwei Wochen ohne Neuinfektionen unbekannten Ursprungs sollte das Gebiet zur „Grünen Zone“ erklärt werden.
Dort wäre dann eine „weitgehende dauerhafte Öffnung“ erfolgt. Allerdings hätte es Mobilitätsbeschränkungen in andere Gebiete gegeben, in denen die Inzidenz höher gewesen wäre. Auch eine Test-, Kontaktverfolgungs- und Isolationsstrategie sowie lokales Ausbruchsmanagement gehörten zu den Plänen. Heinz Bude, Mitverfasser und emeritierter Soziologieprofessor, sagt zum Deutschlandfunk, dass es damals eine Isolationsmüdigkeit gegeben habe und sich Menschen ohnmächtig in der Pandemie gefühlt hätten: „Wir wollten einfach hinauskommen aus der Serie von Lockdowns.“
Die Strategie wurde zwar von deutschsprachigen Forschenden verfasst, sollte aber ein Infektionsschutzkonzept für die gesamte Europäische Union sein. Als Vorbilder galten Neuseeland und Australien.
Warum ist der Blick auf sozioökonomische Unterschiede so wichtig?
Einkommen und Wohnumfeld haben das Infektionsrisiko in der Coronapandemie beeinflusst. Mehrere Studien und Recherchen belegen das auch für Deutschland. Stadtteile mit niedrigerem Durchschnittseinkommen hatten während der Lockdown-Phasen höhere Inzidenzen. In Deutschland sei aber spannend, sagt der Medizinsoziologe* Nico Dragano vom Universitätsklinikum Düsseldorf, dass die Inzidenzen im Lockdown-freien Sommer erst in Vierteln mit besserem Einkommen stiegen.
Im Lockdown selbst seien dann die Zahl der Corona-Fälle in ärmeren Stadtteilen durch die Decke geschossen, betont er. „Es gibt Systematiken, wo man davon ausgehen kann, dass gerade die soften Lockdown-Versionen nicht überall gleich gut umgesetzt werden und werden können.“ Etwa sei es in kleineren Wohnungen schwer, sich bei einer Infektion zu isolieren. Auch das unmittelbare Lebensumfeld spiele eine wichtige Rolle, das zeigten Mobilitätsdaten aus den USA. In ärmeren Stadtteilen kauften Menschen eher in engeren Läden ein, besuchten Restaurants mit weniger Platz und Ähnliches. All das erhöhe die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, meint Dragano. Auch zwischen Beruf und Infektionsrisiko sieht er einen Zusammenhang.
Während zu Beginn der Pandemie vor allem Menschen im Gesundheitssektor ein erhöhtes Infektionsrisiko hatten, waren es im weiteren Verlauf Menschen im Reinigungs- und Sicherheitsgewerbe, ebenso wie im produzierenden Sektor. „Eben oft solche Berufe, die nicht besonders gut bezahlt sind, die Kontakt zu anderen Menschen hatten, die nicht ins Homeoffice gehen konnten“, sagt Dragano. Eine andere Untersuchung des Medizinsoziologen, die er zusammen mit weiteren Forschenden erstellt hat, zeigt: Langzeitarbeitslose hatten auch ein erhöhtes Risiko, bei einer Corona-Infektion schwer zu erkranken und stationär im Krankenhaus zu landen.
Die Gründe dafür seien komplex. Neben Vorerkrankungen und dem Wohnumfeld könnte es auch damit zusammenhängen, wie schnell die Menschen gesundheitliche Versorgung in Anspruch genommen haben. So waren die Kosten für Tests und Masken für Empfänger von Arbeitslosengeld schwieriger zu tragen. Zudem betont Dragano, dass es in Gebieten mit weniger Einkommen auch weniger Test-Zentren gab. Wie groß der Einfluss dieser einzelnen Faktoren jeweils war, lässt sich aber aus den bisherigen Studien nicht ableiten.
Welche Rolle spielen sozioökonomische Unterschiede im No-Covid-Ansatz?
Sozioökonomische Unterschiede spielten keine zentrale Rolle. Zwar tauchen sie am Rande in den Papieren auf, wurden aber nicht in das Konzept integriert. Der Soziologe Heinz Bude, der das Konzept mitgeschrieben hat, begründet das im Deutschlandfunk damit, dass man Bürgerinnen und Bürger allgemein ansprechen wollte und nicht als Repräsentanten einer bestimmten sozialen Gruppe.
Wie unterscheiden sich die Belastungen der Milieus?
Die Belastung einzelner Gruppen durch die Anti-Corona-Maßnahmen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es lässt sich jedoch sagen, dass negative Effekte einander in sozioökonomisch benachteiligten Gebieten verstärken. Beengte Wohnverhältnisse und fehlende Freiluftaktivitäten können Familien während eines Lockdowns vor zusätzliche Herausforderungen stellen. Eine Studie mit dänischen Daten zeigt, dass ein fehlender Garten und beengte Wohnverhältnisse sich im Lockdown negativ auf die psychische Gesundheit ausgewirkt haben, ebenso wie fehlende Grünanlagen. Gleichzeitig waren die Inzidenzen während der Lockdowns in diesen benachteiligten Gebieten höher. Beim No-Covid-Ansatz könnte das dazu führen, dass sie länger im Lockdown bleiben als andere Gebiete.
In Leipzig-Grünau, einem der Stadtteile mit dem niedrigsten Durchschnittseinkommen, haben mehrere Familien dem Deutschlandfunk von größeren Problemen beim Homeschooling berichtet. Etwa, weil man sich selbst nicht eingehender in den Stoff einarbeiten konnte. Für mehrere Länder, unter anderem Deutschland, belegen Studien, dass Menschen mit mehr kulturellem Kapital und höheren Bildungsabschlüssen ihre Kinder besser beim Homeschooling unterstützen konnten. Auch eine bessere technische Ausstattung begünstigte den Heimunterricht in der Pandemie.
Was hätten betroffene Familien gebraucht?
Größtes Manko aus Sicht der Betroffenen: Absicherungsmöglichkeiten für die, die ihren Jobs nicht im Homeoffice nachgehen konnten. Außerdem seien - damals wie auch künftig - zivilgesellschaftliche Akteure wichtig, die das Infektionsschutzkonzept vermitteln können, etwa Kirchen oder Quartiersmanagement, sagt der Soziologe Heinz Bude. In Leipzig-Grünau wären längere Lockdowns für die Familien, mit denen der Deutschlandfunk gesprochen hat, nicht vorstellbar gewesen. Einige berichteten, dass sie mehr Unterstützung beim Homeschooling gebraucht hätten.
Generell gelte jedoch, so der Medizinsoziologe Nico Dragano: Ein sozioökonomisch benachteiligter Stadtteil in Leipzig könne ganz anders aussehen als einer in Gelsenkirchen. Und die Menschen haben ebenso unterschiedliche Bedürfnisse bei Infektionsschutzkonzepten. Statt pauschaler Vorgaben müsse man mit den Familien vor Ort reden, „denn die haben natürlich Ideen, die kennen ihre Lebenssituation am besten.“ Daran müsse man passende Infektionsschutzkonzepte für spezifische Gebiete orientieren. Schon jetzt müssten Strukturen vor Ort aufgebaut werden, sagt Dragano. Auch, um bei künftigen Pandemien effektiv reagieren zu können, ohne die sozioökonomischen Faktoren zu vergessen.
* Berufsbezeichnung korrigiert.