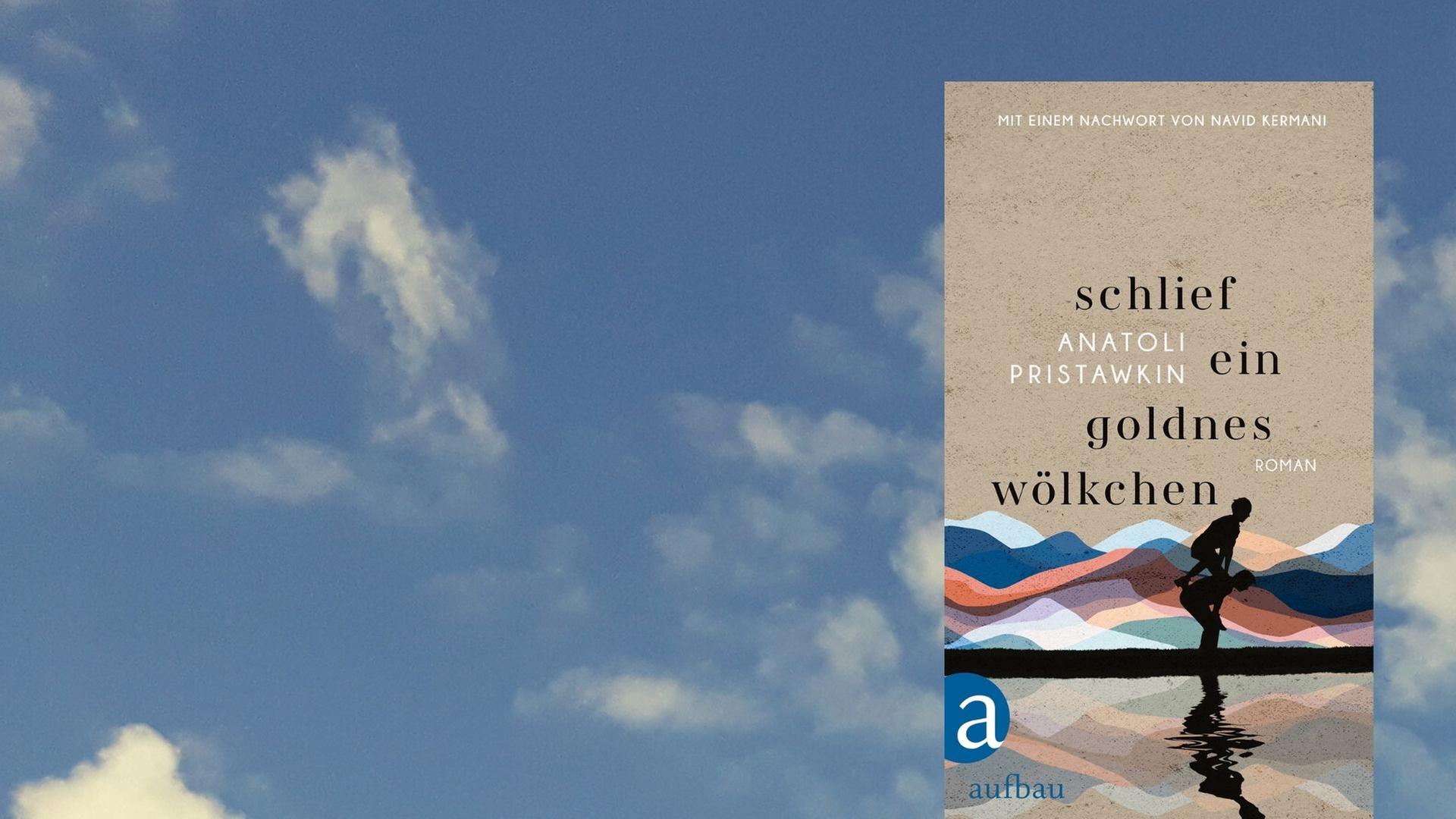Ein "Zuckerkind": Das stellt man sich lieblich vor. Und tatsächlich liest sich das gleichnamige Erinnerungsbuch erstmal wie die Geschichte eines kleinen russischen Mädchens aus gutbürgerlichem Haus: Stellas Eltern – wir sind Anfang der 30er Jahre – sprechen mehrere Sprachen. Sie sind belesen, Bücher sind allgegenwärtig, das Familienleben ist von liebevoller Zuwendung geprägt. Doch früh lernt Stella von ihren Eltern auch das: Ein wirklich guter Mensch ist nur, wer etwas aushalten kann.
"Eines Tages kam ich laut heulend nach Hause, mit aufgeschlagener und geschwollener Nase, aus der Blut tropfte. Bei jedem Tropfen, den ich sah, heulte ich auf. Papa nahm mich auf den Schoß, bog mir den Kopf in den Nacken, legte ein nasses Taschentuch auf meine Nasenwurzel und fragte: 'Es tut weh und ist kränkend?' Weinend nickte ich. 'Weißt du, bei einer Prügelei verliert immer der, der als Erster anfängt zu weinen. Wer nicht weint, gewinnt immer.'"
Eine lebensrettende Devise
Diese innere Haltung wird zur lebensrettenden Devise in Stellas Leben. Denn wenig später, es ist das Jahr 1936 und die Säuberungen unter Stalin sind bereits im Gange, wird die Wohnung eines nachts verwüstet und der Vater als Volksfeind verhaftet. Geschickt verschleiern die Mutter und die Kinderfrau am nächsten Morgen das Ausmaß der Katastrophe.
"Als ich eines Morgens erwachte, sah ich, dass Mama und die Njanja meinen Plüschtieren, einem Tiger und einem Teddy, den Bauch zunähten. Mama sagte, in der Nacht habe es Krieg gegeben zwischen den Spielsachen und dem Mausekönig, Tiger und Teddy seien verletzt worden und würden nun geheilt. Es musste ein recht grausamer Krieg gewesen sein, denn im großen Zimmer lagen Sachen und sämtliche Bücher durcheinander auf dem Boden. 'Wo ist denn Papa?', fragte ich. 'Der musste dringend nach Gorki', antwortete Mama."
Aufbruch nach Kirgisien
Stella wird ihren Vater nie wiedersehen. Er stirbt, so erfährt sie erst Jahre später, 1940 in einem Gulag. Fortan lebt sie allein mit ihrer Mutter – die sich weder vom plötzlichen Geldmangel noch der gesellschaftlichen Ächtung, die ihnen beiden entgegenschlägt, brechen lässt. Auch nicht im Sommer 1937, als Mutter und Tochter mit dem Zug die Reise in die Verbannung nach Kirgisien antreten.
"Einen großen Koffer hatten wir aufgegeben, einen zweiten, kleineren, nahmen wir mit ins Abteil. Wir fuhren erster Klasse, mit allem Komfort, und darin zeigte sich Mamas ganzer Charakter."
Stella und ihre Mutter landen in einem Lager. Die Mutter wird zu Zwangsarbeit verpflichtet, Stella macht Bekanntschaft mit körperlicher Züchtigung, nachts schlafen beide auf dem nackten Boden. In den kommenden Jahren werden sie mehrfach weitergeschickt, an immer neue Orte. Armut, Hunger und Krankheit begleiten sie.
An das Gute glauben
Und doch ist "Zuckerkind" kein Buch der Klage. Denn wo immer Stella und ihre Mutter ein neues Ersatz-Zuhause finden, stoßen sie auch auf Hilfe, auf Unterstützung und auf Menschen, die ihnen Gutes wollen. Ein kirgisischer Bauer, dessen Familie 1922 selbst nur knapp der Großen Hungersnot entkommen war, nimmt sie bei sich auf. Durch Vermittlung eines alten Bekannten, den die Mutter unerwartet wieder trifft, findet diese Arbeit auf einer Zuckerrohrplantage. Dort wird Stella zum Zuckerkind – es ist der Spitzname, den ihr einer der kirgisischen Arbeiter verleiht.
"'Ak balá, kant balá.' ('Weißes Kind, Zuckerkind.') Er hob mich hoch, setzte mich vor sich, brachte mich bis zum Kontor, etwa vierzig Schritte weit, stellte mich auf den Boden und ritt zu den Jurten. ... Seitdem nannten mich die Kirgisen 'Kant Balá', Zuckerkind."
Ein unverbrüchlicher Glaube an das Gute noch in dunkelsten Zeiten trägt nicht nur Stella und ihre Mutter durch lange Jahre der Entbehrung. Es ist die ausdrückliche Botschaft, mit der auch "Zuckerkind" von der ersten bis zur letzten Seite an uns appelliert: sie besagt, dass jeder Mensch, so heißt es an einer Stelle, irgendwann die Wahl hat, entweder dem Guten oder dem Schlechten zu dienen.
Lehrstück über Widerstand und Gesinnung
Vor dem Hintergrund der russischen Geschichtsvergessenheit und einem Staat, in dem der Einzelne erneut nichts zählt, wundert dieser Impetus nicht: Ursprünglich als Jugendbuch konzipiert und 2014 veröffentlicht, ist "Zuckerkind" nun rezipierbar als ein Lehrstück der aufrechten Gesinnung für Erwachsene. Es übt einen in Resilienz – und hält ausgelöschte Erinnerungen an staatliches Unrecht fest.
Dennoch oder gerade deshalb liest man "Zuckerkind" mit gemischten Gefühlen: Zu deutlich legt sich über die Erinnerungen immer wieder ein erhobener Zeigefinger. In seinem Lichte ist die bittersüße Stimme des Kindes, das hier scheinbar zu uns spricht, nicht frei von irritierender, da allzu makelloser Moralität.
Olga Gromowa: "Zuckerkind. Von Stalin nach Kirgisien verbannt"
aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt
Aufbau Verlag, Berlin. 205 Seiten, 22 Euro.
aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt
Aufbau Verlag, Berlin. 205 Seiten, 22 Euro.