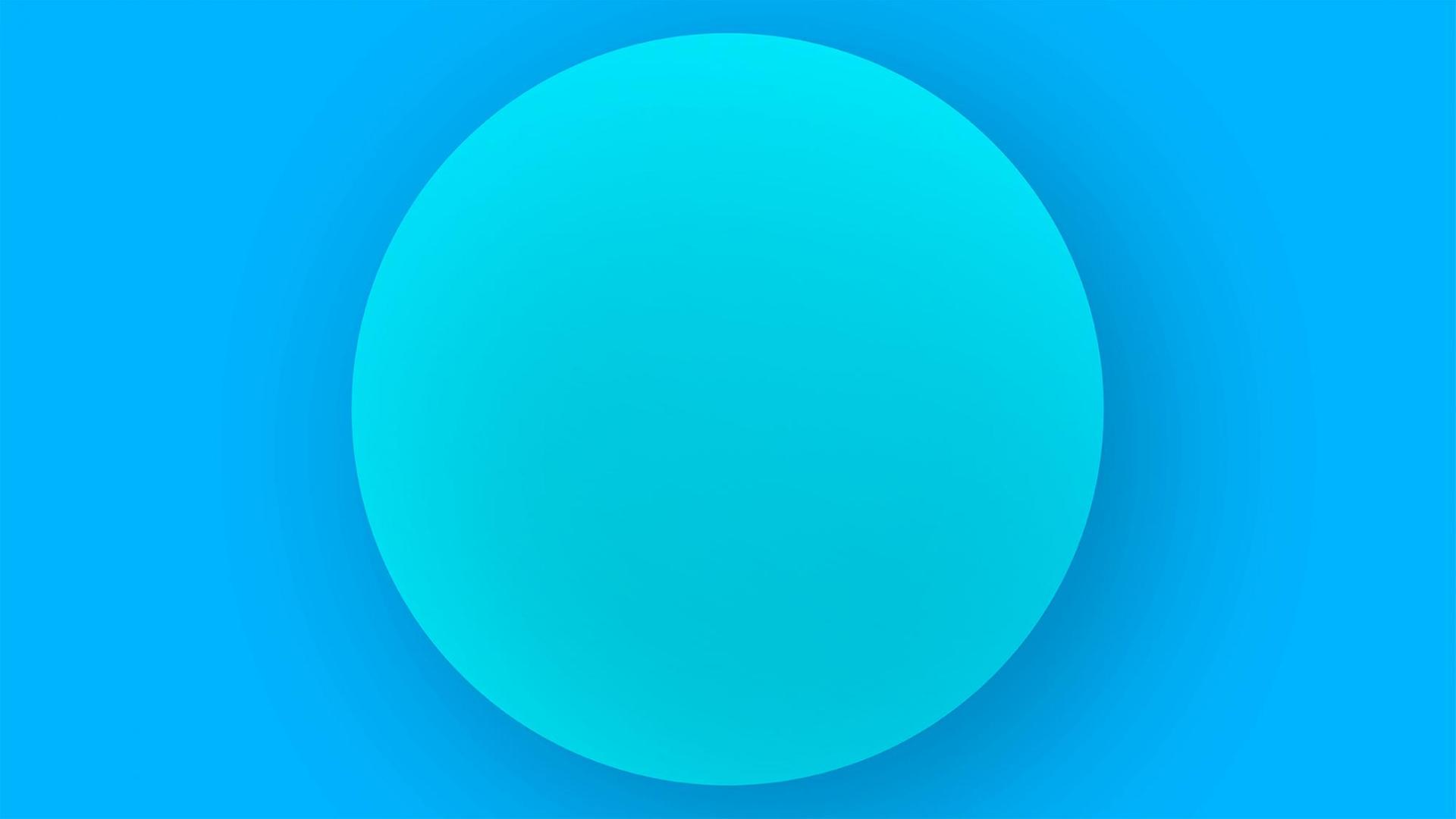Polen ist die sechstgrößte Volkswirtschaft in der Europäischen Union und gehört zu den 20 größten Volkswirtschaften der Welt. Beim nächsten G20-Gipfel wird das Land als Gast dabei sein und hofft darauf, in die Gruppe aufgenommen zu weren. Das Wachstum hält seit Jahrzehnten an und liegt weit über EU-Durchschnitt. Woran liegt das?
Wie entwickelt sich die polnische Wirtschaft?
Polens Wirtschaft wächst rasant. Im Jahr 2024 betrug das Wachstum 2,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Damit war es das sechstgrößte Wachstum der Europäischen Union. Zwischen 1991 und 2024 stieg es im Durchschnitt um vier Prozent an. Die Arbeitslosenquote ist mit 3,2 Prozent die zweitniedrigste in der EU. In Deutschland liegt sie bei 3,7, im EU-Durchschnitt bei 5,9 Prozent.
Mehr als die Hälfte der polnischen Unternehmen bietet Dienstleistungen an. Exportiert werden vor allem landwirtschaftliche Produkte, Maschinen, Fahrzeuge und Elektrogeräte.
Deutschland ist neben Frankreich der wichtigste Handelspartner in Europa. Für Deutschland ist Polen der fünftgrößte Handelspartner – hinter den USA, China, den Niederlanden und Frankreich.
Was sind die Gründe für Polens wirtschaftliches Wachstum?
Ein Grund für das Wachstum war lange Zeit das vergleichsweise niedrige Lohnniveau. Doch die Löhne sind mittlerweile stark gestiegen, seit 1995 um ein Dreifaches, deshalb kann man nicht mehr von einem Niedriglohnland sprechen.
Durch die höheren Löhne steigt allerdings auch der Binnenkonsum. Ein weiterer Grund für den Aufschwung ist die Arbeitsproduktivität, die seit 2010 um 40 Prozent gestiegen ist. In Deutschland waren es lediglich elf Prozent. Polen verfügt über viele gut ausgebildete Arbeitskräfte.
Das Land hat auch stark von der EU-Mitgliedschaft profitiert und gehört zu den größten Nettoempfängern von Fördergeldern. Im vergangenen Jahr erhielt Polen von der EU 2,9 Milliarden Euro mehr, als es abgeführt hat, damit am zweitmeisten nach Griechenland.
In den Jahren zuvor war Polen noch Spitzenreiter, 2023 bei 8,2 Milliarden, 2022 bei 11,9 Milliarden Euro. Seit dem EU-Beitritt 2004 erhielt es insgesamt rund 300 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur und Unternehmen.
In Polen gibt es ein ausgeprägtes Unternehmertum, das auch vom Staat gefördert wird. Laut einer Umfrage der Stiftung THINKI von 2024 wollen bis zu 67 Prozent der nach 1990 geborenen Polen ein eigenes Unternehmen gründen und auch Mitarbeitende einstellen. Laut einer Studie der Firma Ecorys Polska will diese Generation vor allem damit ihr Einkommen steigern und unabhängig sein, auch um die historischen Erfahrungen aus der Zeit des Sozialismus nicht zu wiederholen.
Eine Firma zu gründen, ist in Polen einfach und unbürokratisch, dazu braucht es nur ein paar Klicks. Das Arbeitsamt bezuschusst junge Unternehmer bei der Gründung mit bis zu 50.000 Złoty, das sind umgerechnet knapp 12.000 Euro. Die Zahl wächst stetig, im ersten Quartal 2025 gab es in Polen über 2,8 Millionen Unternehmen – das sind fünf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2024.
Außerdem gibt es Steuererleichterungen wie eine Körperschaftssteuer nach estnischem Vorbild. Diese wurde in Polen vor vier Jahren eingeführt. Ihr Hauptvorteil ist, dass sie nicht zum Zeitpunkt der Gewinnerzielung berechnet wird, sondern erst dann, wenn der Gewinn an die Gesellschafter ausgezahlt wird, beispielsweise in Form von Dividenden.
Im klassischen Modell müssen Unternehmen immer Steuern auf Gewinne zahlen, unabhängig davon, ob diese ausgezahlt oder im Unternehmen behalten werden.
Vor welchen Herausforderungen steht die polnische Wirtschaft?
In der polnischen Industrie werden zwar Stellen abgebaut, dafür arbeiten aber in den Dienstleistungsbranchen immer mehr Menschen. Polen leidet aber unter einem Fachkräftemangel, etwa im Handwerk und bei hochqualifizierten Berufen.
Laut dem Business Index des Arbeitgeberverbands Konfederacja Lewiatan haben zwei Drittel der polnischen Unternehmen Schwierigkeiten, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Ein Grund ist, dass sich das Bildungssystem nicht den Anforderungen der Wirtschaft anpasst. Zudem steigen durch die Erhöhung des Mindestlohns die Arbeitskosten. Dadurch müssen Unternehmen zum Teil die Zahl ihrer Beschäftigten verringern.
Ein weiteres Problem ist der demografische Wandel. Jahrelang zogen viele Polen zum Arbeiten ins Ausland. Seit 2018 aber wandern mehr Menschen nach Polen ein als wegziehen. Etwa 60 Prozent davon sind Polen, die aus dem Ausland zurückkehren.
Trotzdem schrumpft die Bevölkerung, in zehn Jahren um eine Million auf 37,4 Millionen Menschen. Einer Prognose zufolge soll sie bis 2035 um weitere 2,1 Millionen sinken. Das liegt auch an der Geburtenrate, die zu den geringsten der EU zählt.
Bekam eine Frau 1990 im Durchschnitt noch zwei Kinder, waren es 2024 nur rund 1,1 Kinder. In Deutschland sind es 1,4 Kinder. Die frühere PiS-Regierung versuchte, dem entgegenzuwirken, indem sie das Kindergeld erhöhte und künstliche Befruchtung finanzierte – doch diese Maßnahmen reichten nicht aus, um den Trend umzukehren.
Doch auch die amtierende Regierung unter Donald Tusk will den demografischen Wandel nicht durch mehr Zuwanderung ausgleichen. Die Migrationsstrategie lautet: "Kontrolle wiedergewinnen, Sicherheit garantieren", was u.a. bedeutet, den Zugang zum polnischen Arbeitsmarkt für Ausländer zu erschweren.
Die Konfederacja Lewiatan kritisiert, dass man sich in der Strategie mehr auf die Risiken als auf die wirtschaftlichen Vorteile der Migration konzentriert. Ohne Reformen der Migrationspolitik könne das Potenzial ausländischer Arbeitskräfte nicht ausgeschöpft werden und das sei ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung.
Auch die Forschungsstelle Migration der Universität Warschau kritisiert die Strategie, dass empirische Daten nicht einbezogen worden sind und Migration einseitig dargestellt wird.
Hohe Staatsverschuldung und Energiewende
In Polen wächst die Staatsverschuldung bis Jahresende voraussichtlich auf 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Laut Schätzungen könnte sie bis 2029 auf 75 Prozent ansteigen. Zum Vergleich: In Deutschland lag sie 2024 bei 62,5 Prozent. Der EU-Durchschnitt liegt bei 81,4 Prozent.
Grund dafür sind hohe Ausgaben bei der Infrastruktur, Digitalisierung und beim Militär. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wächst Polens Armee und ist mit über 216.000 Soldaten jetzt schon die größte in der EU (Deutschland hat nur 186.000) und die drittgrößte der NATO. Ziel sind 300.000 Soldaten bis zum Jahr 2035. Dadurch werden aber auch weitere Fachkräfte dem Arbeitsmarkt entzogen.
Außerdem rüstet das Land massiv auf. Die Militärausgaben lagen 2024 bei 4,2 Prozent des BIP, im Jahr 2025 sollen sie auf 4,7 Prozent steigen und sich damit dem NATO-Ziel von fünf Prozent annähern. Allerdings gibt es zugleich kaum Bestrebungen, die Staatseinnahmen durch Steuern zu erhöhen.
Zudem vollzieht Polen noch die Energiewende. Bei der Stromerzeugung ist das Land immer noch abhängig von der Kohleindustrie. Allerdings konnte Polen innerhalb eines Jahrzehnts den Anteil von Stein- und Braunkohle von 90 auf 60 Prozent senken.
In den nächsten 20 Jahren soll Atomenergie neben Gas und erneuerbaren Energien die Kohle ersetzen. Bislang hat aber Polen noch keine Atomkraftwerke. Der Bau des ersten Kernkraftwerks in Słajszewo in der Nähe von Danzig soll 2028 beginnen und zehn Jahre später fertiggestellt werden. Von 2032 an soll ein zweites errichtet werden.
Schneller kommt man mit den erneuerbaren Energien voran. Seit diesem Jahr entsteht vor Polens Küste der erste Offshore-Windpark. 2026 soll die 1,2 Gigawatt-Anlage ans Netz gehen und 1,5 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Es ist nur eins von insgesamt vier Projekten dieser Art.