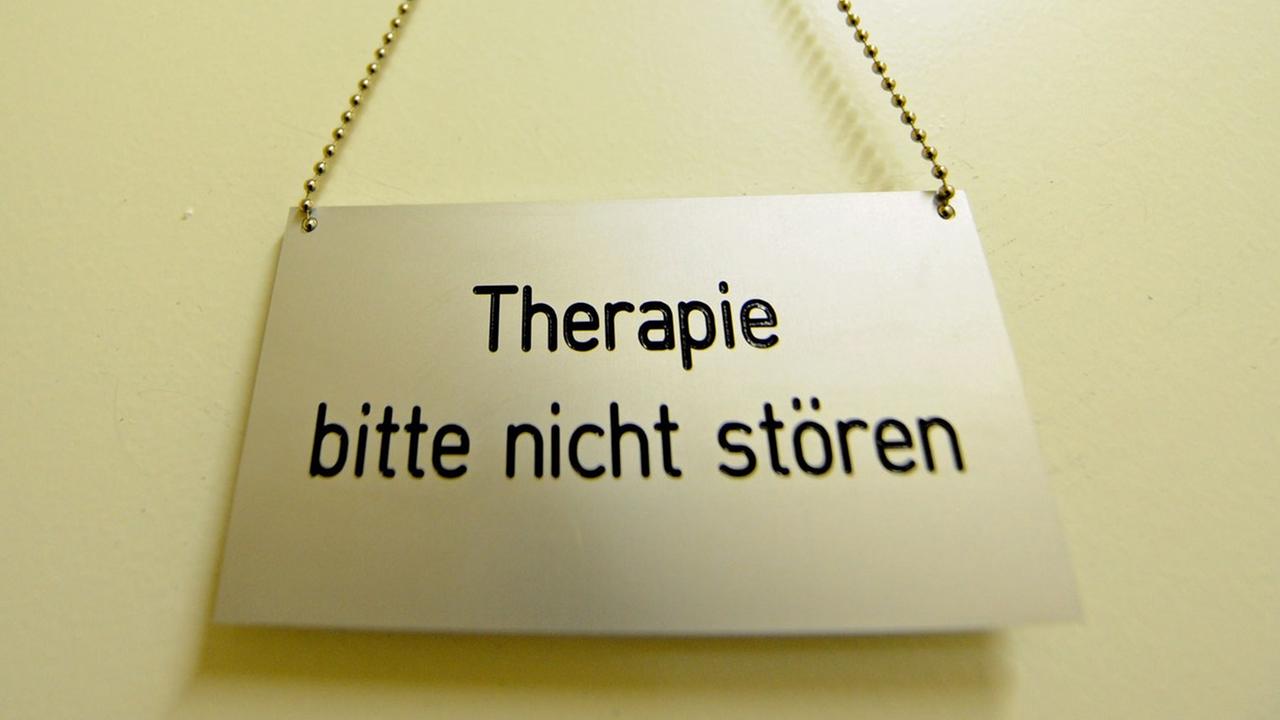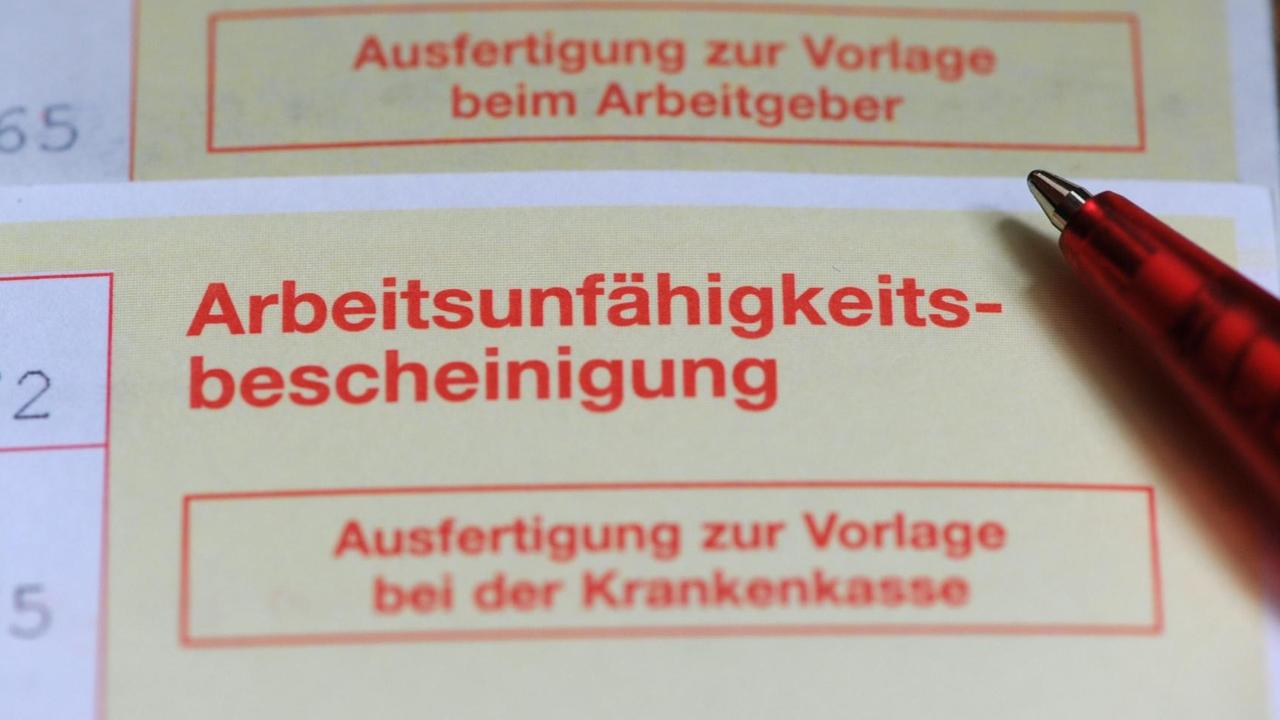Ein mehrstöckiges Wohnhaus mitten im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Jeden Tag machen sich Assistenzarzt Franz Kromp oder seine Kolleginnen und Kollegen auf den Weg vom nahegelegenen Urbankrankenhaus zur Wohnung eines Patienten. Dessen Mitbewohner öffnet die Tür.
"Hallo Herr G., Tachchen, Moin!"
Durch einen schmalen Gang, vorbei an angestaubten Bücherregalen, folgt Arzt Kromp dem Mitbewohner. Sein Patient – er soll hier nur Herr Z. heißen – kommt aus seinem Zimmer. Er ist 33 Jahre alt, hat dunkle, halblange Haare, trägt Jogginghose und Pulli. Wenn er nicht als Garten- und Landschaftsbauer arbeitet, malt er dreidimensional anmutende Bilder. Herr Z. wirkt aufmerksam, zurückhaltend, schüchtern, antwortet hastig auf die Fragen seines Arztes. Seit etwas mehr als zehn Jahren ist er in psychiatrischer Behandlung.
"In psychiatrischer Behandlung bin ich seit Ende 2008, Anfang 2009, seitdem bin ich in psychischer Behandlung. Ich hab eine hebephrene Schizophrenie und eine drogeninduzierte Psychose."
Durch einen schmalen Gang, vorbei an angestaubten Bücherregalen, folgt Arzt Kromp dem Mitbewohner. Sein Patient – er soll hier nur Herr Z. heißen – kommt aus seinem Zimmer. Er ist 33 Jahre alt, hat dunkle, halblange Haare, trägt Jogginghose und Pulli. Wenn er nicht als Garten- und Landschaftsbauer arbeitet, malt er dreidimensional anmutende Bilder. Herr Z. wirkt aufmerksam, zurückhaltend, schüchtern, antwortet hastig auf die Fragen seines Arztes. Seit etwas mehr als zehn Jahren ist er in psychiatrischer Behandlung.
"In psychiatrischer Behandlung bin ich seit Ende 2008, Anfang 2009, seitdem bin ich in psychischer Behandlung. Ich hab eine hebephrene Schizophrenie und eine drogeninduzierte Psychose."
Kontrollverlust "wie ein seelischer Sturm"
Menschen mit hebephrener Schizophrenie leiden häufig an Antriebsstörungen und Interessenverlust, was es ihnen mitunter schwer macht, ihren Alltag zu bewältigen. Im Umgang mit anderen reagieren sie oft unpassend, zum Beispiel albern in ernsten Situationen oder schlicht desinteressiert. Nicht nur das Denken, auch ihre Fähigkeit zu sprechen ist oft gestört.
"Aber es ist von der Idee her wie ein innerer Kontrollverlust, dass Sachen innerlich von alleine passieren - Gedanken, Gefühle, Emotionen - und man halt keine Möglichkeit hat, was dran zu ändern. Wie ein seelischer Sturm, kann man sagen."
Den letzten Kontrollverlust erlebte Herr Z. vor einigen Wochen. Bislang wurde er fast immer stationär behandelt. Seit Neuestem finden seine Patientengespräche aber nicht mehr in der Klinik statt, sondern an seinem Wohnzimmertisch. Herr Z. erzählt, dass er wieder mit dem Joggen beginnen möchte. Kromp fragt nach den Medikamenten, wie es mit dem Mitbewohner laufe und wann er sich wieder zutraue, arbeiten zu gehen.
Den letzten Kontrollverlust erlebte Herr Z. vor einigen Wochen. Bislang wurde er fast immer stationär behandelt. Seit Neuestem finden seine Patientengespräche aber nicht mehr in der Klinik statt, sondern an seinem Wohnzimmertisch. Herr Z. erzählt, dass er wieder mit dem Joggen beginnen möchte. Kromp fragt nach den Medikamenten, wie es mit dem Mitbewohner laufe und wann er sich wieder zutraue, arbeiten zu gehen.
Neues Programm für die Zuhause-Behandlung
Herr Z. ist einer von acht Patientinnen und Patienten in einem neuen Programm am Kreuzberger Klinikum Am Urban. Es heißt Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung, kurz StäB. Seit Anfang vergangenen Jahres dürfen Krankenhäuser es ihren Patientinnen und Patienten anbieten. Voraussetzung ist unter anderem, dass sie so schwer krank sind, dass sie, gäbe es die StäB nicht, im Krankenhaus behandelt werden müssten. Außerdem dürfen sie für sich und ihr Umfeld zuhause keine Gefahr darstellen.
Assistenzarzt Franz Kromp ist dabei, seit die Kreuzberger Klinik die Zuhause-Behandlung im Sommer vergangenen Jahres eingeführt hat. Zwar versuche man auch auf Station, die Lebensrealität der Patienten außerhalb der Klinik mit einzubeziehen, sagt Kromp. Die Stationsäquivalente Behandlung biete aber die Möglichkeit,
"dass wir viel näher dran sind am privaten Umfeld, an den Angehörigen und so, und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, dass wir diese ganzen Dynamiken, die zuhause stattfinden, oder auch einfach das Umfeld, in dem die Störungen entsteht oder die die Störung auch aufrechterhält, das wird halt viel schneller deutlich als auf Station."
Assistenzarzt Franz Kromp ist dabei, seit die Kreuzberger Klinik die Zuhause-Behandlung im Sommer vergangenen Jahres eingeführt hat. Zwar versuche man auch auf Station, die Lebensrealität der Patienten außerhalb der Klinik mit einzubeziehen, sagt Kromp. Die Stationsäquivalente Behandlung biete aber die Möglichkeit,
"dass wir viel näher dran sind am privaten Umfeld, an den Angehörigen und so, und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, dass wir diese ganzen Dynamiken, die zuhause stattfinden, oder auch einfach das Umfeld, in dem die Störungen entsteht oder die die Störung auch aufrechterhält, das wird halt viel schneller deutlich als auf Station."
Idealerweise arbeiten bei der Stationsäquivalenten Behandlung alle zusammen: Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, aber auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die während einer Krise zum Beispiel den Kontakt zum Jobcenter halten. Auch die Angehörigen sollen miteinbezogen werden. Oder wie im Fall von Herrn Z. der Mitbewohner. Der ruft schon mal in der Klinik an, wenn er sich Sorgen um Herrn Z. macht.

Betroffene zufriedener, Angehörige weniger belastet
Oberarzt Stefan Weinmann leitet das StäB-Team im Urbankrankenhaus. Er hat an der Leitlinie zur psychosozialen Therapie bei schweren psychischen Erkrankungen federführend mitgearbeitet. Das Dokument wird von der größten Psychiatrie-Fachgesellschaft in Deutschland herausgegeben, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, kurz DGPPN. Nicht nur die Leitlinie empfiehlt ausdrücklich die Zuhause-Behandlung von schwer psychisch erkrankten Menschen. Auch die UN-Behindertenrechtskonvention fordert das.
"Dass jeder Patient das Recht hat und die Möglichkeit haben sollte, auch in schweren psychischen Krisen auch zuhause behandelt werden zu können durch ein multiprofessionelles Team. Dass also die Leistung, die im Krankenhaus im Moment nur möglich ist, auch zuhause in gleicher Intensität angeboten wird."
Studien zufolge sinkt durch die Zuhause-Behandlung die Belastung für Angehörige. Die Patientinnen und Patienten sind häufig zufriedener mit der Behandlung und brechen die Therapie seltener ab. Auch auf die Krankenhäuser könnte das Auswirkungen haben. Langfristig sind, so die Studien, Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen dank der Zuhause-Behandlung seltener und weniger lang auf Station. Die Zuhause-Behandlung könnte so langfristig in den Krankenhäusern Betten sparen. Patientinnen und Patienten könnten obendrein das Stigma umgehen, das heute immer noch für viele mit einem Psychiatrieaufenthalt verbunden ist. Stefan Weinmann:
"Aber die Umsetzung in Deutschland ist suboptimal. Man hat jetzt irgendwann die Entscheidung getroffen, wir müssen das ins Gesetz machen. Und hat ein relativ rigides Modell aufgestellt, nachdem der Patient jeden Tag besucht werden muss."
"Dass jeder Patient das Recht hat und die Möglichkeit haben sollte, auch in schweren psychischen Krisen auch zuhause behandelt werden zu können durch ein multiprofessionelles Team. Dass also die Leistung, die im Krankenhaus im Moment nur möglich ist, auch zuhause in gleicher Intensität angeboten wird."
Studien zufolge sinkt durch die Zuhause-Behandlung die Belastung für Angehörige. Die Patientinnen und Patienten sind häufig zufriedener mit der Behandlung und brechen die Therapie seltener ab. Auch auf die Krankenhäuser könnte das Auswirkungen haben. Langfristig sind, so die Studien, Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen dank der Zuhause-Behandlung seltener und weniger lang auf Station. Die Zuhause-Behandlung könnte so langfristig in den Krankenhäusern Betten sparen. Patientinnen und Patienten könnten obendrein das Stigma umgehen, das heute immer noch für viele mit einem Psychiatrieaufenthalt verbunden ist. Stefan Weinmann:
"Aber die Umsetzung in Deutschland ist suboptimal. Man hat jetzt irgendwann die Entscheidung getroffen, wir müssen das ins Gesetz machen. Und hat ein relativ rigides Modell aufgestellt, nachdem der Patient jeden Tag besucht werden muss."
Deutsches Modell zu starr
Aus medizinischer Sicht wäre es sinnvoller gewesen, den Teams aus Pflegerinnen, Ärztinnen und Sozialarbeiterinnen mehr Spielraum zu lassen, um auf den jeweiligen Bedarf des Patienten einzugehen, sagt Weinmann. Vor allem am Ende der Therapie bestehe die Gefahr, dass die Betroffenen nach drei Wochen intensiven Kontakts in ein Loch fallen, wenn sie im Anschluss lange darauf warten müssen, einen Termin bei einem niedergelassenen Psychiater oder Psychotherapeuten zu bekommen. Tritt in dieser Zeit eine Krise auf, landen sie schnell wieder im Krankenhaus.
Deutschland solle sich ein Beispiel etwa an England und den Niederlanden nehmen, sagt Weinmann. Das sogenannte Home Treatment sei dort bereits gang und gäbe.
"Die internationale Evidenz ist unstrittig, aber dieses spezielle deutsche Modell mit seiner Starre ist eigentlich noch nicht evidenzbasiert."
Darüber, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland behandelt werden, entscheiden viele Akteure mit ganz unterschiedlichen Interessen. Das Bundesgesundheitsministerium gibt in der Regel die Rahmenbedingungen vor. Über die konkrete Ausgestaltung entscheidet dann die sogenannte Selbstverwaltung im Gesundheitswesen in oft zähen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Je nach Thema sitzen die Leistungserbringer – also niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten und Krankenhäuser – und die Krankenkassen am Tisch. Gerade in der Psychiatrie haben die Krankenhäuser unter den Leistungserbringern großen Einfluss auf die Entscheidungen über die Versorgung. Denn der Großteil der psychiatrischen Behandlungen findet auf Krankenhausstationen statt.
Deutschland solle sich ein Beispiel etwa an England und den Niederlanden nehmen, sagt Weinmann. Das sogenannte Home Treatment sei dort bereits gang und gäbe.
"Die internationale Evidenz ist unstrittig, aber dieses spezielle deutsche Modell mit seiner Starre ist eigentlich noch nicht evidenzbasiert."
Darüber, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland behandelt werden, entscheiden viele Akteure mit ganz unterschiedlichen Interessen. Das Bundesgesundheitsministerium gibt in der Regel die Rahmenbedingungen vor. Über die konkrete Ausgestaltung entscheidet dann die sogenannte Selbstverwaltung im Gesundheitswesen in oft zähen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Je nach Thema sitzen die Leistungserbringer – also niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten und Krankenhäuser – und die Krankenkassen am Tisch. Gerade in der Psychiatrie haben die Krankenhäuser unter den Leistungserbringern großen Einfluss auf die Entscheidungen über die Versorgung. Denn der Großteil der psychiatrischen Behandlungen findet auf Krankenhausstationen statt.
Verantwortung für rigide Ausgestaltung wird hin- und hergeschoben
Gerald Gaß ist Geschäftsführer des Landeskrankenhauses im rheinland-pfälzischen Andernach, einem Klinikbetrieb mit rund 2.200 Betten an 17 Standorten, an denen psychisch Kranke versorgt werden. Gaß ist außerdem Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG, der Vertretung der Krankenhäuser in der Selbstverwaltung. Die DKG hat die Details zur Stationsäquivalenten Behandlung mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ausgehandelt.
"Dass jetzt die Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine Vereinbarung getroffen haben, die an manchen Stellen relativ strikt bestimmte Bedingungen formuliert, wie zum Beispiel, dass auf jeden Fall jeden Tag ein Kontakt stattfinden muss, resultiert ein Stück weit leider auch aus dem Misstrauen im deutschen Gesundheitswesen. Das heißt, die Krankenkassen haben vielfach den Verdacht, wenn sie jetzt eine solche Behandlung zulassen, dass die Krankenhäuser möglicherweise nicht intensiv genug sich um die Behandlung kümmern und dann Geld verdienen, was ihnen vielleicht gar nicht zusteht."
"Dass jetzt die Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine Vereinbarung getroffen haben, die an manchen Stellen relativ strikt bestimmte Bedingungen formuliert, wie zum Beispiel, dass auf jeden Fall jeden Tag ein Kontakt stattfinden muss, resultiert ein Stück weit leider auch aus dem Misstrauen im deutschen Gesundheitswesen. Das heißt, die Krankenkassen haben vielfach den Verdacht, wenn sie jetzt eine solche Behandlung zulassen, dass die Krankenhäuser möglicherweise nicht intensiv genug sich um die Behandlung kümmern und dann Geld verdienen, was ihnen vielleicht gar nicht zusteht."
Mechtild Schmedders arbeitet als Referatsleiterin für Qualitätssicherung im Krankenhaus beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie hat die Vereinbarung mit der DKG im Auftrag der Krankenkassen federführend ausgehandelt. Den Vorwurf, dass die Krankenkassen für die rigide Ausgestaltung der Zuhause-Behandlung verantwortlich seien, weist sie von sich.
"Es sind nicht wir, die Selbstverwaltungspartner, die das so eng gestaltet haben, sondern der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber hat ganz klar verankert, es handelt sich um die Krankenhausbehandlung zuhause. Krankenhausbehandlung heißt: Sie haben jeden Tag Arzt- oder andere Berufsgruppen-Patienten-Kontakte. Jeden Tag."

BMG: Täglicher Arzt-Patienten-Kontakt notwendig
Der Bundestag hatte die Stationsäquivalente Behandlung bereits in der vergangenen Legislaturperiode beschlossen. "Mit Nachdruck" wolle auch die jetzige Koalition stationsersetzende Leistungen einführen, heißt es im aktuellen Koalitionsvertrag. Ein Interview dazu lehnt das Bundesgesundheitsministerium allerdings ab. Per E-Mail teilt eine Mitarbeiterin jedoch mit, dass sich das Gesetz am Bedarf der Patientinnen und Patienten orientiere. Wer für die Stationsäquivalente Behandlung infrage komme, brauche nun mal die Behandlungsintensität eines Krankenhauses – also auch täglichen Kontakt zu Ärztinnen oder Ärzten.
Tatsächlich lässt das Gesetz über die Stationsäquivalente Behandlung auch bei Ärztinnen und Ärzten noch zahlreiche Fragen offen. Wenn die Behandlung zuhause der im Krankenhaus entsprechen soll, müssen dann in der Wohnung des Patienten so strenge Hygienevorschriften gelten wie auf einer Station? Und was ist mit den strikten Brandschutzbestimmungen im Krankenhaus? Die Vertreterin der gesetzlichen Krankenkassen, Mechtild Schmedders, sieht hier, vorsichtig gesagt, einen Konstruktionsfehler.
"Krankenhausbehandlung zuhause - also das ist ja quasi denklogisch schon kaum nachzuvollziehen. Man hätte aber diese Patienten auch genauso durch einen Ausbau der Institutsambulanzen versorgen können."
Psychiatrische Institutsambulanzen gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Sie versorgen Menschen ambulant im Krankenhaus, teilweise machen Klinikärzte auch Hausbesuche. Diese Einrichtungen sollen bereits heute Schnittstelle zwischen dem Krankenhaus und einem niedergelassenen Psychiater oder Psychotherapeuten sein.
"Krankenhausbehandlung zuhause - also das ist ja quasi denklogisch schon kaum nachzuvollziehen. Man hätte aber diese Patienten auch genauso durch einen Ausbau der Institutsambulanzen versorgen können."
Psychiatrische Institutsambulanzen gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Sie versorgen Menschen ambulant im Krankenhaus, teilweise machen Klinikärzte auch Hausbesuche. Diese Einrichtungen sollen bereits heute Schnittstelle zwischen dem Krankenhaus und einem niedergelassenen Psychiater oder Psychotherapeuten sein.
Ergebnisse der Modellvorhaben nicht abgewartet
Alternativ, sagt Schmedders, hätte man auch abwarten können, was bei den zahlreichen Modellvorhaben, die es in mehreren deutschen Kliniken gibt, herauskommt. Dabei werden zum Beispiel flexiblere Modelle erprobt, mit denen psychisch kranke Menschen zuhause behandelt werden können. Diese Modelle werden noch evaluiert. Vorläufige Ergebnisse sollen erst in diesem Jahr vorgelegt werden, doch im Gesundheitsministerium wollte man das nicht abwarten.
Einen aktuellen Überblick zur Umsetzung der Stationsäquivalenten Behandlung in Deutschland habe das Ministerium nicht, schreibt eine Mitarbeiterin des Bundesgesundheitsministeriums per E-Mail. Auf Nachfrage verteidigt sie allerdings deren zügige Einführung.
Einen aktuellen Überblick zur Umsetzung der Stationsäquivalenten Behandlung in Deutschland habe das Ministerium nicht, schreibt eine Mitarbeiterin des Bundesgesundheitsministeriums per E-Mail. Auf Nachfrage verteidigt sie allerdings deren zügige Einführung.
"Ziel war es, dass den Betroffenen die Vorteile dieser besonderen Behandlungsform möglichst frühzeitig zugute kommen sollten."
Zur Frage, warum nicht bestehende Angebote wie zum Beispiel die Institutsambulanzen ausgebaut wurden, heißt es:
"Aufsuchende Behandlung wird zwar auch von Psychiatrischen Institutsambulanzen erbracht, sie entspricht aber hinsichtlich der Behandlungsintensität nicht einer vollstationären Behandlung."
Zur Frage, warum nicht bestehende Angebote wie zum Beispiel die Institutsambulanzen ausgebaut wurden, heißt es:
"Aufsuchende Behandlung wird zwar auch von Psychiatrischen Institutsambulanzen erbracht, sie entspricht aber hinsichtlich der Behandlungsintensität nicht einer vollstationären Behandlung."
StäB - ein Beispiel für erfolgreiches Lobbying?
Dass die Krankenhäuser deshalb eine neue Versorgungsform anbieten sollen, erschließt sich Mechtild Schmedders vom GKV-Spitzenverband nicht. Sie hat eine andere Erklärung für die hastige Einführung der Stationsäquivalenten Behandlung.
"Ich glaube, es gab einige Leistungserbringer, die einen zu guten Zugang zu den Politikern in der letzten Legislaturperiode hatten, die auf diesem Wege versucht haben, möglichst schnell weitere Angebote zu schaffen und dann auch in dieser Weise als Krankenhausbehandlung. Anders als bei den Institutsambulanzen, wo die Kassenärztlichen Vereinigungen und damit die Vertretung der niedergelassenen Ärzte vor Ort noch ein Mitspracherecht haben, hat dieses Konstrukt dafür gesorgt, die draußenvorzuhalten."
"Ich glaube, es gab einige Leistungserbringer, die einen zu guten Zugang zu den Politikern in der letzten Legislaturperiode hatten, die auf diesem Wege versucht haben, möglichst schnell weitere Angebote zu schaffen und dann auch in dieser Weise als Krankenhausbehandlung. Anders als bei den Institutsambulanzen, wo die Kassenärztlichen Vereinigungen und damit die Vertretung der niedergelassenen Ärzte vor Ort noch ein Mitspracherecht haben, hat dieses Konstrukt dafür gesorgt, die draußenvorzuhalten."
Tatsächlich hatte die Deutsche Krankenhausgesellschaft in einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf explizit gefordert, dass die niedergelassenen Ärzte kein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung der Stationsäquivalenten Behandlung haben sollten. Die Einführung des neuen Therapieangebots habe sich für die Krankenhäuser noch an anderer Stelle gelohnt, sagt Schmedders. Kassen und Kliniken handeln regelmäßig aus, wie viel Beitragsgeld die Kliniken für die Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten erhalten. Schmedders glaubt:
"Ein weiterer Punkt ist sicherlich, dass damit dieses Leistungsangebot zum stationären Budget gehört und die Krankenhäuser verhandeln mit den Krankenkassen das Budget und haben damit quasi eine weitere Variable, mit der sie das Budget ausgestalten können. Also man kann auch sagen, das ist eine Art Budgetjoker."
Die stationsäquivalente Behandlung als zusätzliche Verhandlungsmasse für die Krankenhäuser? Im Klinikbetrieb scheint das Modell bislang keine große Nachfrage auszulösen. Nur eine niedrige zweistellige Zahl an Krankenhäusern hat das Angebot laut Deutscher Krankenhausgesellschaft bislang eingeführt.
Die stationsäquivalente Behandlung als zusätzliche Verhandlungsmasse für die Krankenhäuser? Im Klinikbetrieb scheint das Modell bislang keine große Nachfrage auszulösen. Nur eine niedrige zweistellige Zahl an Krankenhäusern hat das Angebot laut Deutscher Krankenhausgesellschaft bislang eingeführt.
Die StäB lohnt sich für die Krankenhäuser bislang nicht
Auch im Andernacher Landeskrankenhaus von DKG-Präsident Gerald Gaß gibt es das Modell noch nicht. Grundsätzlich seien die Krankenhäuser interessiert, sagt Gaß. Aber der Tagessatz stimme nicht. 200 Euro hatten DKG und GKV-Spitzenverband auf Bundesebene ausgehandelt.
"Insofern haben wir auch den Aspekt, dass die Höhe des Entgelts, das im Moment festgelegt ist, keinesfalls die tatsächlichen Aufwendungen der Krankenhäuser refinanzieren kann."
Das bedeutet konkret: Jedes Krankenhaus, das die StäB einführen will, verhandelt mit den regionalen Krankenkassen nach. Das dauert.
"Aufgrund der vergleichsweise kleinen Zahl von Krankenhäusern, die bisher in die Lage versetzt worden sind und dann auch sich bereit sahen, diese Stationsäquivalente Behandlung durchzuführen, muss man sagen, wenn man das bundesweit betrachtet, hat sich für die psychisch kranken Menschen in Deutschland noch nichts Grundlegendes verändert."
Im Bundesgesundheitsministerium sieht man die Lage nicht so dramatisch. Es käme ohnehin nur eine begrenzte Zahl an Krankenhäusern infrage. Und für die Umsetzung brauche es eine Anlaufphase, so eine Ministeriums-Mitarbeiterin.
"Daher ist davon auszugehen, dass die Zahl der Krankenhäuser, die Stationsäquivalente Leistungen erbringen, noch weiter zunehmen wird."
"Insofern haben wir auch den Aspekt, dass die Höhe des Entgelts, das im Moment festgelegt ist, keinesfalls die tatsächlichen Aufwendungen der Krankenhäuser refinanzieren kann."
Das bedeutet konkret: Jedes Krankenhaus, das die StäB einführen will, verhandelt mit den regionalen Krankenkassen nach. Das dauert.
"Aufgrund der vergleichsweise kleinen Zahl von Krankenhäusern, die bisher in die Lage versetzt worden sind und dann auch sich bereit sahen, diese Stationsäquivalente Behandlung durchzuführen, muss man sagen, wenn man das bundesweit betrachtet, hat sich für die psychisch kranken Menschen in Deutschland noch nichts Grundlegendes verändert."
Im Bundesgesundheitsministerium sieht man die Lage nicht so dramatisch. Es käme ohnehin nur eine begrenzte Zahl an Krankenhäusern infrage. Und für die Umsetzung brauche es eine Anlaufphase, so eine Ministeriums-Mitarbeiterin.
"Daher ist davon auszugehen, dass die Zahl der Krankenhäuser, die Stationsäquivalente Leistungen erbringen, noch weiter zunehmen wird."
Der Behandlungsbedarf und nicht das Budget sollten entscheiden
Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, ist eine von vielen, die mehr von der Stationsäquivalenten Behandlung erwartet hätten.
"Das ist eher so ein hilfloser Versuch gewesen, mal so einen kleinen, kleinen Ansatzpunkt zu finden, sektorübergreifend tätig werden zu können, und wir müssen das viel größer und grundsätzlicher denken."
"Das ist eher so ein hilfloser Versuch gewesen, mal so einen kleinen, kleinen Ansatzpunkt zu finden, sektorübergreifend tätig werden zu können, und wir müssen das viel größer und grundsätzlicher denken."
Größer und grundsätzlicher heißt in diesem Fall nicht nur, dass die Unterstützungsangebote für Patientinnen und Patienten besser aufeinander abgestimmt werden sollten. Klein-Schmeink greift eine Forderung der Sozialpsychiatrie auf, die seit Jahrzehnten eine Neuorientierung des psychiatrischen Hilfsangebots fordert.
"Da sollte es einfach ein von der Person und vom persönlichen Bedarf aus gesehene Kriterien geben und nicht strikte, die mehr damit zu tun haben: Wie kann jetzt wieder eine Krankenkasse klar abrechnen? Ist das jetzt wie ein stationäres Entgelt zu behandeln oder ist es jetzt mehr wie ein ambulantes Entgelt zu behandeln?"
Dieses Problem habe man auch bei den Krankenhäusern erkannt, sagt DKG-Präsident Gerald Gaß.
"Also, das Denken vom Patienten aus betrachtet und für die Patientinnen und Patienten, das ist leider noch nicht so ausgeprägt, sondern man denkt da eher noch in den Schranken seines Versorgungssektors und in den Grenzen der finanziellen Budgets, die existieren."
Für Grünen-Politikerin Klein-Schmeink leitet sich aus dem Umgang mit der Stationsäquivalenten Behandlung allerdings eine Forderung ab, die die Mitglieder der Selbstverwaltung wohl nicht ohne Weiteres unterschreiben würden. Sie will die Budgets von niedergelassenen und stationären Leistungsanbietern in einen Topf werfen.
"Dass wir wegkommen von diesen zentralistisch beschlossenen Richtlinien und so weiter, sondern dass wir da mehr Rahmensetzung machen und ermöglichen, von guter Versorgung vor Ort, die dann vor Ort gestaltet wird, koordiniert wird zwischen den Trägern der verschiedenen Leistungsanbieter und aber auch den Kommunen."
Der Anspruch der Stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung sollte genau das sein: Über die Grenzen des stationären Sektors hinaus in die Lebensrealität der Patientinnen und Patienten zu wirken. Ist die Zuhause-Behandlung dann letztlich ein Rückschritt, weil sie die Grenzen zwischen stationärem und ambulanten Sektor zementiert? Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink:
"Ich glaube nicht, weil es eröffnet die Möglichkeit, dass in den Stationen gelernt wird, mit solchen Methoden umzugehen, solche Verfahren überhaupt anzuwenden."
"Da sollte es einfach ein von der Person und vom persönlichen Bedarf aus gesehene Kriterien geben und nicht strikte, die mehr damit zu tun haben: Wie kann jetzt wieder eine Krankenkasse klar abrechnen? Ist das jetzt wie ein stationäres Entgelt zu behandeln oder ist es jetzt mehr wie ein ambulantes Entgelt zu behandeln?"
Dieses Problem habe man auch bei den Krankenhäusern erkannt, sagt DKG-Präsident Gerald Gaß.
"Also, das Denken vom Patienten aus betrachtet und für die Patientinnen und Patienten, das ist leider noch nicht so ausgeprägt, sondern man denkt da eher noch in den Schranken seines Versorgungssektors und in den Grenzen der finanziellen Budgets, die existieren."
Für Grünen-Politikerin Klein-Schmeink leitet sich aus dem Umgang mit der Stationsäquivalenten Behandlung allerdings eine Forderung ab, die die Mitglieder der Selbstverwaltung wohl nicht ohne Weiteres unterschreiben würden. Sie will die Budgets von niedergelassenen und stationären Leistungsanbietern in einen Topf werfen.
"Dass wir wegkommen von diesen zentralistisch beschlossenen Richtlinien und so weiter, sondern dass wir da mehr Rahmensetzung machen und ermöglichen, von guter Versorgung vor Ort, die dann vor Ort gestaltet wird, koordiniert wird zwischen den Trägern der verschiedenen Leistungsanbieter und aber auch den Kommunen."
Der Anspruch der Stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung sollte genau das sein: Über die Grenzen des stationären Sektors hinaus in die Lebensrealität der Patientinnen und Patienten zu wirken. Ist die Zuhause-Behandlung dann letztlich ein Rückschritt, weil sie die Grenzen zwischen stationärem und ambulanten Sektor zementiert? Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink:
"Ich glaube nicht, weil es eröffnet die Möglichkeit, dass in den Stationen gelernt wird, mit solchen Methoden umzugehen, solche Verfahren überhaupt anzuwenden."
Bis zum Ende des Jahres 2021 müssen Krankenkassen und Krankenhäuser dem Bundesgesundheitsministerium einen Bericht darüber vorlegen, welche Auswirkungen die Stationsäquivalente Behandlung auf die Patientinnen und Patienten und auf die Finanzen hat. Bis dahin dürfte die aktuelle Regelung allerdings dafür sorgen, dass viele Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen weiterhin im Krankenhaus anstatt zuhause behandelt werden – selbst wenn Ärztinnen und Ärzte das in vielen Fällen nicht für nötig halten.