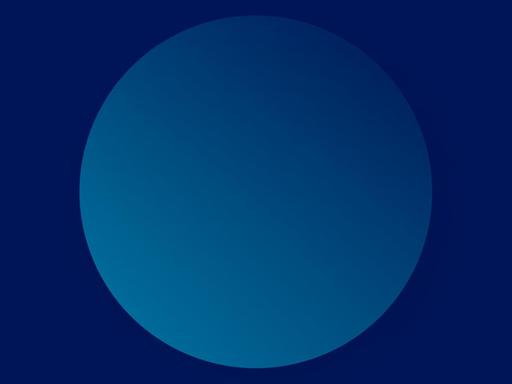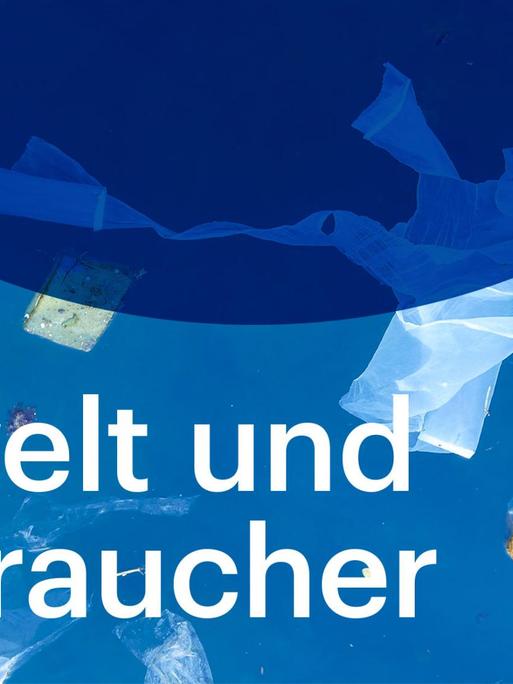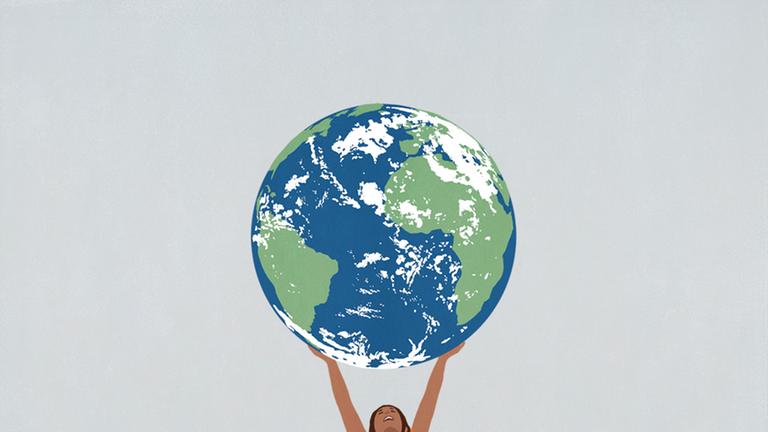Tabak schadet nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Umwelt. Jedes Jahr landen rund 4,5 Billionen Zigarettenstummel – etwa 90 Prozent aller konsumierten Zigaretten – achtlos in Parks, auf Straßen, in Gullis, an Seeufern oder in Flüssen. Sie gehören damit zu den häufigsten Abfällen weltweit. Und nicht nur klassische Zigaretten, auch Einweg-E-Zigaretten entwickeln sich zu einem wachsenden Umweltproblem.
Folgen von Zigaretten und E-Zigaretten für die Umwelt
Wie sehr Zigaretten der Umwelt schaden, zeigen mittlerweile viele Studien. Das beginnt bereits bei den Zigarettenfiltern. Sie bestehen aus Plastik und zerfallen über Jahre hinweg zu Mikroplastikpartikeln, erklärt Sonja von Eichborn von der Nichtregierungsorganisation Unfairtobacco.
Gleichzeitig wirken die Filter wie ein Magnet für Schadstoffe. Beim Rauchen reichert sich darin eine Giftmischung aus Nikotin, Arsen, Blausäure und Schwermetallen wie Blei oder Chrom an.
„Wenn es dann regnet, gelangen die Schadstoffe durch das Regenwasser bis ins Grundwasser und können auch das Trinkwasser schädigen”, sagt Janine Korduan vom BUND.
Nikotin löst sich extrem schnell in Wasser. Schon eine halbe Stunde Regen genügt, um etwa die Hälfte des Nervengifts aus einem Zigarettenstummel auszuwaschen. Die freigesetzten Stoffe wirken nicht nur für Menschen krebserregend – sie vergiften auch Fische, Vögel und andere Lebewesen. Bereits ein einziger Stummel kann bis zu 1000 Liter Wasser stark mit Nikotin belasten.
Die Schadstoffe lösen außerdem ökologische Kettenreaktionen aus. Eine Studie des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie zeigt zum Beispiel, dass die ausgewaschenen Substanzen Chytrid-Pilze schädigen – Mikroorganismen, die normalerweise das Wachstum von Cyanobakterien (Blaualgen) aufhalten. Werden diese Pilze beeinträchtigt, können sich die giftigen Blaualgen ungehindert ausbreiten.
Noch gravierender ist nach Einschätzung von Eichborn die Umweltbilanz bei Einweg-E-Zigaretten. Sie enthalten Elektronik und fest verbaute Lithium-Ionen-Akkus, die eigentlich wiederaufladbar wären, aber nach einmaligem Gebrauch im Hausmüll oder direkt in der Umwelt landen. Beschädigte oder alte Akkus können Giftstoffe freisetzen und lösen immer wieder Brände in Müllwagen oder auf Deponien aus.
Ökologische Schäden durch Tabakanbau und industrielle Produktion
Die Umweltbelastung durch Tabak beginnt lange bevor eine Zigarette angezündet wird. Der Tabak wächst laut Unfairtobacco fast immer in Monokulturen. Auf den Feldern sollen dabei hochgiftige Pestizide und Herbizide zum Einsatz kommen, darunter Chlorpikrin und 1,3-Dichlorpropen, beide in der EU seit über zehn Jahren verboten, sowie das umstrittene Glyphosat. Was auf die Pflanzen gesprüht wird, landet über Regen und Bewässerung in der Erde und in den Wasserläufen der Anbauregionen und damit im Grundwasser, auf das dort viele Menschen angewiesen sind.
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden rund 3,5 Millionen Hektar Land jedes Jahr für den Tabakanbau zerstört. Der Anbau trägt damit erheblich zur Abholzung bei, besonders in Ländern des globalen Südens. Die Rodung für Tabakplantagen führt zu Bodendegradation und zu sinkenden Erträgen – also dazu, dass der Boden zunehmend seine Fähigkeit verliert, andere Pflanzen oder Nutzkulturen zu tragen. Das heizt wiederum das Klima an. Der Konsum und die Produktion von Tabak stoßen jährlich rund 84 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre aus.
Für die weltweite Tabakproduktion werden nach Angaben der WHO außerdem jedes Jahr rund 22 Milliarden Tonnen Wasser verbraucht – so viel wie 15 Millionen olympische Schwimmbecken. Tabakpflanzen sind extrem wasserintensiv: Sie benötigen bis zu achtmal mehr Wasser als Tomaten oder Kartoffeln. Rechnet man es herunter, bedeutet das: Wird ein Kilogramm Tabak weniger angebaut, konsumiert und entsorgt, reicht die eingesparte Wassermenge aus, um eine Person ein ganzes Jahr lang mit Trinkwasser zu versorgen.
Und selbst nach der Ernte bleibt der ökologische Fußabdruck groß: In den Fabriken der Tabakindustrie werden laut Unfairtobacco weltweit etwa 60 Millionen Tonnen Frischwasser verbraucht und 55 Millionen Tonnen Abwasser erzeugt – belastet mit Ammoniak, Nikotin, Salzsäure, Nitrat, Chlor, Schwermetallen und zahlreichen weiteren Giftstoffen.
Maßnahmen und politische Ansätze zur Reduzierung der Umweltschäden
Das WHO-Abkommen zur Tabakkontrolle enthält einen eigenen Umweltartikel. „Das heißt, es ist tatsächlich etwas, worum sich die Staaten auch kümmern müssen“, sagt Sonja von Eichborn von Unfairtobacco, auch wenn dieser Bereich in den vergangenen Jahren hinter Steuererhöhungen, Werbeverboten und Prävention eher zurückstand. Doch das ändert sich gerade.
In Genf haben die 183 Vertragsstaaten der Anti-Tabak-Konvention im November 2025 neue Empfehlungen verabschiedet: Vorgesehen sind weniger Verkaufsstellen für Tabakprodukte, ein höheres Mindestalter für bestimmte nikotinhaltige Produkte und wirksamere Tabaksteuern. Erstmals sprechen sich die Staaten dafür aus, Zigarettenstummel-Abfälle sowie den Müll durch Einweg-E-Zigaretten zu reduzieren. Die Anti-Tabak-Konvention FCTC ist zwar seit 2005 rechtlich bindend, doch konkrete Maßnahmen müssen national umgesetzt werden.
Keine Einigung gab es bei zentralen Streitpunkten wie Aromastoffen in E-Zigaretten, einem Verbot von Zigarettenfiltern oder stärkeren Regeln zum Schutz vor Einflussnahme der Tabakindustrie. Diese Themen sollen bei der nächsten Konferenz in Armenien erneut beraten werden.
Erste Verbote von E-Zigaretten
In Europa wurde mit der EU-Einwegplastikrichtlinie bereits ein wichtiger Schritt gesetzt: Zigarettenfilter gelten darin ausdrücklich als Einwegplastik, sodass Hersteller sich an den Entsorgungskosten beteiligen müssen.
Die Bundesregierung hat 2025 angekündigt, Einweg-E-Zigaretten verbieten zu wollen. Dafür brauche es aber die Zustimmung der EU-Kommission, heißt es aus Berlin. Andere Länder sind bereits weiter: In den Niederlanden, Finnland, Ungarn, Lettland, Litauen und Slowenien sind Aromastoffe in E-Zigaretten verboten – erlaubt ist nur noch Tabakgeschmack. Großbritannien, Belgien und Frankreich haben außerdem Einweg-E-Zigaretten vollständig verboten.
Lobbystrategien der Tabakindustrie gegen Umwelt- und Gesundheitsregeln
Laut Sonja von Eichborn versucht die Tabakindustrie, die Verantwortung für die Umweltschäden durch Zigarettenfilter von sich zu weisen. Zwar betreibe sie selbst Aufklärung über Zigarettenmüll, rede das Problem dabei aber klein und versuche, es auf die Raucher und Raucherinnen zu verschieben. Die Botschaft laute: „Nicht der Filter ist das Problem, sondern der Mensch, der den Filter fallen lässt.“ Für von Eichborn ist das eine unzulässige Strategie, weil die Tabakindustrie diesen Filter überhaupt herstellt.
Auf europäischer Ebene versucht die Tabakindustrie, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Wenn festgelegt wird, wie hoch die Abgabe für Einwegkunststoffe sein soll – also auch, wie viel die Hersteller für die Beseitigung ihrer eigenen Zigarettenfilter zahlen müssen –, ist die Branche direkt in den zuständigen Gremien vertreten. Laut Sonja von Eichborn nutzt sie diese Präsenz, um Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern zu knüpfen und Einfluss auf Regelungen zu nehmen, die sie selbst betreffen.
Auf globaler Ebene erhebt die WHO deutliche Vorwürfe gegen die Tabakindustrie. Zum Auftakt der Konferenz der Vertragsstaaten der Anti-Tabak-Konvention erklärte die Organisation, die Industrie versuche, mit süß schmeckenden E-Zigaretten schon Kinder nikotinsüchtig zu machen und zugleich mit massiver Lobbyarbeit die Umsetzung des WHO-Abkommens zu behindern. WHO-Generaldirektor Tedros formulierte es ganz klar: Die Tabakkonzerne hätten kein Interesse an Gesundheit. Ihnen gehe es nur um Profit. Die Mitgliedstaaten wurden deshalb ausdrücklich aufgefordert, keine Lobbyisten in ihren Delegationen zu dulden.
ema