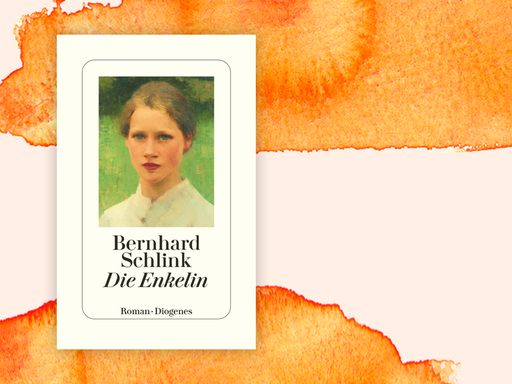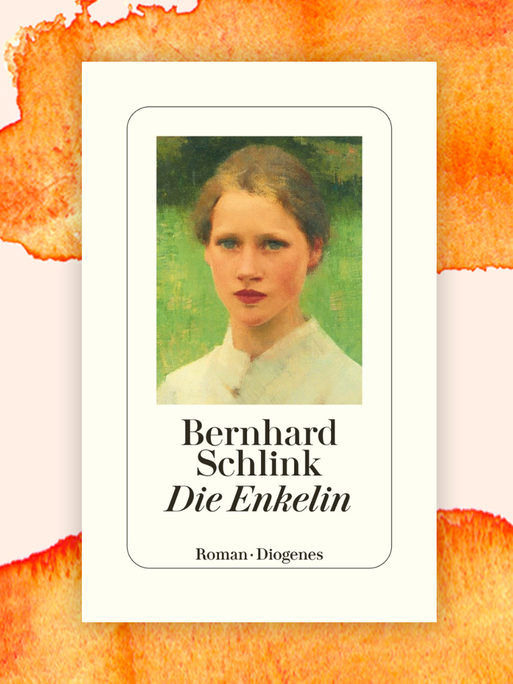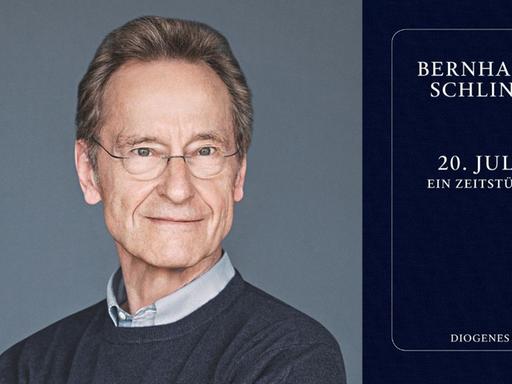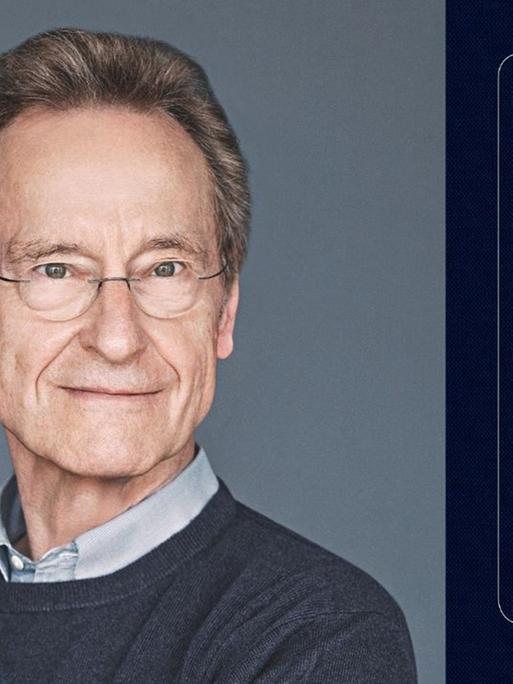Nur von ferne ähneln alle Abschiede einander. Bei Abschiedsbüchern am Ende von Schriftstellerkarrieren ist es nicht anders. Melancholie, Rückschau, Alter und Tod finden sich darin zwar fast immer, aus der Nähe betrachtet aber treten die Unterschiede hervor.
Da hat man in dieser Saison etwa Paul Auster, der in „Baumgartner“ anspielungsreich über die Inkongruenz von Phänomenologie und Erinnerung reflektiert. Robert Schindel wiederum hangelt sich in seinem magisch-existenziellen Lyrikband „Flussgang“ tief ins eigene Ich hinab, um die letzte große Leerstelle, die Zeitlichkeit allen Seins, einzukreisen.
Nun ist da auch Bernhard Schlink, der eine realistisch-exemplarische, auf alle Transzendenz verzichtende Abschiedsgeschichte vorlegt, in der die letzte Lebensphase von der Sorge um die Zurückzulassenden geprägt ist. Aber auch von einer quälenden Frage:
„War es seine Eitelkeit, die nicht ertrug, dass er vergessen wurde? War es seine Eitelkeit, die nicht ertrug, dass er starb? Dass er getilgt wurde, zuerst aus dem Leben, dann aus dem Gedächtnis?“
Auf sich selbst zurückgebogene Geschichte
Es ist ein Abschied mit Blick nach vorn, in die Zeit nach dem eigenen Leben. Deshalb spielen Schlinks Lebensthemen, die er seit „Der Vorleser“ mit der Beharrlichkeit des Juristen immer wieder neu nuanciert hat – die Vergangenheitsbewältigung und die historische Schuld – in dieser ganz auf sich selbst zurückgebogenen Geschichte keine Rolle.
Der Protagonist ist der 76-jährige Martin, ein emeritierter Professor für die Geschichte des Rechts, der nach einem zweiten Frühling mit junger Frau und kleinem Kind von der Zeit eingeholt wird. Mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs, die ihm noch ein halbes Jahr Leben einräumt – allenfalls die Hälfte davon ohne Schmerzen –, beginnt für Martin eine neue, rückwärts laufende Zeitrechnung: Jeder kleine Umweg geht nun von der Restzeit ab. Die Prioritäten verschieben sich.
Weil das, was von den Menschen bleibt, die eigenen Kinder sind, fragt sich der Held, ob die sechs gemeinsamen Jahre mit Sohn David ausgereicht haben, diesem genug Gewissheiten fürs Leben mitzugeben. Zur Sicherheit greift Martin zum Stift. Sein langer Brief über die großen Dinge – über Gott, die Liebe, den Tod oder die Gerechtigkeit – ist für den jugendlich gereiften David gedacht. Auch wenn die Lebensratschläge entfernt an Senecas „Briefe an Lucilius“ erinnern mögen, hat Martin doch vor allem Allerweltweisheiten für den Filius parat:
„Liebe ist nicht gerecht. Du kannst ein noch so guter Mensch sein, Du kannst zu der, die Du liebst, noch so gut passen, Du kannst noch so achtsam und einfallsreich um sie werben, Euer gemeinsames Leben könnte noch so schön werden – sie kann trotzdem den anderen wollen, der sie nur mäßig liebt und schäbig behandelt.“
Das Leben bricht ins Sterben ein
Was dem leicht verzweifelten Versuch, als Mentor eine Haltung zu vererben, dazwischenfunkt, ist dann das Leben selbst, das noch einmal unvorhergesehen in Martins Sterben einbricht. Er findet nämlich heraus, dass seine Frau Ulla ihn betrügt, und das sogar jetzt, in seinen letzten Wochen, was zu rasender Eifersucht, zu impulsiven Handlungen, aber auch zu mahlstromartigen Gedanken führt:
„Er würde Ulla nicht auf das ansprechen, was er gesehen hatte. Wenn sie ein Doppelleben führte, wollte er das Leben, das sie mit ihm führte, behalten. Aber er musste wissen, was ihr anderes Leben war, wer sie war, die das andere Leben führte. Selbst wenn er nur die halbe Ulla haben konnte, er musste die ganze Ulla kennen.“
Bernhard Schlink: „Das späte Leben”
Diogenes Verlag, Zürich 2023
240 Seiten, 26 Euro.
Diogenes Verlag, Zürich 2023
240 Seiten, 26 Euro.
In seiner Lage, so beschließt der getroffene Gatte, lässt sich mit der Lüge leichter leben als mit der Konfrontation. Für die Aufarbeitung von Beziehungsfehlern ist einfach keine Zeit mehr. Dass für seine mehr als 30 Jahre jüngere Frau das Leben weitergeht, möchte Martin eigentlich für eine gute Nachricht halten. Gleichwohl geraten die beiden in eine ausweglose Lage, in der die Unehrlichkeit sozusagen metastasiert.
Tiefes und Seichtes im bruchlosen Wechsel
Wie die versehrte Kleinfamilie diesen Zustand überkommt und bei aller Asymmetrie doch noch so etwas wie ein dankbares, erfülltes Sterben möglich wird – die obligate Reise ans Meer gehört dazu –, das weiß Schlink mit routinierter Eleganz zu erzählen.
Und doch ist es ein schmaler Grat zwischen dem Anrührenden und dem Rührseligen, denn erstaunlich bruchlos wechseln sich tiefe und seichte Passagen ab, springt der Fokus von philosophisch imprägnierten Gedanken über das Bleibende im Vergehenden oder das Übergriffige in der Sorge zu eher einfallslosen Szenen eines Ehe- und Familienromans. Originell sind auch die Figuren nicht geraten: David ist mehr Projektionsfläche als wirkliches Kind. Martins Nebenbuhler erweist sich als Pappkamerad. Und dass die selbstbewusste Ulla abstrakte Bilder malt, für die sich Martin erst jetzt zu interessieren beginnt, schrammt nah am Klischee vorbei:
„Er spürte, dass Ulla eine große Künstlerin war, sagte es ihr, und sie freute sich, auch wenn er seine Bewunderung nur in allgemeinen Wendungen ausdrücken konnte.“
Keine Schneise für die Fantasie
Letzteres gilt sogar auf der Metaebene. Bernhard Schlinks karge und schlichte Sprache wirkt angesichts der diesmal ganz inwendigen Dramaturgie, die von kollidierenden und kollabierenden Emotionen lebt, besonders unbefriedigend. Mit ihrer Eindeutigkeit lässt sie keinen poetischen Freiraum, keine Schneise für die Fantasie. Wenn es überhaupt einmal symbolisch wird, folgt jedem Bild gleich die Auslegung.
Für Romane mit historischem Setting mag das angehen. Wo aber das Ringen mit der Vergänglichkeit und den letzten Dingen im Zentrum steht, wäre mehr erzählerische Offenheit wünschenswert gewesen. Auf den letzten Seiten findet sie sich dann endlich. Jetzt wird nicht mehr alles Nebensächliche bis ins Detail auserzählt. Dafür darf die Literaturgeschichte mitsprechen, zumindest die klassische von Schiller bis Heine. Es wirkt fast, als habe Bernhard Schlink – ganz wie sein Held – das Loslassen erst lernen müssen.