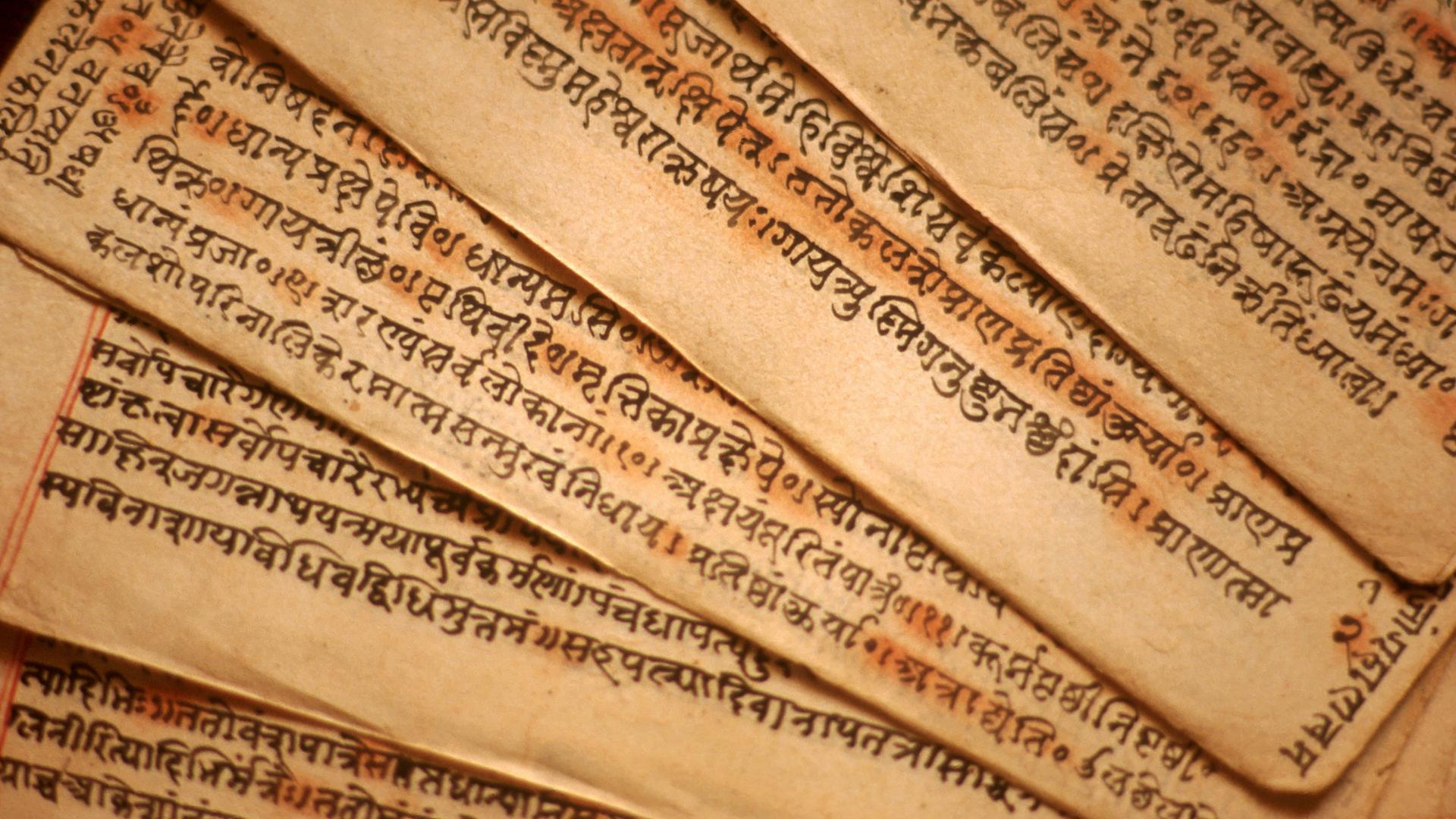Die Nazis sind seit gut einem Jahr an der Macht in Deutschland, als Arbeiter in Bad Dürrenberg durch Zufall auf ein Skelett in einem urzeitlichen Grab stoßen. Die Nationalsozialisten glauben, hier einen "Urarier" gefunden zu haben. Die Forschung hat den Fall wieder aufgerollt: Weitere Grabungen und interdisziplinäre Untersuchungen brachten neue Erkenntnisse - und diese bringen unter anderem das Bild von den Europäern der Steinzeit ins Wanken.
1934 – ein ungewöhnliches Grab wird entdeckt
Es beginnt mit einem Zufall: Am 4. Mai 1934 setzen Arbeiter im Kurpark von Bad Dürrenberg die Spaten an. Ein Kanal soll ausgeschachtet werden. Dabei stoßen sie auf ein Grab mit rot bepuderten Menschenknochen. Im belebten Park fällt dies ein paar Lehrern auf. Rötel gilt als sicheres Zeichen für ein Grab aus dem Mesolithikum, also der Mittelsteinzeit, die von etwa 10.000 bis 4.500 Jahre vor Christus dauerte. Ein für diese Zeit äußerst seltener Grabfund, sagt heute der Anthropologe Wolfgang Haak.
Ein herbeigerufener Grabungstechniker birgt am selben Tag neben den Knochen Rehgeweihe, Kranichknochen und beeindruckende Eckzähne von Auerochsen, Hirschen und Wildschweinen, dazu große Mengen scharfkantiger Feuersteine und ein geschliffenes Steinbeil. Er hat nur einen Nachmittag Zeit, denn die Bauarbeiten im Park sollen rasch fortgesetzt werden. Die Ergebnisse liefert er bei dem Anthropologen Gerhard Heberer und dem Prähistoriker Friedrich Bicker von der Landesanstalt für Vorgeschichte Halle ab.
Ideologische Fehldeutung: ein Urarier auf deutschem Boden
Beide Männer sind Anhänger der Nationalsozialisten, erklärt Harald Meller vom Landesmuseum für Vorgeschichte Halle. Friedrich Bicker hat beispielsweise zur Herkunft der Arier publiziert: Das indogermanische Urvolk, heißt es darin, habe seinen Ursprung in Mitteldeutschland, am Ostseebecken und in Nordwestdeutschland, was Bicker mit weiteren Ausgrabungen beweisen will.
Die Archäologie ist wie andere Wissenschaften in den Nationalsozialismus verstrickt. So stellen die Organisationen „Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte“ und „Ahnenerbe“ unter Alfred Rosenberg und Heinrich Himmler der Archäologie Finanzmittel zur Verfügung, mit dem Ziel, Beweise für die Überlegenheit der arisch-germanischen Rasse zu liefern. Allerdings gibt es dabei ein Problem, so Harald Meller: Die Arier und die indogermanischen Sprachen stammen aus Indien. Das gerade gefundene Grab wird von der NS-Archäologie daher sofort als Beweis für den Ursprung der Arier auf „deutschem Boden“ genutzt.
Doch die Ideologie verstellt den wissenschaftlichen Blick: Die Archäologen gehen selbstverständlich davon aus, dass das bedeutende Grab das eines Mannes ist – während doch das sehr gut erhaltende Becken aufzeigt, dass es sich um das Skelett einer Frau handelt. Die sogenannte incisura major, eine große Knochenkerbe an der Rückseite des Beckens, ist bei Frauen weiter und bei Männern enger gebogen, was die Beckenform bestimmt. Die Fehldeutung entsteht zudem dadurch, dass sich die Forschung der Zeit auf die Schädel fokussiert. Das Skelett ist eher zweitrangig.
Auch mit der Altersangabe irren Bicker und Heberer. Das Skelett ist rund 5000 Jahre älter, als sie denken. Statt aus der Zeit der Schnurbandkeramiker entstammt es der Mittleren Steinzeit. Laut C14-Radiokarbonbestimmung und modernen Gentests ist es 9.000 Jahre alt und damit eines der ältesten je gefundenen Skelette in Deutschland.
Trancen, Tiermasken und Heiltränke: eine Schamanin
Die ins Grab gelegten Feuersteinklingen zeigen, dass die Trauergemeinde rund 200 Personen umfasste – viel für die damalige Zeit. Auch die überreichen Beigaben im Grab der Frau bezeugen eine gesellschaftliche Sonderrolle der Toten: möglicherweise eine Heilerin oder Schamanin, so Harald Meller. Einen Hinweis darauf liefern die beiden obersten Halswirbel. Walter Wohlgemuth, Röntgenexperte am Uniklinikum Halle, hat Skelett und Schädel im Computertomografen untersucht. Das Ergebnis: Der erste und zweite Halswirbel sind fehlgebildet. Die Frau konnte „durch eine drehende, nach hinten gebeugte Kopfdrehung eine Hirnarterie abdrücken und damit neurologische Symptome erzeugen.“
Dies – also die Unterversorgung des Gehirns mit Blut – führt möglicherweise zu einer unwillkürlichen Augenbewegung, einem sogenannten Nystagmus, bei dem sich die Augen ins Weiße verdrehen. Die Steinzeit-Frau konnte dies mit einer Halsdrehung selbst auslösen – und damit einen tranceähnlichen, visionären Zustand erzeugen oder anzeigen.
Dazu findet sich auch in ihrem Oberkiefer eine Besonderheit, die sich ebenfalls im CT zeigt: An zwei Schneidezähnen des Oberkiefers liegen die Zahnhöhlen und Nerven frei. Die Zähne sind abgeflacht, abgeraspelt möglicherweise von einem runden Werkzeug wie einen Ast oder Zweig. Die Folge wäre: eine chronische Zahnwurzelentzündung, gefolgt vom Verlust der Vorderzähne.
Das CT zeigte aber, dass die Frau mehrfach selbst die Entzündung heilen konnte. Beispielsweise mit Birkenrinde, legt Walter Wohlgemuth nahe: „Birkenrinde enthält Salicylsäure und vielleicht hat sie Medikamente hergestellt, indem sie Birkenrindenäste abgeschabt hat.“ Auch sei denkbar, dass das sehr schmerzhafte Abfeilen der Zähne im Rahmen eines Initiationsritus stattgefunden habe – um ihre Heilkraft oder Geistesstärke zu testen, so Wohlgemuth. Einen Beweis für die Rolle der Toten liefern diese Untersuchungen jedoch nicht, sie stellen lediglich Indizien dar. Doch auch die Grabbeigaben legen eine Tätigkeit als Heilerin nahe: Schildkrötenpanzer als Salbenschüsseln, scharfe Klingen und ein Beil für Eingriffe und zum Zerkleinern von Wurzeln und Kräutern.
Seit 2019 wird der Fundort erneut untersucht. Nachgrabungen durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) in Sachsen-Anhalt ab 2019 bringen neue Erkenntnisse. Nah ihres Grabes wird beispielsweise eine weitere Grube mit zwei Schamanenmasken gefunden. Die C-14-Methode ergibt: Sie wurden Generationen später dort abgelegt, rund 600 Jahre nach dem Tod der Schamanin. Dies lässt darauf schließen, dass die Grabstätte der Frau gekennzeichnet war und auch Jahrhunderte nach ihrem Tod noch aufgesucht wurde. Hiervon zeugen wertvolle Gaben, die in dieser Zeit an ihrem Grab niedergelegt wurden und die die herausragende Bedeutung der Schamanin für ihre Zeit und weit darüber hinaus nochmals unterstreichen. Der Beginn von Ahnenverehrung, so Meller.
Hell oder dunkel? Erkenntnisse über Europas frühe Bewohner
Bei neuen, archäogenetischen Untersuchungen werden wichtige Aspekte des Aussehens der Schamanin bestimmt – und zwar mit der sogenannten Sequenziertechnik. Der Archäogenetiker Wolfgang Haak und sein Team nutzen zur Auswertung eine Methode aus der digitalen Forensik: das HIrisPlex-S System. Es untersucht 41 ganz bestimmte Positionen in der doppelsträngigen DNA in jenen Genen, die Melanin produzieren und damit die Farbe von Haut und Haar bestimmen. Basierend auf der Buchstabenfolge an diesen 41 Positionen und nach Abgleich mit weltweiten Genom-Bibliotheken erstellt das System eine Schätzung des äußeren Erscheinungsbilds der Person. Das fällt anders aus als erwartet, so Harald Meller: „Sie hat eine dunkle Hautfärbung, aber blaugrüne Augen und schwarze Haare.“
Das wirkt überraschend, ist für westeuropäische Wildbeutergruppen – also Jäger und Sammler – aber typisch. So haben die Forscherinnen Stefania Vai und Silvia Ghirotto, spezialisiert auf die Analyse steinzeitlicher Genome, bereits vor zwei Jahren mit einer neue Methode bestätigt, dass auch „Ötzi“ dunkelhäutig war. Er lebte vor 5300 Jahren in den Ötztaler Alpen. Eine neue Studie der Genetikerin Silvia Ghirotto legt nun nahe, dass weder die „Schamanin“ noch „Ötzi“ mit ihrer dunklen Hautfarbe eine Ausnahme darstellten. „Unsere Vorfahren hatten bis vor etwa 2000 oder 3000 Jahren dunkle Haut“, so Silvia Ghirotto und erklärt:
Wir haben alle geeigneten alten Genome aus ganz Europa analysiert, über einen Zeitraum von 45.000 Jahren, und festgestellt, dass sich unsere helleren Phänotypen in Europa erst in jüngster Zeit verbreitet haben. Wir müssen bis zur Eisenzeit vor etwa 2000 bis 2500 Jahren gehen, bevor diese helleren Phänotypen so weit verbreitet waren, dass sie die Häufigkeit der dunkleren, für uns ursprünglichen Phänotypen, erreichten.
Das hängt auch mit neuen Lebensweisen zusammen, beispielsweise mit dem Übergang zum Anbau von Feldfrüchten und Nutzpflanzen. Mit diesem Wechsel zu überwiegend pflanzlicher Nahrung im Neolithikum (circa 5500 bis 2200 vor Christus) wird helle Haut zu einem Vorteil: Sie unterstützt die Produktion von Vitamin D während den langen Phasen der Dunkelheit im Winter der nördlichen Hemisphäre – welches bei einer pflanzenbasierten Ernährung nicht ausreichend im Körper produziert wird.
Offenbar ist also die Epidermis evolutionären Änderungen unterworfen und reagiert auf Migrationswellen des Homo Sapiens oder auf neue Umweltimpulse wie Nahrung und Sonne - mal extrem langsam, mal rascher. Bleibt die Frage: Wird sich diese Erkenntnis dank der spektakulären Funde wie Ötzi oder der Schamanin verbreiten?
Heidi Mühlenberg / csh