
„Die ersten Psychose-Symptome hatte ich mit siebzehn, als ich meine erste Freundin kennenlernte und die ganze Beziehung aus der dritten Person erlebt habe.“
Paul Ippen und ich nehmen an der gleichen Studie der Berliner Charité teil. Ippen lebt seit vielen Jahren mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Ich gelte als gesunde Probandin. Aus unseren Speichelproben wird jeweils die DNA entnommen. Die spannende Frage: Lassen sich Unterschiede in unseren Genen erkennen, mit denen die Forschung etwas anfangen kann? Unterschiede, die etwas über die Schizophrenie erklären können?
„Das war für mich tatsächlich auch so ein bisschen eine Mutprobe. Ich kann den Leuten, wo ich hingehe, vertrauen und man kann nur für die Betroffenen etwas verbessern, wenn ich mitmache.“
Das ist die große Hoffnung: Eine Krankheit wie die Schizophrenie, die so schwer zu fassen ist, bei ihren genetischen Wurzeln zu packen. Und welche Rolle spielt dabei die Epigenetik? Wird man irgendwann psychische Erkrankungen behandeln, indem man diese Verpackung der Gene verändert?
Paul Ippen und ich nehmen an der gleichen Studie der Berliner Charité teil. Ippen lebt seit vielen Jahren mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Ich gelte als gesunde Probandin. Aus unseren Speichelproben wird jeweils die DNA entnommen. Die spannende Frage: Lassen sich Unterschiede in unseren Genen erkennen, mit denen die Forschung etwas anfangen kann? Unterschiede, die etwas über die Schizophrenie erklären können?
„Das war für mich tatsächlich auch so ein bisschen eine Mutprobe. Ich kann den Leuten, wo ich hingehe, vertrauen und man kann nur für die Betroffenen etwas verbessern, wenn ich mitmache.“
Das ist die große Hoffnung: Eine Krankheit wie die Schizophrenie, die so schwer zu fassen ist, bei ihren genetischen Wurzeln zu packen. Und welche Rolle spielt dabei die Epigenetik? Wird man irgendwann psychische Erkrankungen behandeln, indem man diese Verpackung der Gene verändert?
"Mixed Reality" im Kopf
„Ich habe von Anfang an gemerkt, dass ich auf dieser Welt irgendwie komisch bin. Ich habe als Kind geglaubt, dass ich ein Alien sei. Ich hatte auch so Erfahrungen, dass ich mit Außerirdischen gesprochen habe als Kind. Und meine Mutter hat erzählt, dass ich auf Ausstellungen Sachen gesehen habe, wo sie dachte, wo guckt der hin? Als ob ich schon was Anderes gesehen habe, sozusagen.“
Als Jugendlicher in einer Punker-Clique gehört es dazu, ein bisschen anders zu sein als die anderen. Viele Jahre spielt Paul Ippen in einer Band, ein wichtiger sozialer Anker zu dieser Zeit. Ippen ist ein witziger, sympathischer Mann mit einem scharfen, schwarzen Humor – bis heute hat er viele Freunde. Dennoch begleiten ihn Selbstmordgedanken. Mit 32 kommt er zum ersten Mal in die Psychiatrie.
„Das ist wie eine Mixed Reality App, wie eine Augmented-Reality-App. Wir sehen mehr. Man kann über das Handy noch zusätzliche Inhalte einblenden. Und das kann ich auch, nur brauche ich keine App dazu.“
Als Jugendlicher in einer Punker-Clique gehört es dazu, ein bisschen anders zu sein als die anderen. Viele Jahre spielt Paul Ippen in einer Band, ein wichtiger sozialer Anker zu dieser Zeit. Ippen ist ein witziger, sympathischer Mann mit einem scharfen, schwarzen Humor – bis heute hat er viele Freunde. Dennoch begleiten ihn Selbstmordgedanken. Mit 32 kommt er zum ersten Mal in die Psychiatrie.
„Das ist wie eine Mixed Reality App, wie eine Augmented-Reality-App. Wir sehen mehr. Man kann über das Handy noch zusätzliche Inhalte einblenden. Und das kann ich auch, nur brauche ich keine App dazu.“
Einer von hundert leidet an Schizophrenie
Paul Ippen heißt eigentlich anders, möchte aber nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden. Wenn die Leute Schizophrenie hören, kriegen sie Angst, meint Ippen. Ein Prozent der Bevölkerung erkrankt daran. Die Betroffenen haben verzerrte Gedanken, Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen, Wahnvorstellungen mit oft paranoidem Inhalt und natürlich Halluzinationen. Häufig hören sie Stimmen.
„Zum Beispiel, wenn ich in die Badewanne gehe und den Wasserhahn aufdrehe, dann spricht das Wasser zu mir. Das spricht halt einfach zu mir. Das hat sich nie geändert. Ich weiß einfach, sobald ich den Wasserhahn aufdrehe, spricht das Wasser zu mir. Ich habe mich dazu entschieden, das einfach plappern zu lassen und nicht hinzuhören. Ich kann aber auch hingehen und mit ihm sprechen, sozusagen.“
1908 beschrieb der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler eine Krankheit, die er Schizophrenie nannte. Seitdem hat sich bei der Diagnose kaum etwas geändert. Dabei ist jeder Schizophrenie-Erkrankte anders, und zwar erheblich. Tatsächlich wird darüber diskutiert, ob es sich überhaupt um eine einzige Krankheit handelt. Was sich dabei im Gehirn abspielt, ist bis heute nicht geklärt.
„Zum Beispiel, wenn ich in die Badewanne gehe und den Wasserhahn aufdrehe, dann spricht das Wasser zu mir. Das spricht halt einfach zu mir. Das hat sich nie geändert. Ich weiß einfach, sobald ich den Wasserhahn aufdrehe, spricht das Wasser zu mir. Ich habe mich dazu entschieden, das einfach plappern zu lassen und nicht hinzuhören. Ich kann aber auch hingehen und mit ihm sprechen, sozusagen.“
1908 beschrieb der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler eine Krankheit, die er Schizophrenie nannte. Seitdem hat sich bei der Diagnose kaum etwas geändert. Dabei ist jeder Schizophrenie-Erkrankte anders, und zwar erheblich. Tatsächlich wird darüber diskutiert, ob es sich überhaupt um eine einzige Krankheit handelt. Was sich dabei im Gehirn abspielt, ist bis heute nicht geklärt.

Hinweise aus Zwillingsstudien
„Das ist wahrscheinlich jedem klar, dass in der Psychiatrie Maschinen zum Beispiel in der Klinik absolut keine Rolle spielen. Es gibt eigentlich nur die Beobachtung und das Gespräch des Arztes. Und weder irgendwelche Labortestungen oder Maschinen, die eine Diagnose tatsächlich stellen können.“
So beschreibt Stephan Ripke das Problem. Ripke leitet nicht nur das Labor für statistische Genetik in der Psychiatrie der Berliner Charité, sondern auch im „Psychiatric Genomics Consortium“, einem Zusammenschluss von Zentren weltweit. Die große Frage: Welche Gene sind für Schizophrenie verantwortlich? Denn dass es eine Veranlagung geben muss, das zeigen seit vielen Jahrzehnten Zwillingsstudien.
„Wir vergleichen eineiige Zwillinge mit zweieiigen Zwillingen und nehmen an, dass beide eigentlich gleich aufwachsen, die eineiigen Zwillinge und die zweieiigen Zwillinge. So dass man da annehmen kann, dass der Umweltfaktor praktisch der gleiche ist. Und da kann man eben sehen, dass eineiige Zwillinge sehr viel häufiger gemeinsam krank oder auch gesund bleiben als zweieiige Zwillinge.“
So beschreibt Stephan Ripke das Problem. Ripke leitet nicht nur das Labor für statistische Genetik in der Psychiatrie der Berliner Charité, sondern auch im „Psychiatric Genomics Consortium“, einem Zusammenschluss von Zentren weltweit. Die große Frage: Welche Gene sind für Schizophrenie verantwortlich? Denn dass es eine Veranlagung geben muss, das zeigen seit vielen Jahrzehnten Zwillingsstudien.
„Wir vergleichen eineiige Zwillinge mit zweieiigen Zwillingen und nehmen an, dass beide eigentlich gleich aufwachsen, die eineiigen Zwillinge und die zweieiigen Zwillinge. So dass man da annehmen kann, dass der Umweltfaktor praktisch der gleiche ist. Und da kann man eben sehen, dass eineiige Zwillinge sehr viel häufiger gemeinsam krank oder auch gesund bleiben als zweieiige Zwillinge.“
Suche nach auffälligen DNA-Varianten
Zwillingsstudien zeigen, dass der Anteil der Veranlagung an einer Schizophrenie-Erkrankung grob zwischen 60 und 80 Prozent liegt. Im Vergleich: Für Depressionen wird er auf lediglich 40 bis 60 Prozent geschätzt. Vor rund 15 Jahren begann die große Suche nach den genetischen Ursachen. Stephan Ripke:
„Was wir relativ schnell festgestellt haben, ist, dass die einzelnen Zentren erfolglos waren. Und das war eine ganz spannende Erkenntnis. Dass alle Leute sich auf diese neue Technik gestürzt haben, die ja relativ erschwinglich war und uns hoffentlich Erkenntnisse bringen würde bei einer Krankheit, von der wir nicht so viel Ahnung haben. Und da haben sich wirklich alle möglichen psychiatrischen Zentren da drauf gestürzt und haben diese SNPs gemacht. Und alle waren sie erfolglos und haben nichts gefunden.“
Die Methode: GWAS - die Abkürzung steht für Genomweite Assoziationsstudien. Dabei wird die DNA nach auffällig häufig oder auffällig selten auftretenden Varianten abgesucht, die sich etwa bei Menschen mit einer bestimmten Krankheit zeigen. Auch die Studie an der Berliner Charité, an der Paul Ippen und ich teilnehmen, ist eine genomweite Assoziationsstudie.
„Was wir relativ schnell festgestellt haben, ist, dass die einzelnen Zentren erfolglos waren. Und das war eine ganz spannende Erkenntnis. Dass alle Leute sich auf diese neue Technik gestürzt haben, die ja relativ erschwinglich war und uns hoffentlich Erkenntnisse bringen würde bei einer Krankheit, von der wir nicht so viel Ahnung haben. Und da haben sich wirklich alle möglichen psychiatrischen Zentren da drauf gestürzt und haben diese SNPs gemacht. Und alle waren sie erfolglos und haben nichts gefunden.“
Die Methode: GWAS - die Abkürzung steht für Genomweite Assoziationsstudien. Dabei wird die DNA nach auffällig häufig oder auffällig selten auftretenden Varianten abgesucht, die sich etwa bei Menschen mit einer bestimmten Krankheit zeigen. Auch die Studie an der Berliner Charité, an der Paul Ippen und ich teilnehmen, ist eine genomweite Assoziationsstudie.
Studie an der Charite
Probanden können sie hier gar nicht genug bekommen. Bevor ich ein paar Aufmerksamkeits– und Kognitionstests mache, gebe ich meine Speichelprobe ab. „Soll ich was trinken, damit ich mehr Speichel habe?“ „Nein, es wäre ganz wichtig – haben Sie in der letzten halben Stunde etwas getrunken, etwas gegessen oder geraucht?“ „Nein, habe ich nicht.“ „Genau. Dann können wir gleich loslegen.“
Was als nächstes mit der Probe passiert: Für die genomische Analyse wird die DNA aus dem Speichel extrahiert. Die menschliche DNA besteht aus drei Milliarden Basenpaaren, doch nur ein Teil davon ist interessant. Denn tatsächlich sind über 99 Prozent der DNA bei allen Menschen gleich, vielleicht sogar 99,9 Prozent. Stephan Ripke:
„Und das kann man sich so vorstellen, dass selbst bei einer ganz normalen, gesunden Bevölkerung gibt es da eine Stelle, wo 30 Prozent der Bevölkerung ein A hat und 70 Prozent ein T. Denen geht es allen gut und die sind alle gesund, aber die haben da einen unterschiedlichen Buchstaben.“
„Und das kann man sich so vorstellen, dass selbst bei einer ganz normalen, gesunden Bevölkerung gibt es da eine Stelle, wo 30 Prozent der Bevölkerung ein A hat und 70 Prozent ein T. Denen geht es allen gut und die sind alle gesund, aber die haben da einen unterschiedlichen Buchstaben.“
Genom klug durchsuchen
Basenpaare, die von Mensch zu Mensch variieren können, werden als SNPs bezeichnet. Studien in einer europäischen Bevölkerung können sich auf ungefähr acht Millionen SNPs beschränken, und selbst die acht Millionen SNPs können noch einmal zusammengefasst werden.
„Diese acht Millionen Buchstaben, die wir da haben, die sind nicht unabhängig voneinander, sondern die werden ganz häufig gemeinsam vererbt. Das heißt, diese acht Millionen Buchstaben, die hängen zusammen. Und dieses Zusammenhängen nutzen wir aus und können entsprechend von diesen 300.000, die wir gemessen haben, mathematisch die restlichen 7,6 Millionen schätzen. Das sind dann keine so punktgenauen Messungen. Aber diese Wahrscheinlichkeiten reichen uns.“
Wer statt über drei Milliarden Basenpaaren nur noch 300.000 SNPs in der DNA analysiert, spart Zeit und Geld. So werden große Studien mit enormen Probandenzahlen möglich. Und die scheinen auch nötig zu sein, um überhaupt etwas zu finden. In einer aktuellen Meta-Studie haben Ripke und ein Team des „Psychiatric Genomic Consortiums“ die Speichelproben von 70.000 Schizophrenie-Patienten ausgewertet und dabei insgesamt 270 auffällige Gen-Regionen gefunden. Ripke rechnet damit, dass mit den Daten von immer mehr Patienten auch die Zahl der Schizophrenie-Gene steigen wird.
„Obwohl wir sehr, sehr, sehr große Studien inzwischen zusammenhaben, mit 100.000 Schizophrenie-Patienten, also wirklich international, das ist riesengroß, kommen wir auf acht bis zehn Prozent, die wir erklären können von diesen 60 bis 80 Prozent. Also, wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen.“
„Diese acht Millionen Buchstaben, die wir da haben, die sind nicht unabhängig voneinander, sondern die werden ganz häufig gemeinsam vererbt. Das heißt, diese acht Millionen Buchstaben, die hängen zusammen. Und dieses Zusammenhängen nutzen wir aus und können entsprechend von diesen 300.000, die wir gemessen haben, mathematisch die restlichen 7,6 Millionen schätzen. Das sind dann keine so punktgenauen Messungen. Aber diese Wahrscheinlichkeiten reichen uns.“
Wer statt über drei Milliarden Basenpaaren nur noch 300.000 SNPs in der DNA analysiert, spart Zeit und Geld. So werden große Studien mit enormen Probandenzahlen möglich. Und die scheinen auch nötig zu sein, um überhaupt etwas zu finden. In einer aktuellen Meta-Studie haben Ripke und ein Team des „Psychiatric Genomic Consortiums“ die Speichelproben von 70.000 Schizophrenie-Patienten ausgewertet und dabei insgesamt 270 auffällige Gen-Regionen gefunden. Ripke rechnet damit, dass mit den Daten von immer mehr Patienten auch die Zahl der Schizophrenie-Gene steigen wird.
„Obwohl wir sehr, sehr, sehr große Studien inzwischen zusammenhaben, mit 100.000 Schizophrenie-Patienten, also wirklich international, das ist riesengroß, kommen wir auf acht bis zehn Prozent, die wir erklären können von diesen 60 bis 80 Prozent. Also, wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen.“

Schwache Ergebnisse und heftige Kritik
Mit anderen Worten: Die bisher gefundenen Gen-Regionen haben jede für sich nur einen minimalen Anteil bei der Entstehung einer Schizophrenie. Zusammengenommen erklären sie nur einen kleinen Teil des Unterschieds zwischen Patientinnen und Patienten auf der einen Seite und gesunden Probanden auf der anderen. Kritiker wie der US-Psychologe und Verhaltensgenetiker Eric Turkheimer betrachten die Suche nach den genetischen Ursachen der Schizophrenie damit für gescheitert. Irgendein Zusammenhang ließe sich immer finden, wenn man nur genügend Daten sammle, meint Turkheimer.
„Nehmen wir mal an, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler und entscheiden, eine Gen-Studie zum Bankrott durchzuführen. Sie nehmen also eine enorme Anzahl an Leuten, die bankrott gegangen sind und suchen nach genetischen Assoziationen. Und sie werden sie finden, garantiert, 100 Prozent. Und dann werden sie einige interessante Muster in den Genen dieser Leute sehen. Aber wird das zu irgendwelchen brauchbaren Informationen über Menschen führen, die in den Bankrott steuern? Nein. Die Leute werden dann sagen, wir sind noch nicht am Ziel. Wir brauchen mehr Geld, und noch größere Probandenzahlen."
Turkheimer ist keineswegs gegen Genforschung. Er selbst untersucht seit mehr als 20 Jahren den Zusammenhang zwischen Erblichkeit, Genen und Verhalten. Er ist allerdings skeptisch, dass jemals eine Schizophrenie-Erkrankung auf Grundlage der Gene erklärt werden kann. Was nicht bedeutet, dass die Hinweise aus der Genetik nicht doch nützlich sein können. Genetische Muster können zusätzliche Informationen liefern. Turkheimer:
„Wenn jemand beispielsweise die alte Hypothese untersucht, dass eine städtische Umgebung das Schizophrenie-Risiko erhöht. Menschen, die in der Stadt leben, unterscheiden sich von denen, die nicht in der Stadt leben, in vielerlei Hinsicht, auch genetisch. Man kann die Genetik also hinzuziehen, wenn man betrachtet, welche Zusammenhänge es zwischen Schizophrenie und Stadt gibt. Das ist ein bescheidenerer Ansatz als zu glauben, wir finden die Gene für Schizophrenie.“
„Nehmen wir mal an, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler und entscheiden, eine Gen-Studie zum Bankrott durchzuführen. Sie nehmen also eine enorme Anzahl an Leuten, die bankrott gegangen sind und suchen nach genetischen Assoziationen. Und sie werden sie finden, garantiert, 100 Prozent. Und dann werden sie einige interessante Muster in den Genen dieser Leute sehen. Aber wird das zu irgendwelchen brauchbaren Informationen über Menschen führen, die in den Bankrott steuern? Nein. Die Leute werden dann sagen, wir sind noch nicht am Ziel. Wir brauchen mehr Geld, und noch größere Probandenzahlen."
Turkheimer ist keineswegs gegen Genforschung. Er selbst untersucht seit mehr als 20 Jahren den Zusammenhang zwischen Erblichkeit, Genen und Verhalten. Er ist allerdings skeptisch, dass jemals eine Schizophrenie-Erkrankung auf Grundlage der Gene erklärt werden kann. Was nicht bedeutet, dass die Hinweise aus der Genetik nicht doch nützlich sein können. Genetische Muster können zusätzliche Informationen liefern. Turkheimer:
„Wenn jemand beispielsweise die alte Hypothese untersucht, dass eine städtische Umgebung das Schizophrenie-Risiko erhöht. Menschen, die in der Stadt leben, unterscheiden sich von denen, die nicht in der Stadt leben, in vielerlei Hinsicht, auch genetisch. Man kann die Genetik also hinzuziehen, wenn man betrachtet, welche Zusammenhänge es zwischen Schizophrenie und Stadt gibt. Das ist ein bescheidenerer Ansatz als zu glauben, wir finden die Gene für Schizophrenie.“
Auffällige SNPs auch für andere Krankheiten relevant
Tatsächlich gibt es schon jetzt einige interessante Befunde. Beispielsweise sind einige der auffälligen Genregionen bei Schizophrenie eigentlich dafür zuständig, das Immunsystem des Körpers zu steuern - ein weiterer Hinweis darauf, dass bei Betroffenen offenbar das Immunsystem hyperaktiv ist und die Schizophrenie möglicherwiese eine Art Autoimmunkrankheit sein könnte, eine Entzündung der Nerven.
Und auch die Nähe zwischen den verschiedenen psychiatrischen Krankheiten spiegelt sich in den genomweiten Assoziationsstudien wider. Denn ebenso wie sich in den diagnostischen Graubereichen Symptome überschneiden, kommen die auffälligen SNPs immer wieder vor. So scheinen zum Teil die gleichen Genregionen bei Schizophrenie und der Bipolaren Störung beteiligt zu sein. Genetische Ähnlichkeiten werden auch bei Angst- und Zwangsstörungen gefunden sowie bei Autismus-Spektrum-Störungen und ADHS, die beide schon in der Kindheit oder Jugend einsetzen. Sogar bei Schizophrenie und Nikotinsucht zeigen sich auffällig ähnliche Muster. Stephan Ripke:
„Gerade was das Rauchen betrifft, da sind wir uns ziemlich sicher, dass das eben nicht der Effekt ist, dass eben Schizophrenie-Patienten zu einem übergroßen Teil rauchen, das ist klar. Sondern, dass das wirklich ein paralleler Effekt ist, der bei beiden Erkrankungen eine Rolle spielt, nämlich auf die Schizophrenie und auf eine Suchterkrankung. Das können wir tatsächlich so sehen.“
Und auch die Nähe zwischen den verschiedenen psychiatrischen Krankheiten spiegelt sich in den genomweiten Assoziationsstudien wider. Denn ebenso wie sich in den diagnostischen Graubereichen Symptome überschneiden, kommen die auffälligen SNPs immer wieder vor. So scheinen zum Teil die gleichen Genregionen bei Schizophrenie und der Bipolaren Störung beteiligt zu sein. Genetische Ähnlichkeiten werden auch bei Angst- und Zwangsstörungen gefunden sowie bei Autismus-Spektrum-Störungen und ADHS, die beide schon in der Kindheit oder Jugend einsetzen. Sogar bei Schizophrenie und Nikotinsucht zeigen sich auffällig ähnliche Muster. Stephan Ripke:
„Gerade was das Rauchen betrifft, da sind wir uns ziemlich sicher, dass das eben nicht der Effekt ist, dass eben Schizophrenie-Patienten zu einem übergroßen Teil rauchen, das ist klar. Sondern, dass das wirklich ein paralleler Effekt ist, der bei beiden Erkrankungen eine Rolle spielt, nämlich auf die Schizophrenie und auf eine Suchterkrankung. Das können wir tatsächlich so sehen.“
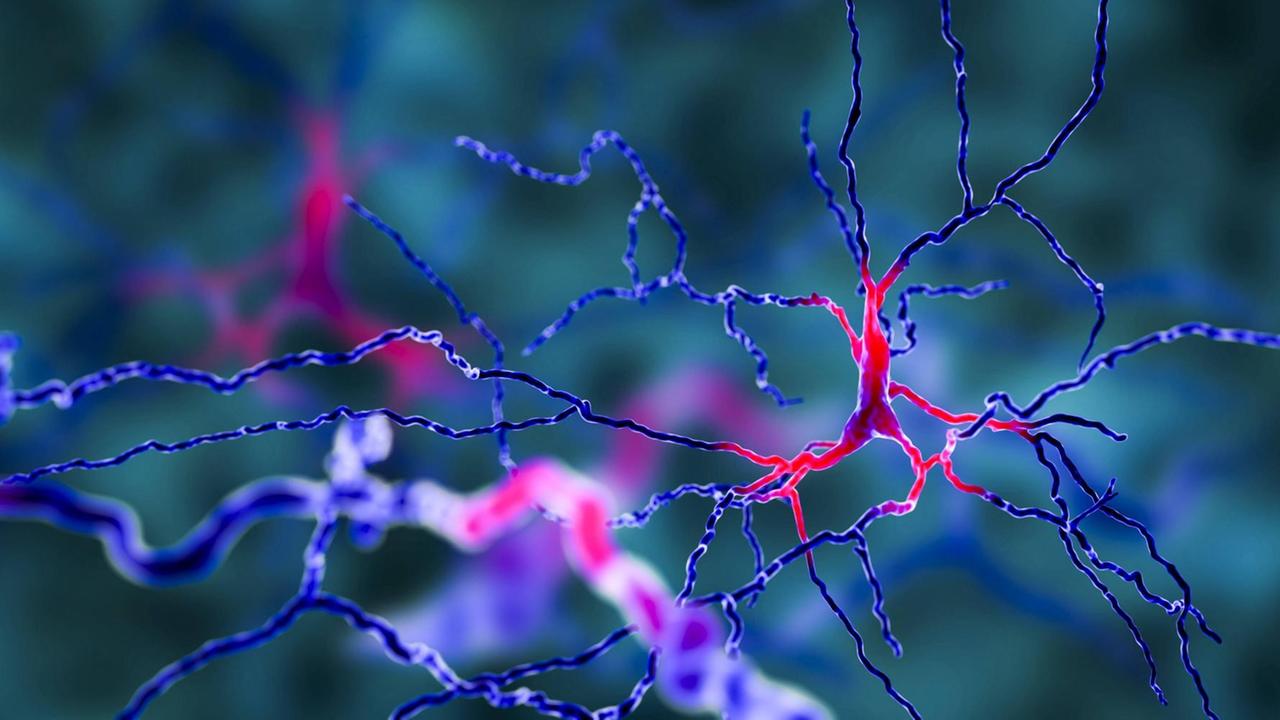
Neue Medikamente ganz oben auf der Wunschliste
Gene für Nikotinsucht? Vielleicht sogar ein erhöhtes Risiko für Schizophrenie? Ich bin natürlich neugierig, was die Genetiker in meiner Speichelprobe finden werden. „Ich kann Ihnen das ausrechnen und ich kann Ihnen das nennen. Aber ich darf es nicht, das ist mir von der Ethikkommission verboten worden. Weil ich kein ausgebildeter Humangenetiker bin und diese Information natürlich potentiell auch gefährlich ist. Stellen Sie sich vor, ich sage Ihnen, Ihr Risiko ist jetzt doppelt so groß und Sie springen vor lauter Angst aus dem Fenster.“
Meine Daten fließen also ausschließlich in die Grundlagenforschung. Ripke hofft, dass es eines Tages möglich sein wird, mit Hilfe der Genetik bessere Diagnosen stellen zu können: eine Blutprobe entnehmen, die DNA analysieren und anhand eines Algorithmus auswerten. So könnten zusätzliche Informationen für die Diagnose zur Verfügung stehen. Doch das wichtigste Ziel sieht Ripke darin, neue Ansatzpunkte für Medikamente zu finden. Seit den 50er-Jahren funktionieren alle Antipsychotika nach dem gleichen Prinzip, indem sie den Botenstoff Dopamin abdämpfen. Ripke:
„Wir haben uns jahrzehntelang mit diesem Dopamin-Rezeptor, ich würde mal nicht sagen ‚rumgequält‘. Er hat, wenn man die Berichte liest, wie es ohne Dopamin-Rezeptorblocker aussieht, dann weiß man, das ist ein Medikament, das damals auf jeden Fall ein Segen war. Was aber fehlt, ist endlich mal noch ein zweiter Ansatzpunkt. Ich will die gar nicht verteufeln, die Neuroleptika. Aber es fehlen einfach die Alternativen. Gerade für Leute, die zu viele Nebenwirkungen haben. Es gibt ja Leute, die haben nicht so viele Nebenwirkungen, die kommen damit gut klar. Aber manche eben nicht.“
Meine Daten fließen also ausschließlich in die Grundlagenforschung. Ripke hofft, dass es eines Tages möglich sein wird, mit Hilfe der Genetik bessere Diagnosen stellen zu können: eine Blutprobe entnehmen, die DNA analysieren und anhand eines Algorithmus auswerten. So könnten zusätzliche Informationen für die Diagnose zur Verfügung stehen. Doch das wichtigste Ziel sieht Ripke darin, neue Ansatzpunkte für Medikamente zu finden. Seit den 50er-Jahren funktionieren alle Antipsychotika nach dem gleichen Prinzip, indem sie den Botenstoff Dopamin abdämpfen. Ripke:
„Wir haben uns jahrzehntelang mit diesem Dopamin-Rezeptor, ich würde mal nicht sagen ‚rumgequält‘. Er hat, wenn man die Berichte liest, wie es ohne Dopamin-Rezeptorblocker aussieht, dann weiß man, das ist ein Medikament, das damals auf jeden Fall ein Segen war. Was aber fehlt, ist endlich mal noch ein zweiter Ansatzpunkt. Ich will die gar nicht verteufeln, die Neuroleptika. Aber es fehlen einfach die Alternativen. Gerade für Leute, die zu viele Nebenwirkungen haben. Es gibt ja Leute, die haben nicht so viele Nebenwirkungen, die kommen damit gut klar. Aber manche eben nicht.“
Starke Nebenwirkungen bei bisherigen Neuroleptika
„Das erste, was ich bekommen habe, war Risperdal. Ich war total entspannt, aber ich habe schnell gemerkt, ich habe kein sexuelles Empfinden mehr. Das war ein schöner Urlaub von mir, aber das ist keine Möglichkeit.“ Paul Ippen sagt von sich, dass er so ziemlich alle Neuroleptika, die auf dem Markt sind, mal genommen hat. Für kurze Zeit haben sie ihm Erleichterung gebracht, vor allem in besonders akuten Phasen.
„Das kann man auch niemandem empfehlen, Angst vor seinen Mitpatienten in der Psychiatrie zu kriegen. Das ist keine gute Idee, weil dann kriegt man Haldol. Das ist, als wenn man einmal durch eine Wodkaflasche guckt, das ist auch nicht doll. Alles unscharf und sehr eingeschränktes Gesichtsfeld, will man nicht. Dann habe ich Zyprexa genommen, innerhalb von zwei Monaten war ich von 58 Kilo auf 85 Kilo, weil man die ganze Zeit Süßigkeiten frisst, das war auch keine Option.“
Inzwischen nimmt Paul Ippen überhaupt keine Medikamente mehr. Auch sonst erhofft er sich kaum noch Hilfe von der Medizin. „Was soll ich zu genetischer Forschung sagen, es ändert mein Leben nicht. Ich kriege ja keine anderen Gene durch genetische Forschung. Es ist eigentlich relativ egal.“
„Das kann man auch niemandem empfehlen, Angst vor seinen Mitpatienten in der Psychiatrie zu kriegen. Das ist keine gute Idee, weil dann kriegt man Haldol. Das ist, als wenn man einmal durch eine Wodkaflasche guckt, das ist auch nicht doll. Alles unscharf und sehr eingeschränktes Gesichtsfeld, will man nicht. Dann habe ich Zyprexa genommen, innerhalb von zwei Monaten war ich von 58 Kilo auf 85 Kilo, weil man die ganze Zeit Süßigkeiten frisst, das war auch keine Option.“
Inzwischen nimmt Paul Ippen überhaupt keine Medikamente mehr. Auch sonst erhofft er sich kaum noch Hilfe von der Medizin. „Was soll ich zu genetischer Forschung sagen, es ändert mein Leben nicht. Ich kriege ja keine anderen Gene durch genetische Forschung. Es ist eigentlich relativ egal.“
Ein Gen, das verpackt ist, kann nicht abgelesen werden
Unsere Gene scheinen so etwas wie unser Schicksal zu sein, vererbt und unveränderlich. Was sich allerdings verändern kann, ist die Umgebung der Gene. Die Epigenetik. Katharina Domschke, Ärztliche Direktorin für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg: „Weil die Epigenetik eben keinesfalls deterministisch ist, sondern vielmehr den Determinismus unserer Genetik relativiert. Weil die Epigenetik wie ein Dimmer wirkt an unseren Genen.“
60 bis 80 Prozent ist der erbliche Anteil einer Schizophrenie. Das heißt umgekehrt, dass zu 20 bis 40 Prozent andere Einflüsse eine Rolle spielen. Das können schwere psychische Belastungen oder Drogen sein. Inzwischen weiß man, dass diese äußeren Einflüsse sogar direkt auf die Gene einwirken können – über die Epigenetik, die man sich vorstellen kann wie die Verpackung der Erbmoleküle. Je nachdem, wie sehr ein Gen eingepackt ist, ist es mehr oder weniger aktiv. Das heißt, nicht nur die genetische Veranlagung eines Menschen, sondern auch das, was ihm im Laufe seines Lebens zugestoßen ist, könnte sich theoretisch im Erbgut ablesen lassen.
60 bis 80 Prozent ist der erbliche Anteil einer Schizophrenie. Das heißt umgekehrt, dass zu 20 bis 40 Prozent andere Einflüsse eine Rolle spielen. Das können schwere psychische Belastungen oder Drogen sein. Inzwischen weiß man, dass diese äußeren Einflüsse sogar direkt auf die Gene einwirken können – über die Epigenetik, die man sich vorstellen kann wie die Verpackung der Erbmoleküle. Je nachdem, wie sehr ein Gen eingepackt ist, ist es mehr oder weniger aktiv. Das heißt, nicht nur die genetische Veranlagung eines Menschen, sondern auch das, was ihm im Laufe seines Lebens zugestoßen ist, könnte sich theoretisch im Erbgut ablesen lassen.
Ein gut untersuchter epigenetischer Vorgang ist die Methylierung. Methylgruppen heften sich an das Gen. Katharina Domschke hat dafür – halb im Spaß – eine Eselsbrücke: „Methylierung kann man gleichsetzen mit Mützchen. Und da liegt das Schlafmützchen schon nahe. Die Methylierung legt das Gen in den Winterschlaf. Das Gen wird ‚gesilencet‘, zum Schweigen gebracht und in seiner Transkriptionsaktivität und damit auch in der Protein-Produktion gehindert oder zumindest vermindert.“

Umwelt verändert uns epigenetisch. Negativ ...
Der zweite wichtige epigenetische Mechanismus ist die Histon-Modifikation. Domschke vergleicht es mit einem Wollknäuel. Der DNA-Faden ist zwei Meter lang. Dennoch passt er in jede einzelne Zelle unseres Körpers, die nur einige Mikrometer groß sind.
„Das heißt, es ist ein mathematisches Wunderwerk, einen DNA-Faden von zwei Metern in eine solch kleine Zelle zu packen. Dieses Packen funktioniert, indem der DNA-Faden wie ein Wollknäuel hochkompliziert aufgewickelt wird. Diese Aufwicklung findet statt um so genannte Histone. Und die Histon-Modifikationen bestimmen jetzt den Grad der Wicklung. Ob die DNA ganz eng um die Histone gewickelt ist. Oder ob Teile des DNA-Fadens abgewickelt werden wie so ein Wollfaden. Und sie können sich vorstellen, dass man mit einem Wollfaden, der abgewickelt ist, natürlich viel besser stricken kann, als wenn der Wollfaden in der Mitte in diesem Wollknäuel versteckt liegt.“
Epigenetische Mechanismen steuern, ob die Aktivität eines Gens herauf- oder heruntergefahren ist. Sie wirken eher wie Dimmer als wie ein An- und Ausschalter. Und sie werden davon beeinflusst, was uns widerfährt.
„Diese epigenetischen Mechanismen können responsiv, also antwortend sein auf Noxen - auf Nikotin, also Rauchen, auf Cannabis, auf andere Drogen, auf Alkohol. Das gilt sowohl für den Menschen selbst, der diese Sachen konsumiert, als auch für ungeborene Kinder, als auch in den Spermien von Vätern, die vor der Zeugung viel Alkohol konsumiert haben. Das teilt sich der Epigenetik von Spermien durchaus mit und kann dann auch transgenerational gegebenenfalls weitergegeben werden.“
„Das heißt, es ist ein mathematisches Wunderwerk, einen DNA-Faden von zwei Metern in eine solch kleine Zelle zu packen. Dieses Packen funktioniert, indem der DNA-Faden wie ein Wollknäuel hochkompliziert aufgewickelt wird. Diese Aufwicklung findet statt um so genannte Histone. Und die Histon-Modifikationen bestimmen jetzt den Grad der Wicklung. Ob die DNA ganz eng um die Histone gewickelt ist. Oder ob Teile des DNA-Fadens abgewickelt werden wie so ein Wollfaden. Und sie können sich vorstellen, dass man mit einem Wollfaden, der abgewickelt ist, natürlich viel besser stricken kann, als wenn der Wollfaden in der Mitte in diesem Wollknäuel versteckt liegt.“
Epigenetische Mechanismen steuern, ob die Aktivität eines Gens herauf- oder heruntergefahren ist. Sie wirken eher wie Dimmer als wie ein An- und Ausschalter. Und sie werden davon beeinflusst, was uns widerfährt.
„Diese epigenetischen Mechanismen können responsiv, also antwortend sein auf Noxen - auf Nikotin, also Rauchen, auf Cannabis, auf andere Drogen, auf Alkohol. Das gilt sowohl für den Menschen selbst, der diese Sachen konsumiert, als auch für ungeborene Kinder, als auch in den Spermien von Vätern, die vor der Zeugung viel Alkohol konsumiert haben. Das teilt sich der Epigenetik von Spermien durchaus mit und kann dann auch transgenerational gegebenenfalls weitergegeben werden.“
... aber auch positiv.
Dass epigenetische Veränderungen durch Umwelteinflüsse auch an folgende Generationen vererbt werden, ist beim Menschen noch nicht vollständig nachgewiesen. Klar ist aber, dass die Epigenetik nicht nur auf schädliche, sondern auch auf positive Einflüsse reagiert. Die Patienten, bei denen eine Forschungsgruppe um Domschke das zeigen konnten, hatten eine Panikstörung. Bei dieser Erkrankung spielt das Monoamin-Oxidase-A-Gen eine wichtige Rolle. Tatsächlich war die Methylierung bei den Patienten niedriger als bei gesunden Probanden, das Gen somit aktiver. Nach einer sechswöchigen Therapie wurden die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer noch einmal untersucht. Die Methylierung hatte sich bei denjenigen von ihnen, bei denen auch die Psychotherapie gewirkt hatte, normalisiert. Katharina Domschke:
„Aber ob es jetzt wirklich der Effekt der Psychotherapie war, das können wir nicht sagen. Es kann auch sein, dass sich die Immunvorgänge durch die Psychotherapie verändert haben, es also Zwischenschritte gibt, Vermittler. Aber ich glaube, dass die Aussage doch beeindruckend genug ist. Zumal sie eben auch für die Patienten eine gute Botschaft ist. Wir wissen, dass Psychotherapie wirkt. Und jetzt wissen wir, dass sie sogar biologische Muster zu normalisieren in der Lage zu sein scheint.“
Epigenetische Studien profitieren von den Erkenntnissen, die die ältere genetische Forschung hervorgebracht hat. Doch auch so genannte EWAS, also Epigenomweite Assoziationsstudien werden seit knapp zehn Jahren durchgeführt. Sie sind weitaus komplizierter. „Die Epigenetik ist im Menschen hoch flexibel, vor allem bei den Genen, die wir in der Psychiatrie untersuchen. Das heißt, es kommt schon darauf an, dass wir genaue Angaben haben, hat dieser Mensch geraucht, wie viele Zigaretten? Ist gerade der Partner gestorben, hatte dieser Mensch schon einmal eine Krebserkrankung? Das heißt, wir müssen sehr viel mehr über den klinischen Phänotyp wissen und dementsprechend werden die Stichproben jetzt erst so richtig aufgebaut.“
„Aber ob es jetzt wirklich der Effekt der Psychotherapie war, das können wir nicht sagen. Es kann auch sein, dass sich die Immunvorgänge durch die Psychotherapie verändert haben, es also Zwischenschritte gibt, Vermittler. Aber ich glaube, dass die Aussage doch beeindruckend genug ist. Zumal sie eben auch für die Patienten eine gute Botschaft ist. Wir wissen, dass Psychotherapie wirkt. Und jetzt wissen wir, dass sie sogar biologische Muster zu normalisieren in der Lage zu sein scheint.“
Epigenetische Studien profitieren von den Erkenntnissen, die die ältere genetische Forschung hervorgebracht hat. Doch auch so genannte EWAS, also Epigenomweite Assoziationsstudien werden seit knapp zehn Jahren durchgeführt. Sie sind weitaus komplizierter. „Die Epigenetik ist im Menschen hoch flexibel, vor allem bei den Genen, die wir in der Psychiatrie untersuchen. Das heißt, es kommt schon darauf an, dass wir genaue Angaben haben, hat dieser Mensch geraucht, wie viele Zigaretten? Ist gerade der Partner gestorben, hatte dieser Mensch schon einmal eine Krebserkrankung? Das heißt, wir müssen sehr viel mehr über den klinischen Phänotyp wissen und dementsprechend werden die Stichproben jetzt erst so richtig aufgebaut.“
Raus aus dem Stigma
Auch Domschke hofft darauf, dass anhand der epigenetischen Forschung einmal psychische Krankheiten besser verstanden werden und neue Ansätze für die Behandlung gefunden werden. Tatsächlich gibt es in der Krebsmedizin bereits erste epigenetische Medikamente.
„Das Problem bei epigenetischen Medikamenten ist, dass man gerade bei psychischen Erkrankungen schlecht an das Zielorgan kommt. Das ist ein Unterschied zu Krebserkrankungen, wo der Krebs beispielsweise im Magen-Darm-Trakt lokalisiert ist, den ich anfassen kann, den ich lokalisieren kann, wo ich in den Krebs etwas hineinspritzen kann. Das ist im Gehirn natürlich sehr viel komplizierter. “
Immerhin, schon jetzt helfe das Wissen um die Epigenetik vielen Patienten, ihre Erkrankung anders wahrzunehmen. „Das heißt, ich habe ein besseres Verständnis dafür, wie meine Biografie mit der Biologie interagiert und vor allem, dass ich auch etwas daran tun kann. Und zwar selbst bei einer ungünstigen Biografie und selbst bei einer unglücklichen biologischen Veranlagung kann ich über die positive Beeinflussung meiner Epigenetik durchaus etwas verändern. Was eine sehr positive Botschaft ist.“
Zur Erinnerung: Man geht davon aus, dass eine Schizophrenie-Erkrankung zu 60 bis 80 Prozent von der Veranlagung abhängt. Wenn ein Zwilling erkrankt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sein Bruder oder ihre Schwester ebenfalls erkrankt. Doch im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung liegt die Erkrankungsrate nur bei eins zu hundert.
„Das Problem bei epigenetischen Medikamenten ist, dass man gerade bei psychischen Erkrankungen schlecht an das Zielorgan kommt. Das ist ein Unterschied zu Krebserkrankungen, wo der Krebs beispielsweise im Magen-Darm-Trakt lokalisiert ist, den ich anfassen kann, den ich lokalisieren kann, wo ich in den Krebs etwas hineinspritzen kann. Das ist im Gehirn natürlich sehr viel komplizierter. “
Immerhin, schon jetzt helfe das Wissen um die Epigenetik vielen Patienten, ihre Erkrankung anders wahrzunehmen. „Das heißt, ich habe ein besseres Verständnis dafür, wie meine Biografie mit der Biologie interagiert und vor allem, dass ich auch etwas daran tun kann. Und zwar selbst bei einer ungünstigen Biografie und selbst bei einer unglücklichen biologischen Veranlagung kann ich über die positive Beeinflussung meiner Epigenetik durchaus etwas verändern. Was eine sehr positive Botschaft ist.“
Zur Erinnerung: Man geht davon aus, dass eine Schizophrenie-Erkrankung zu 60 bis 80 Prozent von der Veranlagung abhängt. Wenn ein Zwilling erkrankt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sein Bruder oder ihre Schwester ebenfalls erkrankt. Doch im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung liegt die Erkrankungsrate nur bei eins zu hundert.

Aussagekräftiger "Risiko-Score" bislang nicht in Sicht
Wir alle kommen mit einem mehr oder weniger großen Krankheitsrisiko zur Welt. Theoretisch lässt sich dieser so genannte polygene Risikoscore aus der DNA eines Menschen errechnen. Dazu müssten aber weitgehend alle Gen-Varianten, die bei Schizophrenie eine Rolle spielen, bekannt sein. Und davon ist die Forschung noch weit entfernt. Stephan Ripke:
„Wir kommen mit unseren derzeitigen Daten dahin, dass wenn wir einen ganz extremen polygenen Risikoscore finden, dann sehen wir quasi eine achtfache Erhöhung des Risikos. Das klingt erst mal tragisch, ist es aber nicht. Denn das Originalrisiko für ein geborenes Kind ist ein Prozent. Wenn der ein achtfaches Risiko hat, dann hat der ein achtprozentiges Risiko, an Schizophrenie zu erkranken. Das heißt, zu immer noch 92 Prozent bekommt er keine Schizophrenie.“
Dazu kommt die Epigenetik. Wer wirklich wissen will, wie hoch sein persönliches Risiko ist, müsste zusätzlich auch auf die epigenetische Verpackung der relevanten Gene schauen. Katharina Domschke: „Selbst wenn ein Mensch einen ‚polygenic riskscore‘ trägt, heißt das noch lange nicht, dass das Risiko jetzt tatsächlich achtfach erhöht ist. Sondern dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, noch die Epigenetik dieser Gene anzuschauen, um beurteilen zu können, ist er denn überhaupt relevant? Weil die Gene ja vielleicht mit Mützchen versehen sind und gar nicht so aktiv sind wie bei anderen Menschen.“
„Wir kommen mit unseren derzeitigen Daten dahin, dass wenn wir einen ganz extremen polygenen Risikoscore finden, dann sehen wir quasi eine achtfache Erhöhung des Risikos. Das klingt erst mal tragisch, ist es aber nicht. Denn das Originalrisiko für ein geborenes Kind ist ein Prozent. Wenn der ein achtfaches Risiko hat, dann hat der ein achtprozentiges Risiko, an Schizophrenie zu erkranken. Das heißt, zu immer noch 92 Prozent bekommt er keine Schizophrenie.“
Dazu kommt die Epigenetik. Wer wirklich wissen will, wie hoch sein persönliches Risiko ist, müsste zusätzlich auch auf die epigenetische Verpackung der relevanten Gene schauen. Katharina Domschke: „Selbst wenn ein Mensch einen ‚polygenic riskscore‘ trägt, heißt das noch lange nicht, dass das Risiko jetzt tatsächlich achtfach erhöht ist. Sondern dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, noch die Epigenetik dieser Gene anzuschauen, um beurteilen zu können, ist er denn überhaupt relevant? Weil die Gene ja vielleicht mit Mützchen versehen sind und gar nicht so aktiv sind wie bei anderen Menschen.“
Wie umgehen mit statistischer Wahrscheinlichkeit?
Noch ist die Forschung in der Genetik und Epigenetik nicht so weit, eine auch nur im Entferntesten aussagekräftige persönliche Risikoberechnung zu erstellen. Kritiker glauben, dass sich aus dem großen Datenrauschen niemals relevante Informationen ziehen lassen werden. Doch was ist, wenn in zehn oder 20 Jahren der genetische Anteil an der Schizophrenie weitgehend entschlüsselt sein sollte? Was macht man dann mit dem Ergebnis, wenn beispielsweise ein dreißigfach erhöhtes Risiko für Schizophrenie errechnet wird? Domschke:
„Im besten Fall weiß ich, dass ich auf mich achten muss, dass ich eine gewisse Stress- und Ausgleichs-Balance halten muss und nicht ans Ende meiner Kräfte gehen soll. Im schlechtesten Fall entsteht daraus aber sofort die Depression, weil ich mit dieser Information, dass da ein Damoklesschwert über mir hängt, nicht gut umgehen kann. Das ist aber eine grundsätzliche Frage der Gen-Diagnostik, die sich gerade bei den monogenetischen Erkrankungen stellt. Viele Kinder von Chorea-Huntington-Patienten wollen keine Gen-Diagnostik, weil sie nicht wissen, was sie mit dieser dann ja sicheren Information anstellen.“
Bei Chorea-Huntington führt ein Gen-Defekt unausweichlich zum Ausbruch der Krankheit. Bei einer Schizophrenie dagegen spielen wahrscheinlich über tausend Gene eine Rolle. Der polygene Risikoscore ist deshalb lediglich eine statistische Wahrscheinlichkeit. „Das muss man auseinanderhalten. Ich habe eine durchschnittliche epidemiologische Wahrscheinlichkeit, die aber in keiner Weise zutreffen muss für das Individuum.“
„Im besten Fall weiß ich, dass ich auf mich achten muss, dass ich eine gewisse Stress- und Ausgleichs-Balance halten muss und nicht ans Ende meiner Kräfte gehen soll. Im schlechtesten Fall entsteht daraus aber sofort die Depression, weil ich mit dieser Information, dass da ein Damoklesschwert über mir hängt, nicht gut umgehen kann. Das ist aber eine grundsätzliche Frage der Gen-Diagnostik, die sich gerade bei den monogenetischen Erkrankungen stellt. Viele Kinder von Chorea-Huntington-Patienten wollen keine Gen-Diagnostik, weil sie nicht wissen, was sie mit dieser dann ja sicheren Information anstellen.“
Bei Chorea-Huntington führt ein Gen-Defekt unausweichlich zum Ausbruch der Krankheit. Bei einer Schizophrenie dagegen spielen wahrscheinlich über tausend Gene eine Rolle. Der polygene Risikoscore ist deshalb lediglich eine statistische Wahrscheinlichkeit. „Das muss man auseinanderhalten. Ich habe eine durchschnittliche epidemiologische Wahrscheinlichkeit, die aber in keiner Weise zutreffen muss für das Individuum.“

Ethische Probleme bei pränataler Diagnostik
In Deutschland sind Gentests privater Unternehmen verboten. In den USA können Paare aber schon jetzt ihre Speichelproben an Unternehmen wie Orchid Health oder Genomic Prediction schicken und den Risikoscore für ihre zukünftigen Kinder errechnen lassen. Außerdem bieten die Unternehmen ein Embryo-Screening an, bei dem neben dem Risiko für Diabetes oder Krebs auch das für Schizophrenie erkannt werden soll. Erlaubt ist das momentan nur bei einer In-Vitro-Befruchtung. Technisch möglich wäre es aber auch in der Schwangerschaft. Stephan Ripke:
„Man kann genetisches Material des Kindes aus dem Blut der Mutter ziehen. Man muss da noch nicht einmal eine Nadel in den Bauch stecken. Man kann die Genetik des ungeborenen Kindes messen. Und dann kann man eben so was wie ein Schizophrenie-Risiko auslesen. Ob das eine Aussagekraft hat, ist erst mal nicht so wichtig. Wenn das zu einem Schwangerschaftsabbruch führt, dann ist das schon schwerwiegend genug. Und das ist etwas, was mir persönlich tatsächlich Sorge bereitet.“
Gerade erst hat ein kalifornisches Unternehmen gemeldet, bei einer Kinderwunschbehandlung schon bei einem wenige Tage alten Embryo - also noch bevor der Embryo in die Gebärmutter übertragen wird - das gesamte künftige Genom des späteren Kindes vorhersagen zu können. Die neue Methode ist nur ein Beispiel von vielen und zeigt: Je weiter die genetische Forschung voranschreitet, desto drängender werden die damit verbundenen ethischen Fragen werden, nicht nur in der Psychiatrie.
„Man kann genetisches Material des Kindes aus dem Blut der Mutter ziehen. Man muss da noch nicht einmal eine Nadel in den Bauch stecken. Man kann die Genetik des ungeborenen Kindes messen. Und dann kann man eben so was wie ein Schizophrenie-Risiko auslesen. Ob das eine Aussagekraft hat, ist erst mal nicht so wichtig. Wenn das zu einem Schwangerschaftsabbruch führt, dann ist das schon schwerwiegend genug. Und das ist etwas, was mir persönlich tatsächlich Sorge bereitet.“
Gerade erst hat ein kalifornisches Unternehmen gemeldet, bei einer Kinderwunschbehandlung schon bei einem wenige Tage alten Embryo - also noch bevor der Embryo in die Gebärmutter übertragen wird - das gesamte künftige Genom des späteren Kindes vorhersagen zu können. Die neue Methode ist nur ein Beispiel von vielen und zeigt: Je weiter die genetische Forschung voranschreitet, desto drängender werden die damit verbundenen ethischen Fragen werden, nicht nur in der Psychiatrie.
Mehr Grundlagenforschung
Zugleich ist die Forschung mit großen Hoffnungen verbunden: Ein tieferes Verständnis für psychische Erkrankungen, eine bessere Diagnostik - und neue Ansatzpunkte für die Therapie. Letzteres wird selbst im besten Fall noch dauern. Stephan Ripke:
„Es ist sicherlich klar, das will ich gerne zugeben, unsere Forschung hat bis jetzt viel Geld verschlungen und bislang keinem Kranken geholfen. Und dass wir seit Jahrzehnten nur das eine Medikament haben, ist auch eine traurige Geschichte. Aber wenn wir uns als Gesellschaft entscheiden, gar nichts mehr in Grundlagenforschung zu stecken, dann bleiben wir auf einem bestimmten Standard hängen.“
Paul Ippen wird wohl zu alt sein, um davon noch zu profitieren. Er hat seinen eigenen Weg gefunden, mit seiner Schizophrenie zurechtzukommen. Mit Ende 40 hat er eine Arbeit gefunden, bei der er sich wohl fühlt, draußen im Freien geht es ihm gut. Und auch seine Halluzinationen versucht er nicht mehr abzuwehren.
„Ich wurde in der Studie auch gefragt, ob die Psychose da ist oder nicht. Und tatsächlich ist sie immer da. Der Trick ist eigentlich nur, ich ignoriere es. Das ist genauso wie, wenn man in der Bahn sitzt und jemand telefoniert neben einem. Dann kann man entweder zuhören oder man beschäftigt sich mit was anderem und dann geht das in den Hintergrund. Und das ist die Methode, die ich anwende.“
„Es ist sicherlich klar, das will ich gerne zugeben, unsere Forschung hat bis jetzt viel Geld verschlungen und bislang keinem Kranken geholfen. Und dass wir seit Jahrzehnten nur das eine Medikament haben, ist auch eine traurige Geschichte. Aber wenn wir uns als Gesellschaft entscheiden, gar nichts mehr in Grundlagenforschung zu stecken, dann bleiben wir auf einem bestimmten Standard hängen.“
Paul Ippen wird wohl zu alt sein, um davon noch zu profitieren. Er hat seinen eigenen Weg gefunden, mit seiner Schizophrenie zurechtzukommen. Mit Ende 40 hat er eine Arbeit gefunden, bei der er sich wohl fühlt, draußen im Freien geht es ihm gut. Und auch seine Halluzinationen versucht er nicht mehr abzuwehren.
„Ich wurde in der Studie auch gefragt, ob die Psychose da ist oder nicht. Und tatsächlich ist sie immer da. Der Trick ist eigentlich nur, ich ignoriere es. Das ist genauso wie, wenn man in der Bahn sitzt und jemand telefoniert neben einem. Dann kann man entweder zuhören oder man beschäftigt sich mit was anderem und dann geht das in den Hintergrund. Und das ist die Methode, die ich anwende.“
Erstsendung: 27.03.2022









