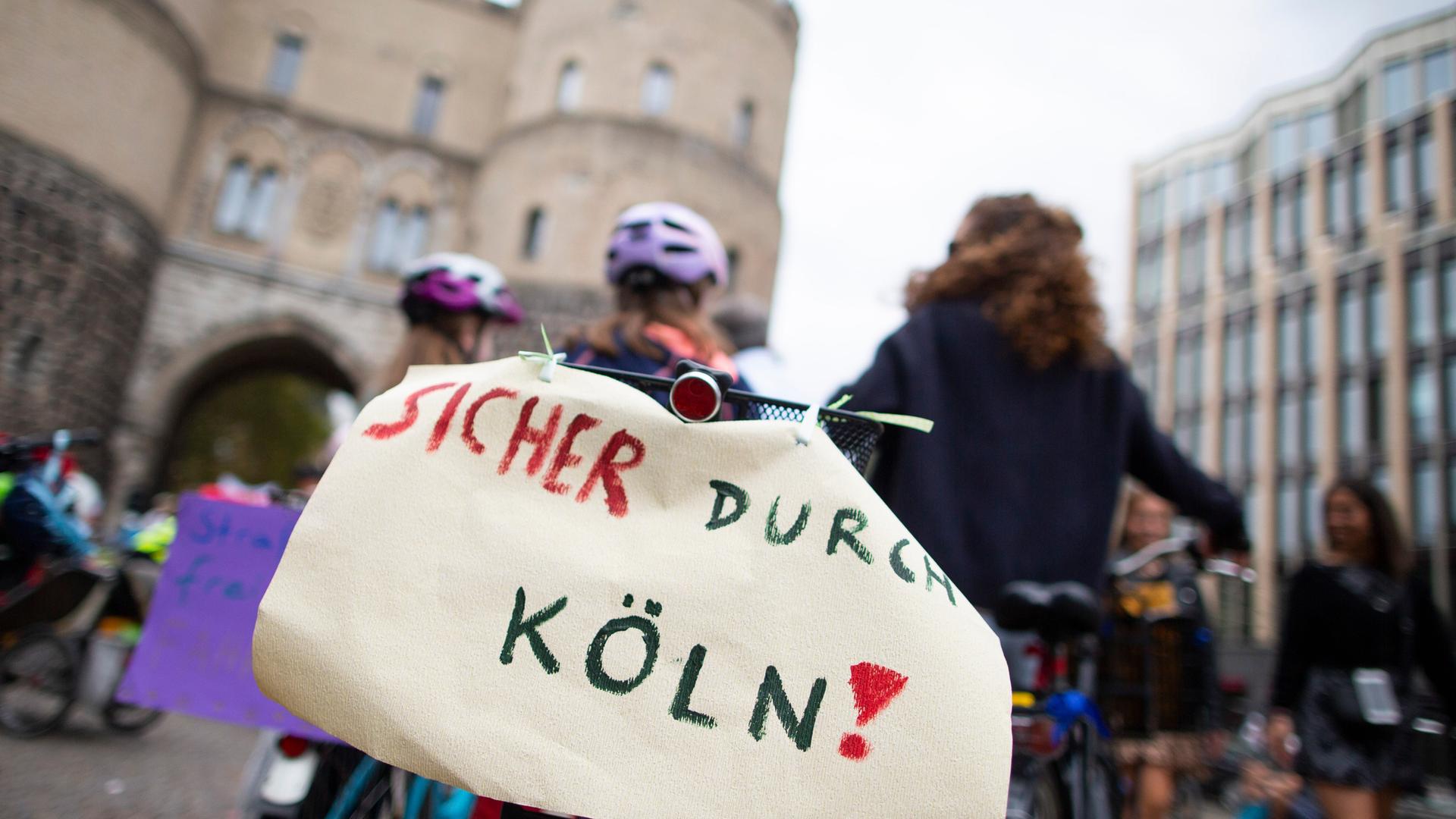Im Jahr 2024 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 27.260 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren bei Verkehrsunfällen verletzt. Nur ein Fünftel von ihnen war dabei zu Fuß unterwegs. Die meisten Kinder verunglückten auf dem Fahrrad (33 Prozent) oder im Auto (35 Prozent).
„Am sichersten oder besten kommen Kinder zur Schule, indem sie zu Fuß gehen“, sagt der Verkehrsexperte Simon Höhner, Geschäftsführer der Verkehrswacht Düsseldorf.
Dennoch bringt etwa ein Viertel der Eltern die Kinder mit dem Auto zur Schule. Das hat verschiedene negative Begleiteffekte: Es kommt zu erhöhtem Verkehrsaufkommen vor Schulen und Staus, die Gefahren für Kinder steigen. Welche Lösungsansätze gibt es?
Warum bringen Eltern ihre Kinder per Auto zur Schule?
Einer Umfrage des ADAC zufolge bringen 19 Prozent der Eltern ihr Kind täglich per Auto zur Schule, weitere 9 Prozent bringen ihr Kind mindestens an jedem zweiten Tag. Dabei lehnen es in der ADAC-Umfrage 58 Prozent der Eltern grundsätzlich ab, Grundschüler zur Schule zu fahren. Insbesondere Eltern, deren Kinder den Schulweg zu Fuß oder mit Fahrrad oder Roller zurücklegen, sehen die Elterntaxis kritisch.
Die meisten Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren, tun das aus praktischen Gründen, etwa weil sie danach zu Terminen weitermüssen (40 Prozent), weil die Schule auf dem Arbeitsweg liegt (30 Prozent) oder wegen schlechten Wetters (32 Prozent). Sicherheitsbedenken äußern nur 12 Prozent als Grund.

Zeitnot nennt auch Verkehrsexperte Simon Höhner als Grund. „Es hat natürlich damit zu tun, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Also die Erwerbstätigkeit beider Elternteile hat sich geändert. Das heißt, jeder muss morgens früh aus dem Haus.“
Warum gibt es Kritik am Elterntaxi?
Mehr Autos bedeuten mehr Verkehr, mehr Staus, mehr Parkplatzsuche – und höhere Gefahren für Fußgänger, vor allem für Kinder ohne unmittelbares Gefahrenbewusstsein. In der ADAC-Umfrage sagten sogar 35 Prozent der Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, dass Elterntaxis zu gefährlichen Verkehrssituationen führen.
In einer Beobachtungs-Reihe des Auto-Club Europa (ACE) hielten sich über 40 Prozent der Elterntaxis nicht an die Verkehrsregeln, sie hielten demnach im Halteverbot, auf Gehwegen oder in zweiter Reihe. Das trage zu gefährlichen Schulwegen bei, warnt der ACE.
Für die langfristige Sicherheit seien Elterntaxis auch für die Kindern in den Autos kontraproduktiv, sagt Simon Höhner von der Verkehrswacht Düsseldorf: „Wenn ich hinten rechts sitze, nehme ich nämlich nicht aktiv am Verkehr teil und da lerne ich nichts. Und dann erwartet man irgendwann in Klasse fünf oder sechs: Dann nimm hier bitte mal den Bus oder die U-Bahn und versteh' doch bitte mal, wie das Ganze funktioniert. Das kann nicht klappen. Das ist ein Lernprozess, der in der Grundschule, im besten Fall schon in der Kita anfängt.“
Die Verkehrswacht Düsseldorf unterstützt schon Kindergärten mit entsprechenden Angeboten, in Zusammenarbeit mit der Polizei. So können Kita-Kinder zum Beispiel einen Fußgängerführerschein machen. Verkehrserziehung ist in NRW und vielen anderen Bundesländern fester Bestandteil des Grundschul-Lehrplans.
Der ACE kritisiert nicht nur Elterntaxis, auch die Infrastruktur sei nicht ausreichend auf Sicherheit ausgelegt. Nur 5 Prozent der Schulwege, die der ACE überprüft hat, stuft er als sicher ein, 36 Prozent hingegen als mangelhaft oder gefährlich. Es gebe Schulen, an denen Schüler die Straße überqueren müssten, ohne dabei Ampeln oder Zebrastreifen nutzen zu können. Nur sechs Prozent der Schulen seien in Spielstraßen oder verkehrsberuhigten Zonen.
Welche Alternativen gibt es zum Elterntaxi?
Der ACE appelliert an Eltern, den Schulweg mit Kindern rechtzeitig und gut einzuüben. Sollte sich das Auto nicht vermeiden lassen, rät der ACE, „Kiss & Ride“-Halteplätze zu nutzen, die lediglich zum schnellen Holen und Bringen vorgesehen sind. Sollten diese nicht vorhanden sein, könne man sich dafür einsetzen, Hol- und Bringzonen zu schaffen.
Außerdem gäbe es die Möglichkeit, für den Autoverkehr gesperrte Schulstraßen zu schaffen - doch die sind in Deutschland rechtlich nicht vorgesehen, während es sie in europäischen Städten wie Wien, Paris und London schon seit Jahren gibt.
Sind Schulstraßen eine Alternative?
In Deutschland bleibt das Recht in der Frage, ob eine Straße für eine Schule gesperrt werden darf, vage. So heißt es in einem Gutachten, das das Aktionsbündnis Kidical Mass zusammen mit dem Verkehrsclub Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk in Auftrag gegeben hat:
„Die Bezeichnung Schulstraße ist bisher in Deutschland kein Rechtsbegriff, anders als etwa ‚Schulstraße‘ in Österreich, wo […] eine entsprechende Anordnungsmöglichkeit mit einem eigenen Verkehrszeichen geschaffen wurde. Eine ähnliche Möglichkeit wurde in Frankreich mit den ‚Rues aux écoles‘ etabliert, von denen in Paris bis November 2023 über 200 geschaffen wurden und bis 2026 weitere 100 eingerichtet werden sollen.“
Wenn Kommunen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (StVO) Einschränkungen wie das zeitweise Sperren von Straßen für den Kraftverkehr durchsetzen wollen, müssen sie dies mit einer Gefahr begründen - und die muss überdurchschnittlich groß sein.
Es müssen zunächst also Unfälle passieren, um sie künftig verhindern zu können - und Kraftfahrzeuge werden als Verkehrsteilnehmer privilegiert. Eine Novelle der StVO sollte das ändern, der Bundestag nahm sie 2023 an, doch sie scheiterte letztlich am Widerstand des Bundesrats.
Teileinziehungen und Verkehrsversuche
Das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium rät den Kommunen, Schulstraßen über die straßenrechtliche Teileinziehung einzurichten, also eine Sperrung der Straße zu bestimmten Uhrzeiten. Doch nicht alle Straßen dürfen gesperrt werden, ausgenommen sind etwa Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Haupterschließungsstraßen.
Die bisherigen Schulstraßen wurden größtenteils im Rahmen von sogenannten Verkehrsversuchen eingerichtet, die die Straßenverkehrsordnung des Bundes vorsieht. Sie sind zwar einfacher einzurichten als etwa eine Teileinziehung, aber als Versuch nur zeitlich begrenzt.
In Städten wie Bonn, Essen, Gladbeck sowie in Berlin und Frankfurt am Main gibt es Versuche mit Schulstraßen. In Frankfurt sind die Behörden mit einem Pilotprojekt im Stadtteil Eckenheim zufrieden: „Die Anzahl der Elterntaxen im Bereich der Pilotschule ist gesunken und es werden wesentlich weniger Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht“, teilt die Stadt mit.
leg, pto