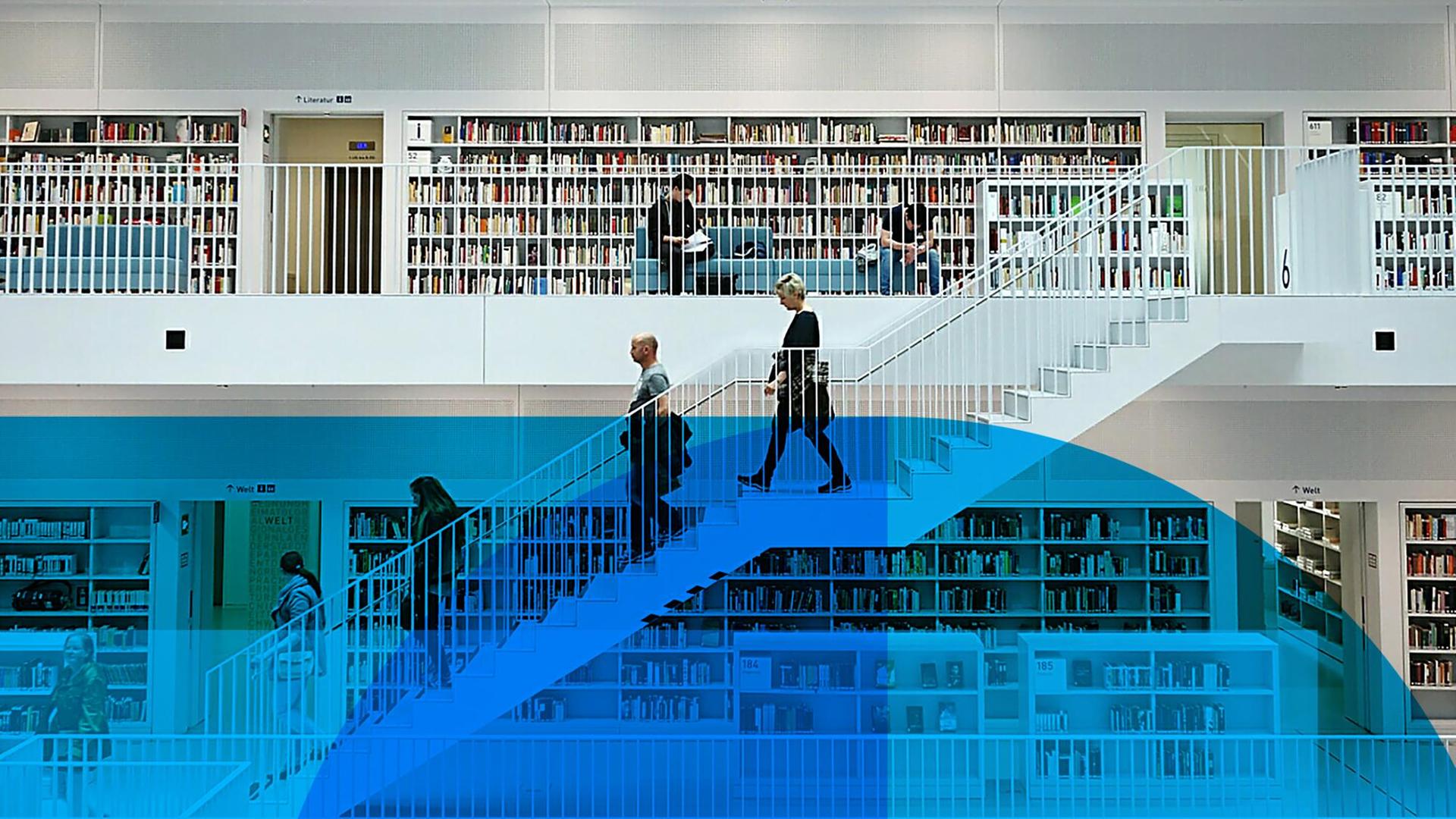Als das Buch "Rasse, Klasse, Nation" von Étienne Balibar und Immanuel Wallerstein vor 30 Jahren herauskam, erschien es schon fast überholt. Alle drei im Titel genannten Begriffe muteten wie historische Kategorien an, die aber längst keine Rolle mehr spielten. Das Konzept Rasse war völlig verpönt, Klassen lösten sich im Zuge der Individualisierung auf und die Nation schien in der EU aufzugehen, die damals noch EG hieß. Diese Trends haben sich bis heute fortgesetzt.
"Das besondere Interesse an diesen Kategorien ist, dass wir das Gefühl haben, sie kommen alle in die Krise."
Manuela Bojadzijev, Professorin für Kulturwissenschaften an der Uni Lüneburg, beharrt dennoch darauf, dass "Rasse, Klasse, Nation" aktuell sei wie nie zuvor. Gerade die verstaubteste der drei Kategorien, der Rassebegriff, erlebt paradoxerweise derzeit eine erschreckende Renaissance, meint einer der beiden Autoren des Buches, der Pariser Philosoph Étienne Balibar.
Ein Klassiker der Sozialforschung
"Was mich umtreibt ist, dass wir einen Rassismus erleben, der sogar ohne Rasse auskommt", sagt Balibar. "Das moderne Hassobjekt ist der Islam beziehungsweise es sind die Muslime. Das zeigt, dass sich Rassismus immer wieder modernisiert, und auch wenn seine biologistische Variante nicht mehr verfängt, kehrt er als kultureller Rassismus zurück. Eine Religion wird als Ersatz genommen, um rassistisches Denken aufrecht zu erhalten."

Der quasi naturalistische Rassismus hatte noch versucht, äußere Merkmale wie die Hautfarbe zum Anlass zu nehmen, um Menschen in Gruppen einzuteilen und ungleich zu behandeln. Doch Muslime etwa aus Arabien, Indonesien oder Schwarzafrika verbindet in dieser Hinsicht augenscheinlich wenig miteinander. Aber Rassismus brauchte ohnehin noch nie schlüssige Argumente, um Menschen zu klassifizieren.
"Rassismus war ja nicht, wie er selbst behauptet, die Reaktion auf die Existenz von Rassen. Der Rassismus hat überhaupt erst Rassen erfunden. Und nachdem er bestimmte Gruppen als Rassen definiert hat, hat er sie natürlich auch stets als solche wiedererkannt. So glauben Rassisten auf Schritt und Tritt, im wahren Leben eine Bestätigung für ihre Weltsicht zu finden."
Modernisierter Rassismus
So waren schon die Nationalsozialisten mit den Juden verfahren, die bis 1933 in Deutschland als juristisch gleichberechtigte Mitbürger zur Nation gehörten. Dann wurde sie mit Arier-Paragraf, Nürnberger Gesetzen und dem gelben Stern als Juden markiert, ausgegrenzt und viele schließlich ermordet. Dass die meisten Zeitgenossen dies hinnehmen konnten, lag daran, dass der gesamte Prozess der Herausbildung von Nationen in Europa von einem rassistischen Denken begleitet wurde, meint der Anthropologe David Theo Goldberg, Professor an der University of California.
"Die dominante Vorstellung seit dem 15. und verstärkt seit dem 16. Jahrhundert war, dass weiße Männer und ihre Nachkommen allen anderen Menschen, insbesondere allen Farbigen, auf natürliche Weise überlegen seien."
Vom Makel zum Ehrentitel
Deshalb fühlten sie sich berufen, die ganze Welt zu kolonialisieren. Und dass ihnen das auch weitgehend gelang, werteten sie wiederum als Beleg für ihre Überlegenheit. Mittlerweile aber hat sich die Entwicklung umgekehrt. Die Bedeutung Europas schwindet, während China und bald vielleicht auch Indien zu neuen Weltmächten aufsteigen. Je mehr die Vorherrschaft des weißen Mannes bröckelt, desto mehr dürfte man erwarten, dass auch sein hochmütiger Rassismus verflöge, überlegt David Theo Goldberg. Doch das Gegenteil sei der Fall:
"Die Behauptung 'Ich bin ganz bestimmt kein Rassist' war lange geradezu ein Gemeinplatz von jedem, der etwas auf sich hielt - selbst wenn dieselben Leute dann manchmal im gleichen Atemzug ausländerfeindliche Parolen von sich gaben. Heute zieht ein Mann wie Steve Bannon durch die USA und Europa und ruft den Leuten auf Populisten-Treffen zu: Bekennt euch dazu, dass ihr Rassisten seid, das ist kein Makel, sondern ein Ehrentitel!"
Rassismus im Gewand des Populismus
Rassismus ist hässlich, aber das sehen immer nur die anderen. Und deshalb, daran erinnert Étienne Balibar, behält er auch seine verführerische Wirkung auf Menschen, die einen Halt suchen.
"Trotz der Tatsache, dass einem in den meisten Fällen die Zugehörigkeit zu einer Rasse erst einmal von außen zugeschrieben wird, kann es Menschen auch Gefühle von Stolz, Würde und Stärke vermitteln, wenn sie sich dann selbst tatsächlich als Angehörige dieser Rasse definieren. Das hat die afro-amerikanische Emanzipationsbewegung gezeigt mit ihrem Slogan "Black is beautiful".
Deshalb erscheint das Denken in rassischen Kategorien auch längst nicht mehr nur weißen Menschen attraktiv. Welche absurden Formen und welchen kuriosen Wandel es mitunter annehmen kann, erlebt die Kulturwissenschaftlerin Maya Indira Ganesh, die in Bangalore und Berlin arbeitet, nahezu tagtäglich.
"Ich bin in einer christlichen Missionsstation in Indien aufgewachsen und musste jeden Morgen ein blondes Jesuskind anbeten. Das hat mir das Gefühl vermittelt, als dunkelhäutiges Mädchen den weißen Menschen unterlegen zu sein. Heute werde ich als Christin, ebenso wie meine muslimischen Landsleute, diskriminiert von einer Regierung von Hindu-Nationalisten. Die britischen Kolonialherren sind schon lange weg, aber wir Inder reproduzieren selbst den Rassismus, den sie gebracht haben."
Rassismus als anthropologische Konstante?
Étienne Balibar: "Rassismus durchdringt den gesamten Alltag von der Wohnungssuche über das Bildungssystem bis hin zur Liebe, sodass sich die Frage stellt, ob es überhaupt einen Lebensbereich gibt, der nicht von ihm erfasst wird."
Manuela Bojadzijev: "Es ist natürlich auch die Weise, wie unser Leben funktioniert. Das ist die Weise, in der wir wissen, wen heiraten dürfen und wen nicht, wer unsere Sprache spricht und wer nicht, wer gehört zu uns und wer gehört nicht zu uns. Wenn man jetzt hierzulande mal guckt, dann ist die Frage, ob man in eine katholische Familie aus einer evangelischen heraus heiratet, einst eine massiv umstrittene Praxis gewesen. Heute spielt dann eine Rolle: Ist die Person schwarz oder weiß, ist sie Muslima oder nicht, müssen wir jetzt konvertieren oder nicht, etc.?"
Konjunkturen von Rassismus und Widerstand
Dennoch verneinen aber sowohl Étienne Balibar als auch die Lüneburger Kulturwissenschaftlerin Manuela Bojadzijev vehement die Frage, ob Rassismus wenn schon nichts natürliches, dann doch so etwas wie eine anthropologische Konstante sein könnte, die sich mal mehr, mal weniger bemerkbar mache.
"Wenn wir sagen, wir leben in einer gefährlichen Konjunktur, dann hat das ein bisschen den Zungenschlag, als hätte sich der Rassismus schon massiv durchgesetzt. Ich glaube, es ist anders rum. Der Rassismus hat im Augenblick eigentlich gar nicht so eine gute Stellung. Die Geschichte des Rassismus ist ja auch die Geschichte des Widerstands gegen ihn. Und zwar ist der meistens dann erfolgreich, wenn tatsächlich Solidaritäten praktiziert werden."
Wie zum Beispiel im Sommer 2015, als etwa eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Etwa 20 Millionen Bundesbürger haben sich seither in Initiativen für diese Menschen engagiert, berichtet der Soziologe Serhat Karakayali von der HU Berlin. Nicht alle sind dabei geblieben, aber die Solidarität mit Verfolgten sei heute viel breiter in der Gesellschaft verankert als vorher.
"Ich würde das so formulieren, dass ganz viele Menschen dazugekommen sind, die zumindest in diesem Bereich sich noch nie engagiert hatten, weder ehrenamtlich, noch politisch oder anderswie. Das war eben früher eine Bewegung von jungen Leuten, die in Metropolen wohnen, viele sind Studierende und jetzt ist das, ja eine Bewegung, die eigentlich den Durchschnitt der Bevölkerung abbildet."
Solidarität trotz Differenzen
Auch wenn Deutsche und Migranten sich in bester Absicht treffen, können sich schnell wieder Hierarchien bilden. Dennoch ist Serhat Karakayali überzeugt, dass solche Begegnungen dem Rassismus langfristig den Boden entziehen können.
"Ich denke, dass es natürlich Asymmetrien gibt. Die Idee dieser ehrenamtlichen Arbeit ist Integration. Also wir integrieren jetzt diese Leute hier. Dann ist natürlich die Verteilung von Kompetenzen in diesem Verhältnis immer noch asymmetrisch. Denn die einen wissen eben, wie man das alles hier macht, und die anderen wissen das nicht. Da gibt es aber viele Initiativen, die sich dessen bewusst sind, und die zum Beispiel eben sagen, wir wollen auch von euch was lernen, ihr habt ja auch Kompetenzen, und die sich darüber Gedanken machen, wie man die einbringen kann."
Entscheidend ist, dass über alle Unterschiede hinweg Beziehungen entstehen. In den Hochzeiten der Industrialisierung ergaben die sich für viele fast automatisch aus dem Gefühl heraus, einer gemeinsamen sozialen Klasse anzugehören. Auch heute sind Gewerkschaften noch immer die Organisationen, die in größter Zahl Migranten integrieren. Dennoch werden moderne Gesellschaften neue Formen von Solidarisierung und Kooperation entwickeln müssen, damit sich Vereinzelte und Verunsicherte nicht in Rassismus und Nationalismus stürzen, wenn Sie Gemeinschaft suchen.