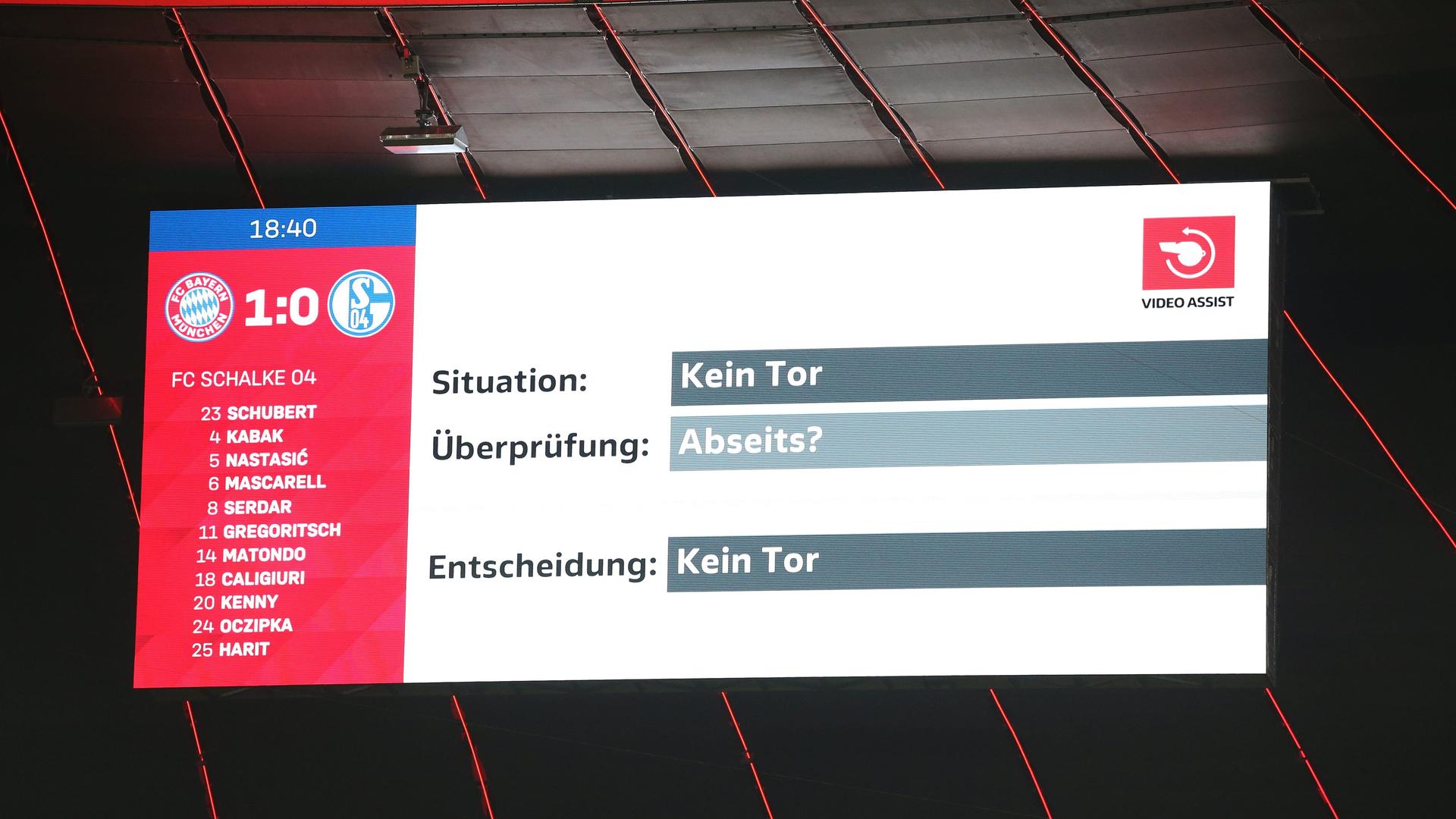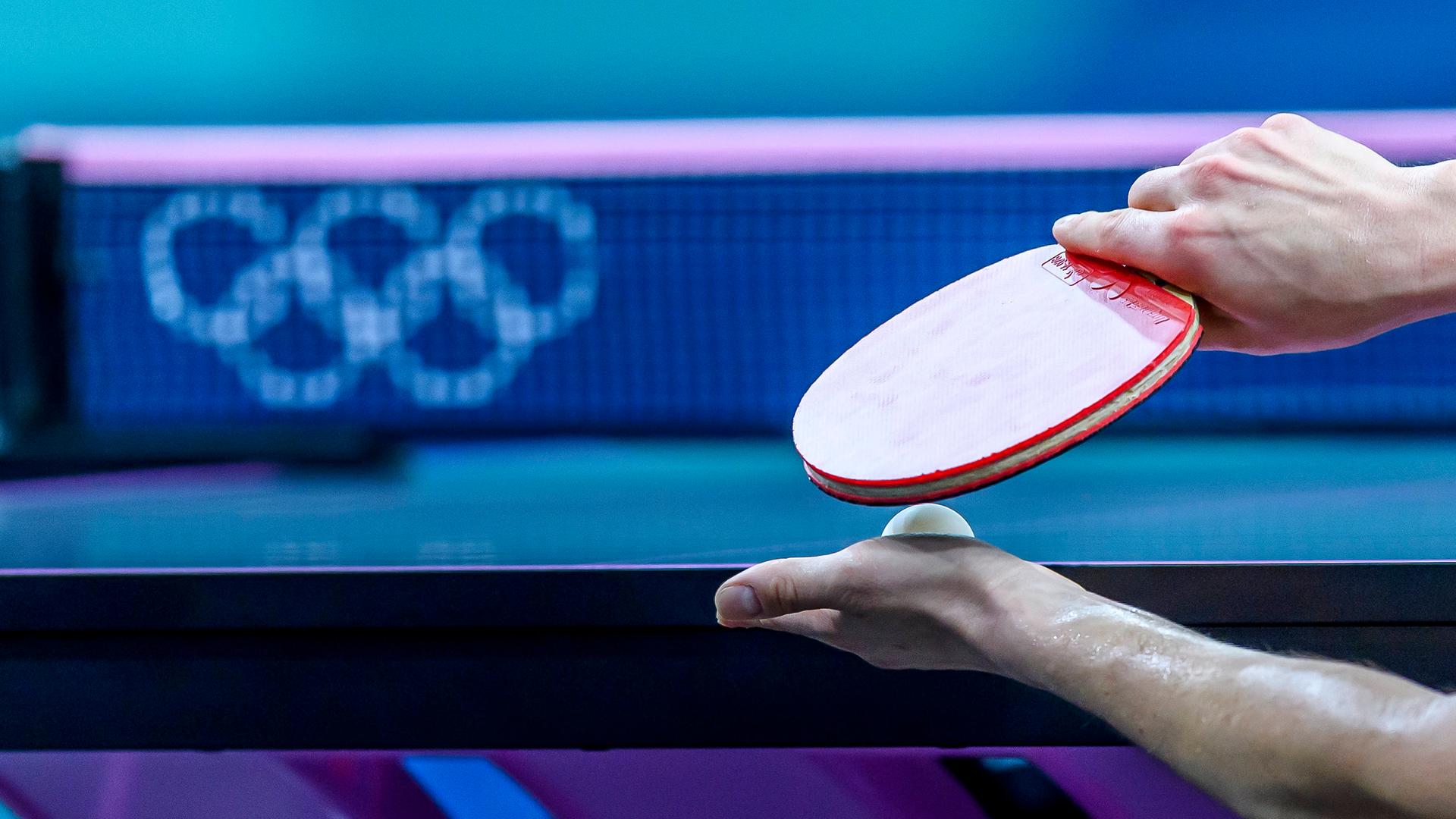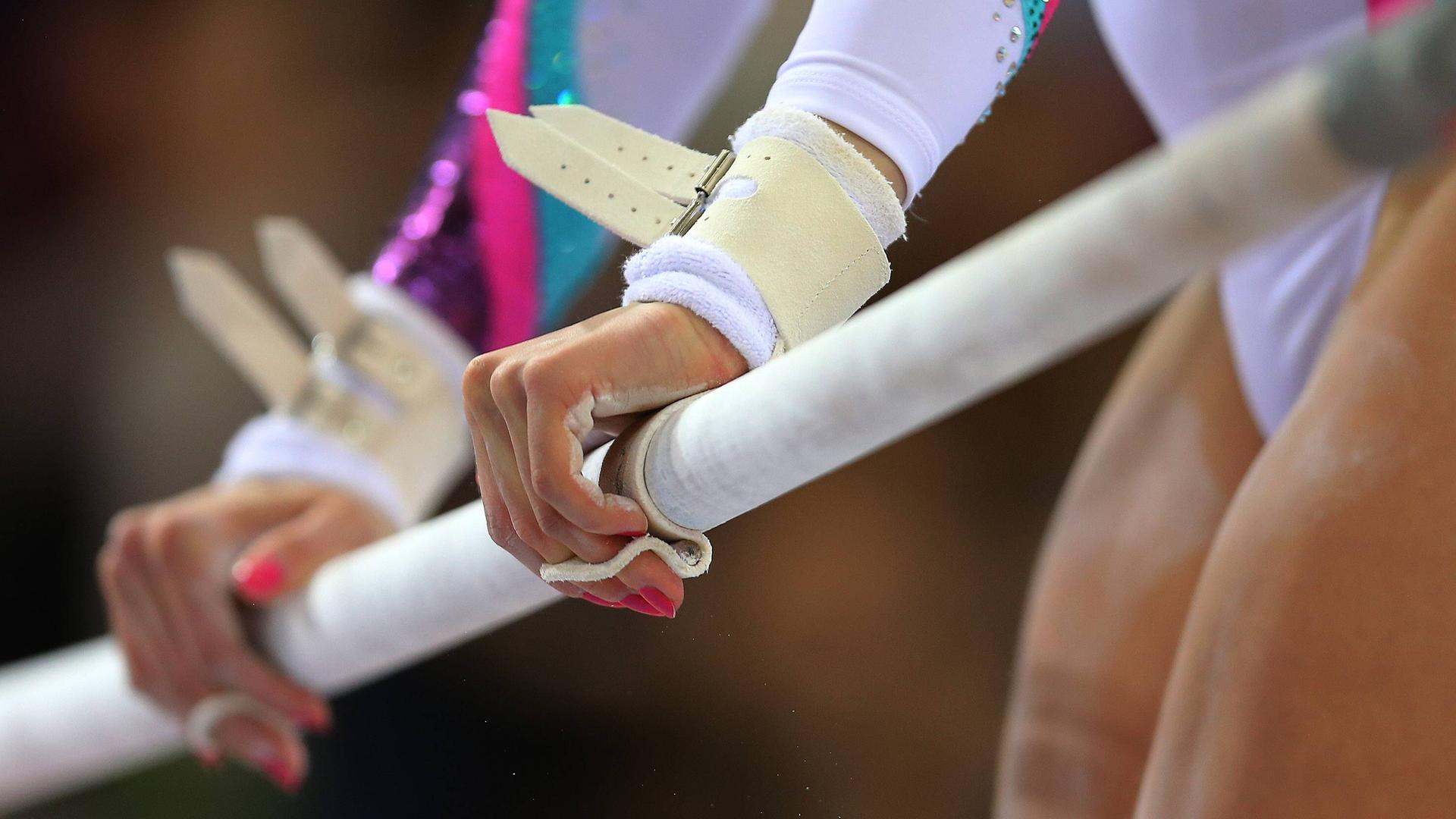Es ist eine der schwersten Verletzungen, die eine Sportlerin oder ein Sportler erleiden kann: Ein Kreuzbandriss. Die Heilungszeit dauert mehrere Monate, es fallen Kosten für Arzt und Reha an. Zumindest um diese Kosten brauchen sich Athletinnen und Athleten im Profisport keine Sorgen zu machen, denn die übernimmt die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft VBG, eine gesetzliche Unfallversicherung.
Dort sind alle Sportlerinnen und Sportler versichert, die mehr als 250 Euro im Monat mit ihrem Sport verdienen, insgesamt sind es rund 28.000. Die Versicherungsbeiträge zahlt der Arbeitgeber, also der Verein. Und weil statistisch gesehen jeder Versicherte einmal im Jahr eine Verletzung meldet, sind die Beiträge entsprechend hoch. Bis zu 30 Prozent des Bruttogehalts zahlen die Sportvereine, der Höchstbetrag liegt bei rund 35.000 Euro jährlich.
„Wir haben eine über viele Jahre bereits zugespitzte Finanzierungssituation, was die Beiträge des bezahlten Sports anbelangt“, erklärt Holger Niese vom Deutschen Olympischen Sportbund. „Es gibt einen so genannten Gefahrtarif, der für die nächsten Jahre schon festgelegt ist. Und der beinhaltet bei der ohnehin schon extrem angespannten Finanzlage in diesem Bereich noch weitere Steigerungen. Und wenn sie das alles zusammennehmen, bleibt ihnen nichts anders übrig, als die Systemfrage zu stellen.“
Das hat der DOSB getan, zusammen mit dem DFB, nachdem Vereine aus den Handball, Eishockey und Fußball-Bundesligen Musterverfahren gegen die VBG angestrengt hatten. Dazu haben sich in den vergangenen Monaten im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) der DOSB und andere mit der Vereinigung der Vertragsfußballspieler VDV und dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung in einer Arbeitsgruppe zusammengefunden.
Behandlungskosten sind immer gleich - egal ob für Profis oder Amateure
Die Forderung der Sportverbände: Geringverdiener im Profisport sollten keine Leistungen mehr aus der gesetzlichen Unfallversicherung erhalten. Erst, wer 20.000 Euro oder mehr verdient, sollte weiter gesetzlich versichert sein.
Die Überlegung: Egal ob in der Bundesliga oder Bezirksliga, die Behandlung eines Kreuzbandrisses kostet ungefähr das gleiche. Ein Bundesliga-Klub zahlt aber mehr ein als ein Bezirksliga-Verein – bezahlt also im Moment damit auch die Behandlung von unterklassigen Spielern mit. Das wäre nicht mehr der Fall, wenn die Geringverdiener im Sport nicht mehr Teil der gesetzlichen Versicherung wären.
Ein Vorschlag, der Widerstand hervorgerufen hat. „Als Spielergewerkschaft haben wir natürlich intensiv dafür gekämpft, die vom DOSB geforderten Leistungskürzungen zu Lasten der eigenen Sportler abzuwenden“, erklärt Ulf Baranowsky von der Vereinigung der Vertragsfußballspieler im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. „Wir haben uns auch leidenschaftlich dafür eingesetzt, dass Geringverdiener, also im Fußball insbesondere Frauen und unterklassige Spieler, nicht aus dem Versicherungssystem herausgedrängt werden.“
BMAS lehnt DOSB-Vorschlag ab
Denn mindestens die Hälfte der Sportler in der gesetzlichen Unfallversicherung gelten als Geringverdienende. Laut dem DOSB-Vorschlag sollten sie zum Beispiel über eine private Unfallversicherung abgesichert werden. Diesen Vorschlag hat das Bundes-Arbeitsministerium aber nach den Beratungen in der Arbeitsgruppe abgelehnt. In dem Abschlussbericht des BMAS, der dem Deutschlandfunk vorliegt, steht, dass die in dem Vorschlag vorgesehenen Maßnahmen zu Kostensenkungen nicht zu überzeugen vermögen. Wörtlich heißt es:
„Durch eine private Unfallversicherung (ist) keine finanzielle Entlastung der Vereine zu erwarten, sofern das Leistungsniveau der Unfallversicherung stabil gehalten werden und die Beitragslast nicht auf die Versicherten verlagert werden soll.“
Für die mehr als 10.000 Geringverdiener im Profisport ist das eine gute Nachricht – sie müssen vorerst keine teuren privaten Unfallversicherungen abschließen. Die Kosten bleiben bei den Vereinen. DOSB-Justitiar Holger Niese sieht den gescheiterten Vorstoß seines Verbandes trotzdem nicht als Niederlage an. „Man hat als BMAS sehen können, da gibt es gewisse Schieflagen. Das Problem ist nur, wie lösen wir diese Schieflagen. Und da war das Ministerium jetzt nicht bereit über seinen Schatten zu springen, und bestimmte Systemumstellungen zu vollziehen."
Prävention soll Verletzungsrisiko senken
Das BMAS spricht sich in dem Abschlussbericht dafür aus, die Anstrengungen bei der Ursachenbekämpfung zu verstärken. Das Risiko der Verletzung solle durch eine bessere Prävention gesenkt werden. Erste Pilotprojekte seien dafür schon auf den Weg gebracht worden.
Nach ersten Berechnungen können damit knapp 3,5 Millionen Euro eingespart werden. Bei Aufwendungen von jährlich rund 125 Millionen Euro für den Sport aus der gesetzlichen Unfallversicherung, entspricht das gerade einmal 3 Prozent. Dies führe zu keiner Entlastung, so das BMAS, sondern allenfalls könne damit einer Beitragssteigerung entgegen gewirkt werden. Alle in der Arbeitsgruppe beteiligten sehen dies jedoch als einen sinnvollen Schritt an.
„Die gesetzliche Unfallversicherung hat selbst festgestellt, dass durch eine bessere Prävention die Summe der Ausfalltage in den Mannschaftssportarten um ganze 75 Prozent reduziert werden könnte.“
Dazu zählt auch die Spielergewerkschaft VDV und ihr Geschäftsführer Ulf Baranowsky: „Wir sind also gut beraten, dieses enorme Sparpotenzial besser zu nutzen, und damit die Gesundheit der Sportler besser zu schützen. Wenn uns dies gelingen sollte, hätten am Ende doch alle etwas gewonnen.“