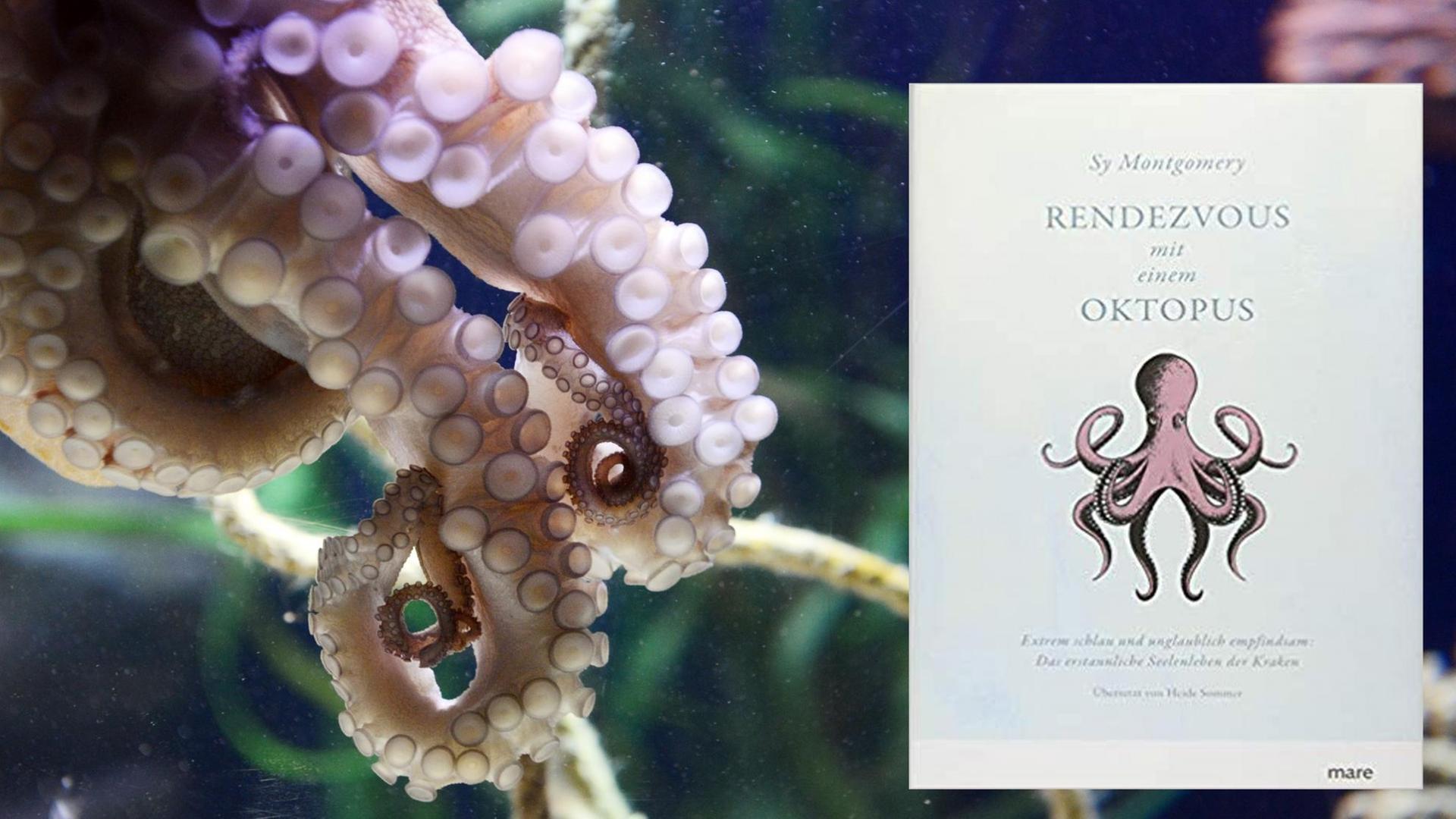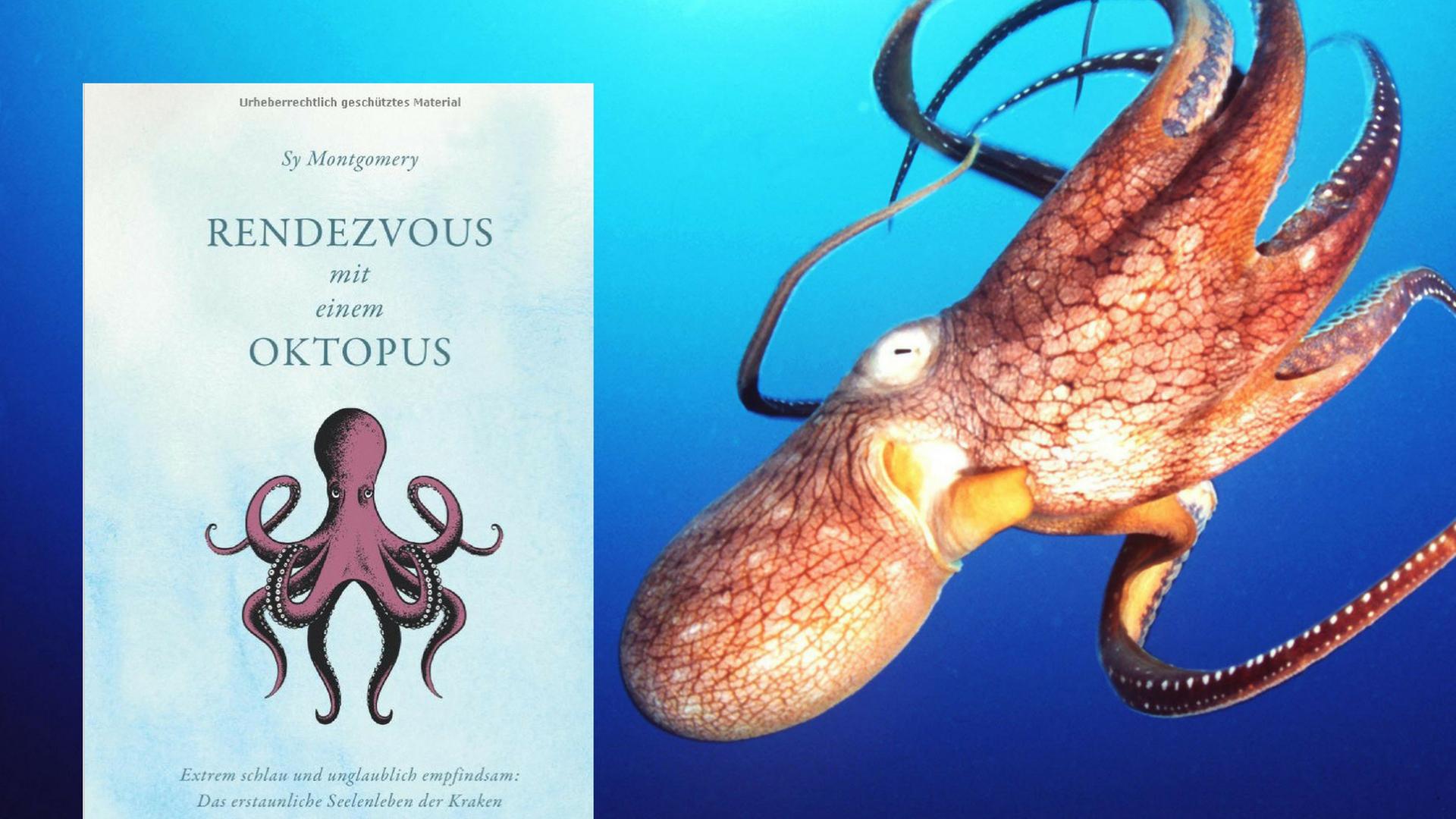Der Star des Labors drückt sich gerade an die Seite eines Beckens. Sepia officinalis, ein handtellergroßer Tintenfisch, bekannt für seine Tarnleistung. Theodosia Woo erforscht sie für ihre Doktorarbeit:
"In diesem Experiment zeigen wir dem Tintenfisch Naturbilder, Sand, Kiesel, Bäume. Ein Tintenfisch muss nicht wissen, was ein Baum ist, um sich anzupassen."
Unter dem Becken läuft ein Stoffband, über Kurbeln lässt sich das Motiv verstellen. Nachdem sich der Hintergrund geändert hat - von Sand zu Kies - passt der Tintenfisch seine Färbung an. Erst zeigen sich dünne Striche auf seiner hellen Haut, dann kommen allmählich dunklere Flecken dazu. Immer neue Naturaufnahmen zeigt Theodosia Woo dem Tintenfisch. Das Spiel der Farben und Muster wird von 24 Highspeed Kameras aufgezeichnet. Analysiert werden sie von Gilles Laurent, Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt:
"Sie müssen verstehen, das Tier kann sich frei bewegen, es atmet. Die Position einer einzelnen Farbzelle ändert sich ständig. Wir müssen sie durch die Aufnahmen von einigen Tagen oder Wochen hinweg verfolgen. In der Zeit wächst das Tier, neue Farbzellen entstehen. Es ist ein riesen Rechenaufwand, all das im Blick zu behalten."
Die Millionen Farbzellen in der Haut des Tintenfischs gleichen den Pixeln eines Farbbildschirms. Kontrolliert werden sie von Muskeln, die sie zusammendrücken oder auseinanderziehen. Und die Muskeln reagieren ihrerseits auf Nervenimpulse. Ob so ein biologisches Pixel ein- oder ausgeschaltet wird, bestimmen also letztlich Nervenzellen:
"Indirekt sehen wir uns das Gehirn an, ohne das Gehirn selbst abzubilden."
Nach und nach will Gilles Laurent aus den Farbspielen auf der Haut immer tiefere Ebenen des Tintenfisch-Gehirns rekonstruieren:
"Eine Hypothese ist, dass es Schichten aus Nervennetzen gibt. Man kann sich vorstellen, dass dann irgendwo ein paar Nervenzellen für Flecken zuständig sind, die wie Augen aussehen. Und wenn die aktiv sind, breitet sich ihr Signal durch die Schichten aus und am Ende bilden die Farbzellen eine Form, die einem drohenden Auge ähnelt."
Nachbildung von Regelmäßigkeiten auf der Tintenfisch-Haut
Das wäre die einfachste Organisationsform für das Gehirn des Tintenfischs und schon allein deshalb ist sie derzeit Gilles Laurents Lieblingshypothese. Wenn sich Tintenfische tarnen wollen, dann projizieren sie nicht etwa eine Art Foto der Umgebung auf die Haut. Ihre Augen registrieren, wie stark die Kontraste sind oder wie feinkörnig die Strukturen. Solche statistischen Regelmäßigkeiten werden dann auf der Haut nachgebildet. Um das zu können, müsste eine künstliche Intelligenz mit riesigen Datensätzen trainiert werden:
"Wir wissen, diese Tiere lösen ein komplexes Problem mit Hilfe eines genetischen Programms. Das deutet darauf hin, dass ihr Ansatz vergleichsweise einfach sein muss. Es ist eine verführerische Vorstellung, dass die Forschung an diesen Tieren Hinweise zur Lösung eines extrem komplexen Problems bietet."
Hier wird biologische Forschung auch für die Informatik relevant. Tintenfische nutzen ihre Farbsystem nicht nur zur Tarnung. Weibchen werden mit einem offenbar erotischen Schwarz-Weiß Muster angelockt, Rivalen dunkel abgeschreckt. Es gibt Jagdmuster, die sich verändern, je nachdem, ob die Krabbe oder der Fisch am Ende erwischt wird. Tintenfische tragen ihre Stimmung sozusagen auf der Haut. Die bunten Farben und die sich ständig wandelnden Muster helfen, die Organisation ihres Gehirns genauso zu verstehen, wie dessen Evolution.