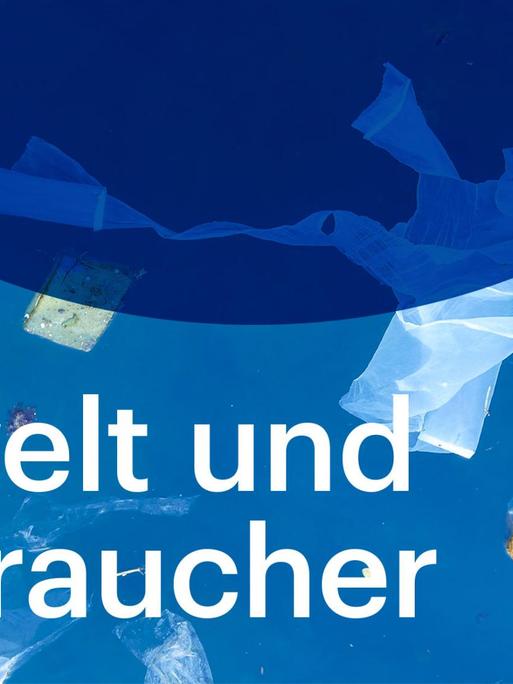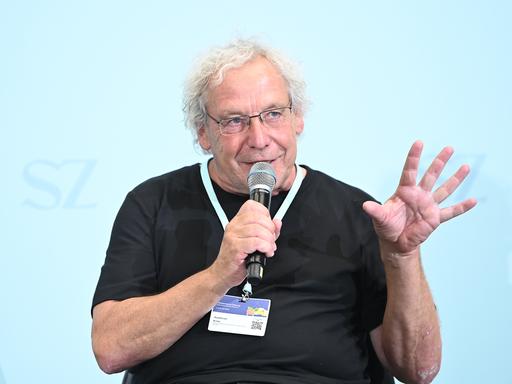Staus begleiten uns seit Jahrzehnten und es werden immer mehr. 2024 zählte der ADAC rund eine halbe Million Staus, 12.000 mehr als im Vorjahr. Besonders betroffen waren Nordrhein-Westfalen, Bayern und – gemessen an der Netzdichte – die Stadtstaaten, allen voran Berlin. Mehr Straßen sollen das Stau-Problem lösen. Doch die Eröffnung des neuen Abschnitts der Berliner Stadtautobahn A100 Ende August 2025 zeigte das Gegenteil: Auch dort bildeten sich sofort wieder Autoschlangen.
Ursachen für Staus
Jeder Autofahrer kennt es: Ein Stau entsteht – und man weiß nicht, warum. Schon kleine Bremsmanöver setzen sich im dichten Verkehr fort, bis das Tempo auf null sinkt. Solche „Phantomstaus“ entstehen selbst ohne Unfall oder Baustelle, eine Folge von Physik und menschlichem Verhalten.
Der Physiker Michael Schreckenberg und sein Kollege Nagel beschrieben dieses Phänomen bereits Anfang der 1990er-Jahre im Nagel-Schreckenberg-Modell: Wechselt ein Auto die Spur oder bremst leicht ab, reagiert das nächste etwas stärker, das übernächste noch heftiger – und so setzt sich die Bremswelle fort, bis schließlich alle stehen.
Weitere Ursachen für Staus sind ein wachsendes Verkehrsaufkommen, während die Infrastruktur zunehmend an ihre Grenzen stößt. Besonders zu Ferienzeiten oder während der Rush Hour sind mehr Autos auf den Straßen unterwegs. Auch Unfälle, Pannen oder Baustellen können zu Staus führen. Und selbst wer versucht, Staus zu umfahren, trägt dazu bei, dass sie an anderer Stelle entstehen.
Laut einer Analyse des Verkehrsdatendienstes INRIX verbrachten Autofahrer in Deutschland 2024 im Schnitt 43 Stunden im Stau – drei Stunden mehr als im Jahr zuvor. Am stärksten betroffen waren Düsseldorf mit 60 Stunden sowie Berlin und Stuttgart mit jeweils 58 Stunden. Das Stauproblem nimmt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu. Im globalen Ranking liegt Istanbul mit 105 Stunden an der Spitze, gefolgt von New York City und Chicago (jeweils 102 Stunden) sowie London mit 101 Stunden.
Wirtschaftliche Folgen
Während Milliarden in den Ausbau neuer Straßen fließen, wächst gleichzeitig der volkswirtschaftliche Schaden durch verlorene Zeit, Treibstoff und Emissionen. Der Physiker Michael Schreckenberg hat ihn berechnet: „Ein Stau von vier Kilometer Länge über drei Stunden auf einer zweispurigen Autobahn hat einen volkswirtschaftlichen Schaden von rund 100.000 € zur Folge.“
Neue Straßen bedeuten mehr Verkehr
Straßenbau gilt oft als Antwort auf Staus, doch Experten sehen das kritisch, darunter auch Verkehrsforscher Helmut Holzapfel. „90 Prozent aller Entlastungsstraßen führen am Ende zu mehr Verkehr“, sagt er. Ein entscheidender Grund: Durch den Bau neuer Straßen würden mehr Menschen mit dem Auto fahren, weil es für sie attraktiver sei. Es gehe schneller. Der öffentliche Nahverkehr werde weniger genutzt.
Man lege im Auto automatisch auch weitere Strecken zurück. Das habe Folgen für die Stadt: Wer bequem ins nächste größere Geschäft fahren könne, verzichte eher auf den kleinen Laden um die Ecke.
Auch die Wirtschaft nutzt die neuen Kapazitäten sofort. Holzapfel verweist auf die Logistikbranche: Wenn Straßen schneller seien, lohne es sich weniger, Waren zwischenzulagern. Am Ende bedeute das: noch mehr Verkehr.
„Wir nennen das als Fachleute Teufelskreis der Verkehrsplanung. Damit muss ein Ende sein“, so Holzapfel. Jede neue Autobahn produziere ein neues Nadelöhr – nämlich dort, wo sie ende. „Insofern müssten wir dann immer weiterbauen.“ Neben den Kosten der Neubauten komme auch die Wartung dieses riesigen Verkehrsnetzes an Straßen hinzu. Der Verkehrsforscher kritisiert daher auch den Ausbau der A100 in Berlin und bezeichnet dies als „ein Konzept der 50er Jahre.“
Auch internationale Forschung bestätigt diesen Mechanismus des sogenannten induzierten Verkehrs, zum Beispiel eine Analyse der University of California: Autofahrer unternehmen bei dem Ausbau neuer Straßen mehr Fahrten, legen längere Strecken zurück und wählen häufiger das Auto.
Weniger Autos, weniger Staus
Eine nachhaltige Lösung, um Staus zu bekämpfen, liegt nicht im Ausbau, sondern in der Verringerung des motorisierten Verkehrs. Die Entwicklung geht in Deutschland derzeit allerdings in eine andere Richtung. Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zeigen: Im Jahr 2024 legten die Menschen in Deutschland mit dem Auto rund drei Milliarden Kilometer mehr zurück als im Vorjahr. Der Grund dafür liegt nicht darin, dass einzelne Fahrzeuge häufiger genutzt wurden, sondern darin, dass insgesamt mehr Autos unterwegs sind.
Damit weniger Menschen auf das Auto angewiesen sind, braucht es attraktive Alternativen: Ein gut ausgebauter Nahverkehr, sichere Radwege, bezahlbare Sharing-Angebote, On-Demand-Shuttle-Services – und eine Stadtplanung, die kurze Wege ermöglicht. Stichwort: 15-Minuten-Stadt – also ein Konzept, bei dem alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar sind. Dazu zählen zum Beispiel Arztpraxen, Kitas, Supermärkte oder Freizeitangebote.
Positive Beispiele für eine nachhaltige Stadtentwicklung gibt es auch in Deutschland, etwa in Tübingen oder Frankfurt, wie Verkehrsforscher Helmut Holzapfel betont. Und im Ausland zeigt Paris, wie eine Verkehrswende funktionieren kann: In den vergangenen Jahren wurden dort ganze Straßen für den Autoverkehr gesperrt, massiv in Fahrradwege investiert und die Zahl der Autoparkplätze deutlich reduziert. Das Ergebnis: Nur noch 4,3 Prozent der Wege in der französischen Hauptstadt werden mit dem Auto zurückgelegt.
Tempolimit als Lösung?
Auch Tempolimits oder intelligente Steuerungen können den Verkehrsfluss stabilisieren. In Deutschland wird häufig befürchtet, dass ein generelles Tempo 30 in Städten den Verkehr stark ausbremsen könnte. Doch eine Untersuchung des Umweltbundesamtes kommt zu einem anderen Ergebnis: Wenn Autos in einer Stadt nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren dürfen, verbessert das den Verkehrsfluss sogar. Weniger abruptes Bremsen und Beschleunigen, gleichmäßigere Fahrweise und weniger Staus sind mögliche Gründe dafür.
„Die wissenschaftlichen Fachgemeinschaften sind sich eigentlich da schon seit Jahrzehnten einig, dass, wenn wir ein Tempolimit hätten, wir weniger Staus hätten, weniger Unfälle und sogar noch eine Absenkung der Schadstoffemissionen erwarten könnten“, sagt Mobilitätsforscher Andreas Knie.
Trotz all dieser Maßnahmen: Ganz lösen wird man das Stauproblem Problem allerdings nie, meint Physiker Michael Schreckenberg, vor allem in Bezug auf die Phantomstaus. „Staus sind etwas ganz Natürliches. Es wird sie immer geben.“
Elena Matera