
Deutschland als Sehnsuchtsland - so kann man es als Deutscher nur darstellen, wenn man sich eine Maske aufsetzt, zum Beispiel die eines Deutsch-Amerikaners. Das zumindest tut Steffen Kopetzky in seinem Roman "Propaganda". Gleich zu Beginn lässt er seinen Helden, den Erzähler dieser Geschichte, die in der Tat etwas Märchenhaftes und somit Grunddeutsches an sich hat, gleich zu Beginn lässt er diesen John Glueck aus dem fernen New York seinen Fuß auf deutsche Erde setzen, lässt ihn, begleitet von einem erhabenen Schauer, erstmals das mythische Land seiner Vorfahren betreten.
Die Umstände allerdings sind ganz und gar nicht heimelig. Wir schreiben das Jahr 1944 und John Glueck kommt als Soldat nach Deutschland, genauer: als Offizier der Abteilung für Psychologische Kriegsführung, kurz Sykewar.
"In dem gewaltigen Apparat von 'Sykewar' gab es alles an Medienprodukten, was man sich nur vorstellen konnte. Ende 1943 war der ganze Apparat nach London gezogen. Ich war Leutnant und arbeitete unter den Fittichen von Major Ganz in der Londoner Redaktion von 'Sternenbanner'. Mit einer Druckauflage von vier Millionen Exemplaren war 'Sternenbanner' die größte deutschsprachige Tageszeitung der Welt, wie wir selbstbewusst vorne auf dem Titel bekannt gaben. Sie hatte vier Seiten, wurde von Flugzeugen über dem deutschsprachigen Teil des Großdeutschen Reiches abgeworfen, also über dem Altreich und Österreich, und wollte eine seriöse Zeitung sein, die über alles Wichtige berichtete. Ich war einer der Literaturspezialisten."
Eifel-Indianer
Soldat und Literat: das macht die Geschichte John Gluecks so plausibel, denn Steffen Kopetzky hat sich mit "Propaganda" gleich zwei Dinge vorgenommen, die nicht so einfach zu verbinden sind. Er möchte einen historischen Roman erzählen, der sich auf harte Fakten stützt, und er möchte zugleich einen spannenden Abenteuerroman darbieten, für den das Plausibilitätsgebot längst nicht im gleichen Maße gilt wie für den historischen Roman. Historischer Roman wie Abenteuerroman wurzeln, das haben sie immerhin gemein, beide im 19. Jahrhundert, und hier könnte man leicht eine Legion an Vorbildern und Vorläufern Steffen Kopetzkys anführen, von Stendal über Tolstoi bis James Fenimore Cooper, Karl May und Jack London.
"Propaganda" spielt freilich nicht im 19., sondern im 20. Jahrhundert, und wie schon in "Risiko", seinem Roman über den deutschen Dschihad im 1. Weltkrieg, möchte Kopetzky überdies zeigen, wie virulent viele Probleme aus dieser und jener Zeit noch in unserem, dem 21. Jahrhundert sind. Ein großer Anspruch also.
Glücklicherweise verbindet Kopetzky damit nicht einen weiteren, einen ästhetischen Anspruch. Es geht ihm nicht um sprachliche Brillanz und formale Kühnheit. Sprache wie Aufbau des Romans sind vielmehr dem Genre, bzw. den Genres, denen sich Kopetzky verschrieben hat, angemessen, und nicht zuletzt ist Kopetzky immer bereit eine Pointe, wenn sie sich bietet, auch mitzunehmen.
"Wenn ich daran denke, wie alles begann, sehe ich mich vor einem Lastwagen stehen, der mehr als zwei Tage ohne Unterbrechung gelaufen war. Wir schrieben Oktober 1944 in der Nordeifel, einem zerklüfteten Mittelgebirge, das in den Karten unserer Armeeführung 'Huertgen Forrest' genannt wurde, weil man nicht wusste, wie die Deutschen es nannten. Nicht einmal Experten wie mir war bekannt, dass dieses Waldgebiet bei den Einheimischen eigentlich bloß 'Staatsforst' hieß. Hürtgen war ein Dorf mittendrin, dessen Name wir kannten. So wurde daraus der 'Huertgen Forrest', genau wie wir einstmals ein neues Territorium einfach nach dem Indianerstamm benannten, mit dem wir es dort zuerst zu tun bekommen hatten."
Ein Journalist und zukünftiger Schriftsteller also erzählt von einer Schlacht im 2. Weltkrieg, die hierzulande nur Wenigen ein Begriff ist, die in Amerika allerdings als die verlustreichste und am schlechtesten geführte Schlacht gilt, die amerikanische Truppen in Westeuropa geführt haben. Und er erzählt unter der Hand eine ganze Geschichte der Literatur - indem er einerseits klar zu erkennen gibt, in welcher Tradition seine Geschichte steht, indem er, John Glueck, andererseits aber auch von ganz realen Schriftstellern seiner Gegenwart erzählt, von Ernest Hemingway, zu dem wir noch kommen werden, von Charles Bukowski und Jerome David Salinger, mit denen gemeinsam Glueck Anfang der vierziger Jahre ein Schreibseminar in New York besucht, bevor sich seine und Salingers Wege dann wieder im Hürtgenwald kreuzen.
Ein Beobachter mit Mission
Es wurde behauptet, Kopetzkys John Glueck ähnele Forrest Gump, dem so freundlichen wie einfältigen Held des gleichnamigen Kinofilms. Beide begegnen sie auf ihrem Weg durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts einer Vielzahl historischer Persönlichkeiten, das stimmt. John Glueck aber ist kein gutherziger und liebeskranker Tropf wie der Kinoheld, er ist vor allem ein Beobachter, am Ende sogar ein Beobachter mit Mission. Denn erzählt wird die Geschichte des Kampfes im Hürtgenwald aus der Perspektive des Jahres 1971 heraus. Auch das eine scheinbar ferne Zeit, aber es ist das Jahr, in dem ein gewisser Daniel Ellsberg jene Dokumente an die Öffentlichkeit bringt, die sogleich die Pentagon Papers genannt werden, geheime Dokumente aus denen hervorgeht, dass der Vietnam-Krieg nicht zu gewinnen ist und die tatsächlich entscheidend zum Ende desselben beigetragen haben. Ellsberg also ist ein früher Whistleblower, vielleicht der erste überhaupt, ein Vorbild für Edward Snowden oder Chelsey Manning.
Lange ist in "Propaganda" unklar, ob John Glueck selbst dieser Daniel Ellsberg ist. Auf jeden Fall provoziert er in einem kleinen Ort in Missouri seine Verhaftung, um im Staatsgefängnis vor den Bundesbehörden sicher zu sein. Hier schreibt er nun, der er immer ein Schriftsteller werden wollte, sein erstes Buch. Denn nur durch seine Lebensgeschichte und das, was er im Hürtgenwald erlebte, sei sein Handeln in der Gegenwart nachvollziehbar.
Eine Autobiographie also, die aber doch alle Elemente des Romanhaften versammelt, ganz als bräche sich hier die eigentliche Berufung des Propaganda-Offiziers und Whistleblowers John Glueck Bahn - John Glueck, der sehr viel Glück gehabt hat im Hürtgenwald, der in den Wäldern Vietnams aber in einen Tümpel aus Agent Orange fiel und seitdem eher einem amphibischen Schuppenwesen ähnelt.
"Es gäbe vermutlich nicht viele komische Romane, wenn ihre Autoren während der Niederschrift immer heiteren Sinns sein müssten. Wenn ich genauer darüber nachdenke, dann erkenne ich, dass es überhaupt nur sehr wenige komische Romane gibt, die wirklich gelungen sind. 'Catch-22' ist sehr lustig – allein schon 'Major Major Major' oder 'Captain Scheißkopf' und seine Frau, die mit jedem im Regiment schläft, nur nicht mit ihm. (…) Wenn aus dem hier jemals ein Roman werden sollte, dann hoffe ich, dass seine Leserin hier und dort etwas findet, das sie zum Lachen reizt, auch wenn das Thema gar nicht unbedingt zum Lachen ist. Mir selbst war die letzten zehn Tage jedenfalls zum Heulen zumute, dazu kam eine wirklich ekelhafte Verschlechterung meines körperlichen Zustandes. Eine deprimierende Tiefphase. Ich leide, wenn ich denn schlafen kann, unter Albträumen, aus denen ich unter Fieberschüben, Schüttelfrost, verschwitzt und schuppig erwache. Es lösen sich klebrige Schuppenstücke, die so eigenartig und fremd aussehen, dass ich schluchzen könnte. Es ist nicht leicht, Snakeman zu sein."
Voll auf Pervitin
John Gluecks Wunsch ist nicht vermessen, es findet sich durchaus die ein oder andere Stelle, die zum Lachen reizt. Kleine, ans Alberne grenzende Pointen wie die, dass es durch einen Zufall gerade John Glueck ist, der seinem Namensvetter John F. Kennedy in phonetischer Umschrift den Satz "Ich bin ein Berliner" mit auf den Weg gibt. Insgesamt aber ist es die Kühnheit, mit der sich Kopetzky seinen Stoff zurechtlegt, die den Leser heiter stimmt. Hier werden - auch wenn John Glück in der zitierten Passage die potentielle Leserin anspricht - Jungenträume wahr. Wer wäre nicht gerne mit Ernest Hemingway in die Schlacht gezogen? Glueck auf jeden Fall tut es, und mit ihm der Leser.
Als Literaturspezialist der Abteilung für Psychologische Kriegsführung wird er nach Frankreich entsandt, um den berühmtesten aller amerikanischen Schriftsteller zu suchen und für das "Sternenbanner" eine große Reportage über ihn zu schreiben. Die ganzen Hitlerjungs, meint sein Vorgesetzter, sollen später sagen können: Hey, gegen diesen großartigen Kerl habe ich gekämpft! Goethe? Thomas Mann? Wir geben ihnen Hemingway.
Zuerst aber bekommt John Glueck selbst eine volle Ladung Hemingway ab. Gleich bei der ersten Begegnung mit ihm gerät er in eine Schlägerei, bald darauf, zu einer Art Adjutanten des baldigen Nobelpreisträgers geworden, kommt das übrige Männlichkeitsinventar hinzu: Alkohol, Drogen (in Gestalt von Pervitin-Tabletten), Frauen.
Alle nur allzu wahren Hemingway-Klischees aufzurufen gelingt Kopetzky, ohne selbst einen Hemingway-Roman zu schreiben. Er umgeht geschickt jedes machistische Männlichkeitsgetue. Der Autor ist sich sehr bewusst, in welcher und für welche Zeit er seinen historischen Roman schreibt. MeToo-Aktivisten dürften darin nichts zu bekritteln finden. Viele Frauenfiguren finden sich freilich auch nicht gerade in "Propaganda", aber das geht mit der Natur des Kriegs einher, namentlich des Zweiten Weltkriegs und der Schlacht im Hürtgenwald.
"Man mag, wenn man an einen unheimlichen dunklen deutschen Wald denkt, ein urtümliches wucherndes Gehölz vor Augen haben, aber försterlich gepflanzter deutscher Plantagenwald im Alter von etwa hundert Jahren – ein Oberförsterwald sozusagen – wie der, durch den ich jetzt lief, kann noch viel schrecklicher sein. Wie oft war ich Van Senecas Spur gefolgt und hatte der Leichtigkeit vertraut, mit der er seinen Weg gefunden hatte. Nun war ich alleine, bald vom Waldweg abgekommen, und fand mich mitten im tiefsten Unterholz wieder, in dem verdammten, hundertjährigen Untergeäst, das durch die dichte Bepflanzung entsteht und einen panisch machen kann, wenn man sich, noch dazu in tiefer Dunkelheit, hindurchzukämpfen versucht. Bald hatte ich meine Wehrmachtsoffiziersmütze und den Verband verloren, und irgendwann bemerkte ich, dass die Naht meiner Stirnwunde aufgerissen war. Das warme Blut rann heraus und verschmierte mein vom Regen nasses Gesicht. Die Zweige zerrten an mir, als wollten sie mir erst die Augen und dann das Fleisch wegkratzen, um meinen Schädelknochen freizulegen. Aber das spielte alles keine Rolle, weil ich dorthin wollte, wo ich Schmidt vermutete."
Schmidt ist in diesem Fall keine Person, sondern ein Ort. Ein Ort in der Eifel, und wer Schmidt kontrolliert, kontrolliert die Ruhrtalsperre. John Glueck ist gerade aus deutscher Gefangenschaft entkommen, in die er für ein paar Stunden geraten war, ein paar Stunden, in dem auf dem Schlachtfeld, bei dem es sich eben um einen äußerst unwegsamer Schlachtwald handelt, Entscheidendes passiert ist.
Kopetzky hält sich eng an den tatsächlichen Verlauf der Schlacht, ohne dass man jemals das Gefühl hätte, einem militärhistorischen Referat zu folgen. Das Geschehen wird von Kopetzky gekonnt dramatisiert und bildet das Zentrum des Romans. Dabei widersteht Kopetzky der Versuchung, diesen Höhepunkt, wie in Spannungsromanen häufig der Fall, allzu lang hinauszuzögern. "Zentrum" heißt in diesem Fall nicht, dass das Hauptereignis genau in der Mitte des Romans steht, es erstreckt sich vielmehr über fast zweihundert Seiten, wobei die Erzählung hin und wieder durch die Jetztzeit des Jahres 1971 unter- bzw. gebrochen wird.
Informiert man sich ein wenig über die Geschichte der Schlacht im Hürtgenwald, wird einem klar, dass man sie eigentlich gar nicht farbig genug schildern kann, so katastrophal war ihr Verlauf. Kopetzky, der spürbar Freude an seinem Gegenstand hat, hält sich jedoch, was die Beschreibung der Gewalt und des Elends der Soldaten angeht, die tage- und wochenlang in Erdlöchern verharren, bis sich ihnen die Füße auflösen und Schlammwasser, fast noch zurück. Sicher, es gibt das ein oder andere krasse Bild, aber der Autor bleibt doch im Rahmen dessen, was man einem Fünfzehn- oder Sechzehnjährigen zumuten würde.
Todesfall Schmidt
Und er erzählt eine echte Indianergeschichte. Nicht die von deutschen Indianern, die von amerikanischen GI-Siedlern befriedet, bzw. besiegt werden, sondern die Geschichte des Indianers Van Seneca, dessen Name so unwahrscheinlich ist, wie sein Erscheinen im Hürtgenwald. Ob er in der sogenannten Wirklichkeit des Jahres 1944 existiert hat, und sei es nur als Gerücht, spielt keine Rolle, denn besser hätte sich die Wirklichkeit diese Figur nicht ausdenken können. Ein Indianer, der Jura und Philosophie in Oxford und später, so erzählt die Rothaut John Glueck am Lagerfeuer, Staatsrecht in Harvard studiert hat. Zugleich aber doch ein Indianer durch und durch, einer, der keinen Schmerz spürt, der Fährten lesen kann, der sich im Dunkeln bewegt wie eine Katze, und der sich den Skalp seines Feindes holt, um ihn den Müttern seines Stammes darzubringen. Dieser Feind allerdings heißt nicht General Custer, er heißt General Model. Dieser Feind ist die deutsche Wehrmacht.
Zwischen Van Seneca und John Glueck entsteht eine Freundschaft wie die zwischen Ismail und Queequeg in Melvilles Moby Dick - bis hin zu der Art und Weise wie sie gemeinsam, eng umschlungen einschlafen.
"Ich spürte, wie die Pilze (später habe ich gelernt, dass es Spitzkegelige Kahlköpfe waren), deren Kaltauszug Van Seneca mir zum Frühstück verabreicht hatte, mir dabei halfen: was gewesen war, zu vergessen, zu einem Teil des Waldes zu werden, mich dem Boden aus toten Fichtennadeln anzupassen, über den wir schlichen, und es zuzulassen, dass diese Perspektive und dieses gebückte Gehen mir zur Normalität werden konnte, sogar noch, als wir schon fast krochen. Der Wald, durch den wir uns langsam nach vorne arbeiteten, hatte mit den Wäldern des amerikanischen Kontinents nichts und schon gar nichts mit den herrlichen Landschaften in Yaphank, Long Island, New York zu tun. (…) Immerzu überstieg man im Hürtgenwald kleine Quellen und Wasserläufe, zuweilen nur winzige, der Schattenfurche einer Schlange gleichende Rinnsale. Im frostigen Spätherbst des Jahres 1944 waren diese Kleinen Wasser gerade in der Nacht eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle. Aber sogar hier erwiesen sich Van Senecas Mokassins als vorteilhaft. Er spürte die Temperatur des Bodens durch seine Sohlen, und er konnte entscheidende Unterschiede in der Härte des Untergrunds erspüren. Wie auch manch andres in der Erde Verborgene."
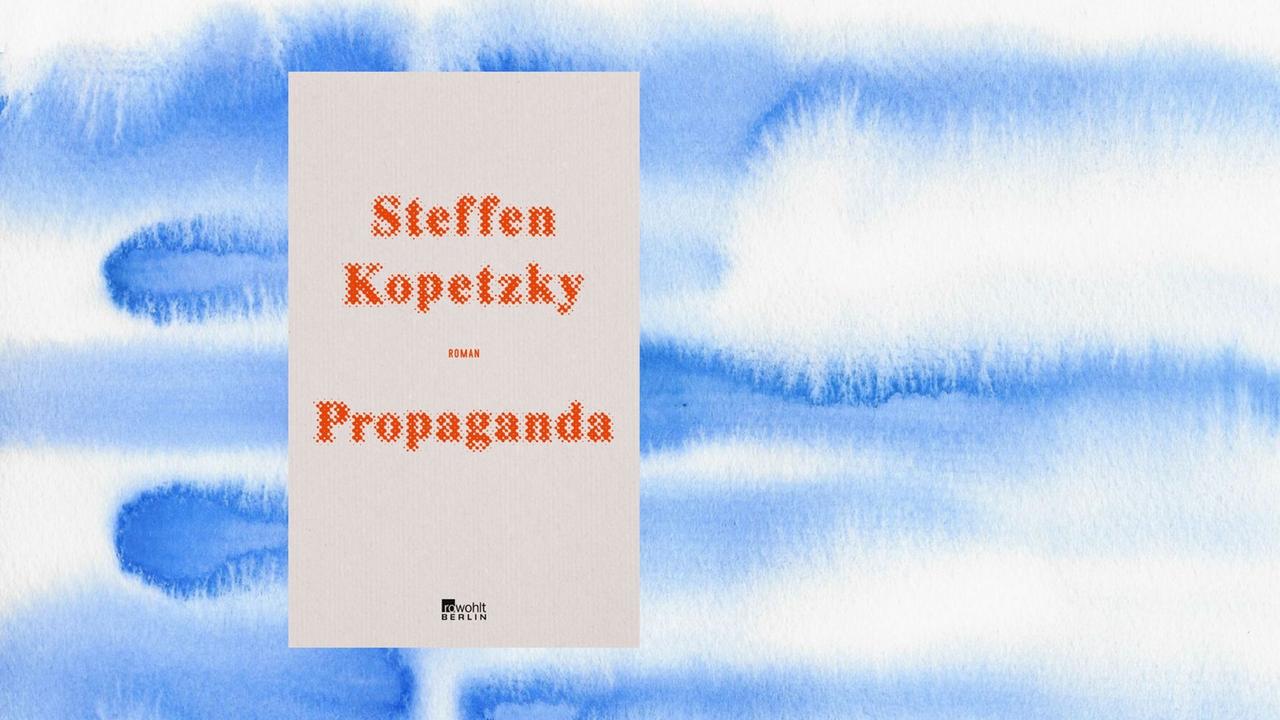
Die Tage mit Van Seneca sind die letzten Tage einer wie auch immer gearteten Unschuld. Dann kommt der Befehl, den Ort Schmidt einzunehmen, und mit ihm nimmt das Verhängnis seinen Lauf.
Ernest Hemingway hat über die Schlacht im Hürtgenwald ausführlich geschrieben, nachzulesen in dem Band "49 Depeschen", aber auch in seinem Roman "Über den Fluss und in die Wälder" kommt er auf das Ereignis zu sprechen. Es hat den kriegsbegeisterten Hemingway - dessen Ruhm auf seinen Erlebnissen im ersten Weltkrieg beruht, und dessen Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg seinerzeit schon legendär war, wie überhaupt die Jahre in Spanien für die schönste Zeit des Leben waren - tief erschüttert.
Niemals zuvor hatte die US-amerikanische Armee einen Waldkrieg geführt, so war sie nicht im geringsten vorbereitet. Die Wehrmacht dagegen hatte reichlich Erfahrung in unwegsamem Gelände und konnte, russlanderfahren, wohl auch besser mit der Kälte und den heftigen Regenfällen, die bald in Schnee übergingen, umgehen. Geschätzte 12.000 US-amerikanische Soldaten starben im Hürtgenwald, davon allein knapp 7000 beim Kampf um Schmidt.
Es zeigte sich, und das fasziniert Kopetzky besonders, dass die deutschen Generäle taktisch sehr viel klüger und flexibler auf die Situation reagierten als die US-Amerikaner, die Befehle ihrer Vorgesetzten zu befolgen hatten, die diese in völliger Unkenntnis der Gegebenheiten aussprachen.
Nicht der grausame Kampf selbst also, sondern seine Unsinnigkeit, die Tatsache, dass er hätte vermieden, an anderer Stelle besser hätte geschlagen werden können, machen John Glueck, wenn nicht zu einem neuen Menschen, so doch zu jenem Mann, der dabei hilft, die Pentagon Papers an die Öffentlichkeit zu bringen, weil aus ihnen hervorgeht, dass die Mächtigen des Jahres 1971 dasselbe tun wie Eisenhower 1944 im Hürtgenwald: Menschenleben zu opfern in einem Kampf, der nicht zu gewinnen ist. Auch der Vietnamkrieg war ja ein Wald-, das heißt ein Dschungelkrieg.
Das Moralpotential
So hat dieser Abenteuerroman auch eine moralische Dimension - und entspricht damit genau den Anforderungen des Genres. Es taucht sogar eine moralische Lichtgestalt auf, ein deutscher Arzt, der in dem Fichten-Inferno ein Feldlazarett errichtet und sowohl deutsche als auch US-amerikanische Verwundete versorgt. Günter Stüttgen heißt er, und es hat ihn wirklich gegeben.
"Ich schwöre, niemals etwas Schaurigeres wahrgenommen zu haben als die Hunderte Stimmen der Verletzten, die zwischen den zerfetzten Baumstämmen lagen, in Granattrichtern oder auf dem verbrannten Erdboden und die um Hilfe flehten, winselten oder mit kaum verständlichen Worten wehklagten. Erst hörte es sich für mich an wie ein seltsames und unheimliches Windsäuseln, aber dann begriff ich, dass dieser Wind aus einem Chor des Leidens bestand, aus den Stimmen geschundener Körper, gequälter Seelen, die ein böses Geschick ins Inferno dieses Waldes geschickt hatte, junge Kerle und alte Haudegen, Deutsche und US-Amerikaner nebeneinander. Kopf an Kopf. Die Frontlinien hatten sich während des Gemetzels derart ineinandergefressen, sich ineinander verschlungen, dass etwas Drittes entstanden war, ein entsetzliches gemeinsames Leidensfeld, ein Bürger- und Bruderkrieg. 'Gott', sagte ich mit gebrochener Stimme zum Doktor, 'was sollen wir bloß tun?'"
Es ist für Nachgeborene nicht einfach, über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben, aus vielen Gründen. Einer davon: Es gibt so viele große Romane und Erinnerungstexte von jenen, die den Krieg selbst miterlebt haben. Genreromane allerdings haben nur die wenigsten Zeitzeugen verfasst. Hier erkannte Kopetzky noch Potential. Zudem ist es ihm gelungen, die Brücke zu schlagen in unsere Zeit. Nicht nur das Phänomen des Whistleblowers interessiert uns heute mehr denn je, auch die Frage, wo objektive Berichterstattung aufhört, Propaganda anfängt und zu Fake News wird, ist seit langem virulent. So könnte man Kopetzkys Roman höchstens vorwerfen, dass er zu gut funktioniert - schließlich stellt sich sogar heraus, dass Günter Stüttgen Hautarzt ist und so etwas wie die letze Hoffnung für das Agent-Orange-Opfer John Glueck. Aber auch wenn in "Propaganda" alles ineinanderpasst und läuft wie geschmiert: Kopetzky beweist, dass großes Lesevergnügen und bloße Wohlfühlliteratur nicht unbedingt dasselbe sind.
Steffen Kopetzky: "Propaganda"
Verlag Rowohlt Berlin. 496 Seiten, 25 Euro.
Verlag Rowohlt Berlin. 496 Seiten, 25 Euro.


