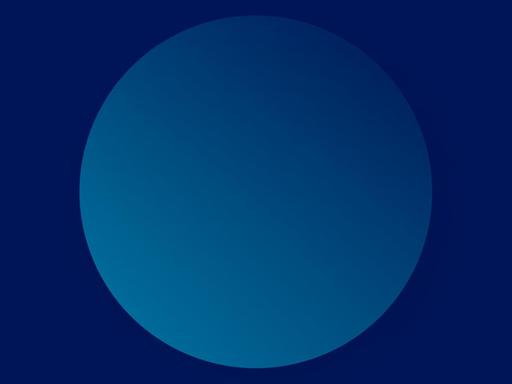Die Inselrepublik Taiwan hat eine demokratisch gewählte Regierung. Doch Chinas Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik - obwohl Taiwan seit Gründung des kommunistischen Staates 1949 nie unter Pekings Kontrolle war.
Regelmäßig droht China mit der „Wiedervereinigung“ und schließt Gewalt „keinesfalls“ aus. Militärmanöver und zunehmend hybride Formen der Kriegsführung erhöhen den Druck auf Taiwan.
Um Taiwan zu schützen, stellen vor allem die USA Militärhilfe zur Verfügung. Doch Präsident Trump hat seit seiner erneuten Amtseinführung keine weitere Lieferung genehmigt.
Peking ziehe in der Taiwan-Frage inzwischen auch gegenüber Drittstaaten die „Daumenschrauben“ an, um seine Interessen durchzusetzen, warnen Experten. In Taipeh gibt es die Sorge: Könnten die USA – und auch andere Länder – den Inselstaat für einen Deal mit China „opfern“?
Taiwan im Visier Chinas: Ideologie und Geopolitik
Die Volksrepublik China erhebt Anspruch auf die demokratische Inselrepublik Taiwan, da sie eine zentrale Rolle im ideologischen und geopolitischen Selbstverständnis der Kommunistischen Partei spielt. Der Anschluss Taiwans, den Peking als „Wiedervereinigung“ bezeichnet, gilt als Teil des „chinesischen Traums“.
Taiwan ist geostrategisch bedeutend: China will seine militärische Macht im Südchinesischen Meer und im gesamten Indopazifik weiter ausbauen. Taiwan liegt an der wichtigen Taiwanstraße, durch die täglich zahlreiche Containerschiffe Waren in alle Welt transportieren. Die Volksrepublik beansprucht auch die 180 Kilometer breite Meerenge als Teil ihrer Hoheitsgewässer.
Taiwan wird nicht als souveräner Staat anerkannt
Offiziell heißt Taiwan Republik China, wird aber von den meisten Ländern – darunter auch Deutschland – nicht als souveräner Staat anerkannt. Dennoch pflegt das demokratisch regierte Taiwan enge Handelsbeziehungen mit Europa und den USA. Ein Anschluss an China wird in der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnt; viele Taiwaner fürchten ein ähnliches Schicksal wie das von Hongkong.
Die Republik China wurde 1912 auf dem Festland gegründet, Taiwan – lange unter japanischer Kolonialherrschaft – gehörte ab 1945 dazu. Nach dem Bürgerkrieg flohen 1949 die Kuomintang unter Chiang Kai-shek nach Taiwan, während Mao Zedong die Volksrepublik China ausrief.
Seitdem existieren de facto zwei chinesische Staaten. Taiwan war zunächst weiter Mitglied bei den Vereinten Nationen, bevor es 1971 seinen Sitz an die Volksrepublik verlor. Dort beansprucht China nun, gemäß der Ein-China-Politik auch für Taiwan zu sprechen.
Taiwans Schlüsselrolle für die Weltwirtschaft
Von Smartphones bis zu Rüstungsgütern: Bei Halbleitern ist Taiwan Weltmarktführer. Das wichtigste Unternehmen ist TSMC. Mehr als die Hälfte der global produzierten Mikrochips stammt von der Insel. Bei den Hochleistungschips – etwa für KI-Anwendungen – liegt der Marktanteil sogar bei rund 90 Prozent.
Wie abhängig die Weltwirtschaft von der taiwanischen Halbleiterindustrie ist, zeigte sich spätestens während der Coronapandemie, als es zu großen internationalen Lieferkettenproblemen kam. Obwohl in den USA und auch in Europa vermehrt Produktionsstätten entstehen, bleibt Taiwan vorerst unersetzlich.
„Sashimi-Taktik“: Wie China Taiwan zunehmend unter Druck setzt
China setzt schon lange auf militärische Drohgebärden. Jahr für Jahr rücken die Militärmanöver näher an Taiwan heran, offener als früher droht Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit einem gewaltsamen Anschluss an die Volksrepublik.
Dabei belässt es Peking aber nicht. Der Militäranalyst Su Tzu-yun vom Institut für Nationale Verteidigung und Sicherheitsforschung in Taipeh spricht von „fortschreitender Sashimi-Taktik“. China erweitere zunehmend die Drohkulisse – etwa durch systematische Desinformationskampagnen.
Desinformationskampagnen und Cyberattacken
Neben Cyberattacken greife die Volksrepublik auch zum Mittel des „legal warfare“, berichtet Angela Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. China versuche, den komplizierten Status Taiwans immer weiter zu delegitimieren. „Da Taiwan beispielsweise selber kein Akteur ist bei den Vereinten Nationen oder auch anderen internationalen Organisationen, ist Taiwan hier besonders von der Unterstützung von Drittstaaten abhängig“, betont Stanzel.
Wie China Taiwan als Druckmittel gegen andere Staaten einsetzt
Wer etwas von China will, wie etwa Seltene Erden, muss sich auf Forderungen einstellen: "Wir unterschätzen, wie sehr China mittlerweile Bedingungen für ein angepasstes Verhalten in der Taiwan-Frage stellt", sagt Miko Huotari, Direktor des China-Instituts Merics in Berlin gegenüber Reuters. Dafür sei die Regierung in Peking auch bereit, diplomatische Kosten zu tragen.
Zu spüren bekam das auch Bundesaußenminister Johann Wadephul. Er sagte eine China-Reise kurzfristig ab, nachdem ihm von chinesischer Seite „keine hinreichenden Termine“ bestätigt worden waren – außer einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister.
Deutschland in einer "extrem schwachen Position"
Die kommunistische Führung habe versucht, Gesprächstermine an Vorbedingungen zu knüpfen, so Thorsten Benner vom Global Public Policy Institut. China ziehe offenbar die „Daumenschrauben“ an, weil es Deutschland in einer „extrem schwachen, unentschlossenen Position“ wähne. Die deutsche Industrie leidet unter anderem unter chinesischen Exportbeschränkungen für Seltene Erden und Computerchips.
Nach Medienberichten erwartete Peking von Wadephul, dass er kritische Äußerungen zur Politik der chinesischen Führung zurücknimmt, etwa zu den chinesischen Kriegsdrohungen gegen Taiwan. „China wird ganz grundsätzlich Beziehungen und einen guten Austausch daran knüpfen, dass sich Gesprächspartner nach chinesischen Positionen richten“, so Huotari.
Die USA und Chinas Drohgebärden
Am 30. Oktober 2025 einigten sich US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Busan unter anderem auf niedrigere Zölle und geringere Exportbeschränkungen für Seltene Erden. Trump sprach von einem „großen Erfolg“. Und: Taiwan sei kein Thema gewesen. Von dort waren im Vorfeld Bedenken laut geworden, Trump könnte im Handelskonflikt mit China der Inselrepublik die Unterstützung entziehen.
Xi soll Trump nach dessen früheren Angaben zugesichert haben, während Trumps Amtszeit nicht in Taiwan einzumarschieren. Neue Waffenlieferungen an Taipeh hat der US-Präsident bisher indes nicht genehmigt. Laut „Washington Post“ verweigert er Militärhilfen über 400 Millionen Dollar.
F-16-Kampfjets und Kriegsschiffe
Dabei sind die USA seit Langem der Garant der Verteidigungsfähigkeit Taiwans – unter anderem durch die Lieferung von F-16-Kampfjets und Kriegsschiffen. Chinas Streben nach immer mehr Macht im Südchinesischen Meer und im gesamten Indopazifik ist den USA grundsätzlich ein Dorn im Auge.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth warnte im Juni 2025 vor einem chinesischen Angriff auf Taiwan. Es gebe „klare und glaubhafte“ Hinweise auf militärische Vorbereitungen. Xi habe seinem Militär befohlen, bis 2027 einsatzbereit für eine Invasion zu sein. Peking reagierte mit scharfer Kritik und warf Hegseth „Kalte-Kriegs-Mentalität“ und Verleumdung vor. Klar ist: Taiwans Sicherheit wird maßgeblich vom Verhältnis der beiden Großmächte zueinander bestimmt.
bth