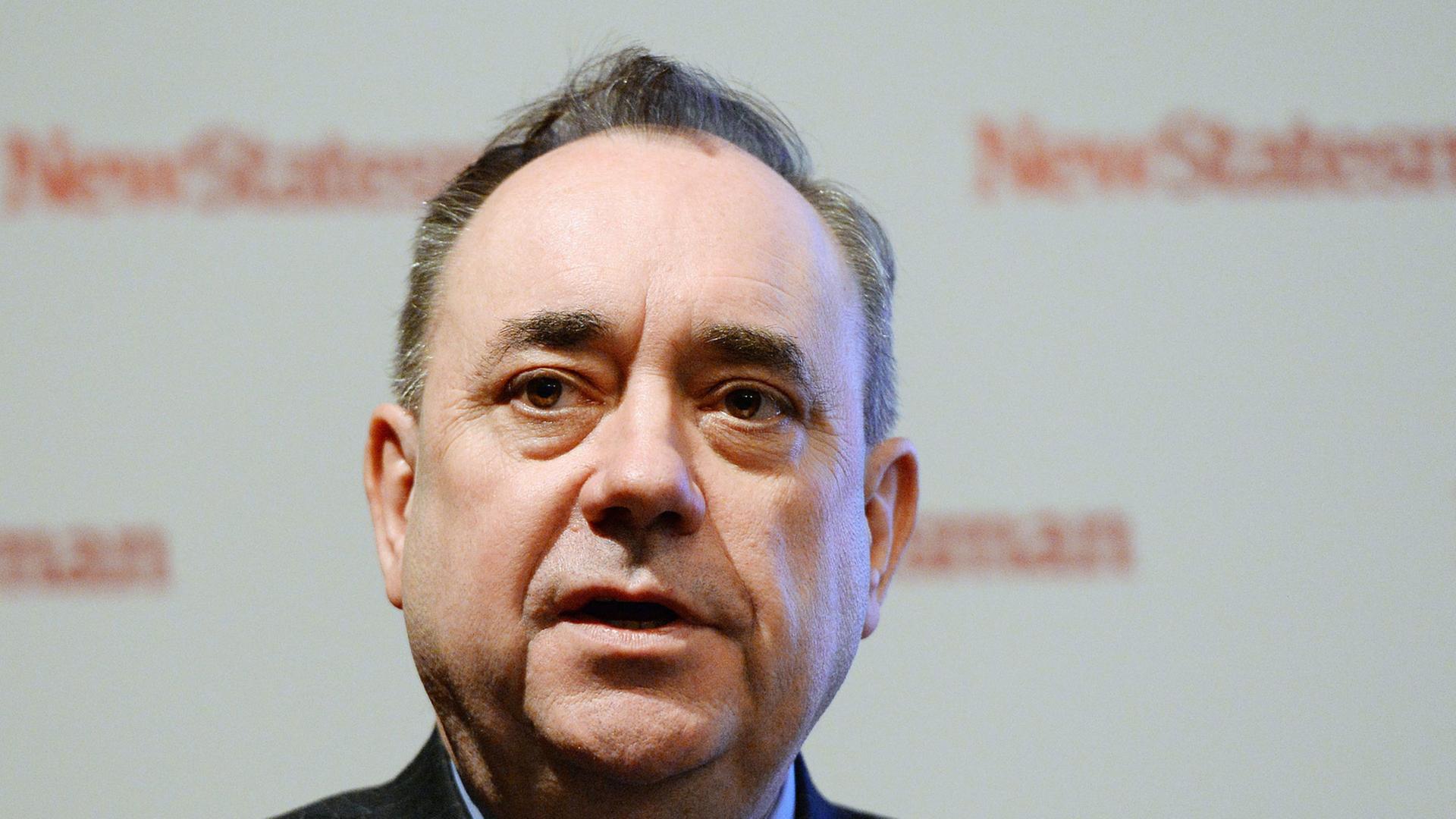Rona Munro beginnt ihre James-Trilogie wie eine Chronik, Bänkelsänger tragen eine Ballade vor. In der Ballade wird der Inhalt der Trilogie vorausgenommen – und die Perspektive angedeutet, aus der erzählt wird: Rona Munro schlägt, wie immer in ihren Stücken, den Ton des Volkstheaters an, die Ballade erinnert an Brecht.
Rona Munros "James-Trilogie" spielt im 15. Jahrhundert, die Politik der Stuarts ist das Hauptthema. Im ersten Teil steht James I. im Mittelpunkt – in seinem Leben spiegelt sich die prekäre Lage Schottlands. Als Prinz wurde der erst 13-jährige James gefangen genommen, er wurde König der Schotten in einem englischen Gefängnis. 18 Jahre später konnte er nach Edinburgh zurückkehren - er hatte eine neue Braut - eine englische.
Schottland war bitter arm, die Schatzkammer leer - und die Lage der Nation typisch: Die Aristokraten kämpften untereinander um die Vorherrschaft und warteten nur auf ein Zeichen der Schwäche, um den König anzugreifen. James I. versucht, das Land zu einen, um den Schotten Voraussetzungen für ein Mindestmaß von Autonomie zu schaffen.
Im Mittelteil wird James der II. als Knabe gekrönt, der neue König ist acht Jahre alt, eine leichte Beute der einflussreichen Familien: Wer den König unter der Fuchtel hat, hat die Macht. Zügelloser Egoismus, ruchloses Gewinnstreben und blutige Verbrechen ruinieren Schottland.
Im Schlussteil spielen Frauen die Hauptrolle, James III. hat eine Dänin geheiratet, die Geld ins Land bringt, eine kluge Frau, die auch Politik macht. Der König ist ein Mann mit Geschmack und Eleganz – er neigt dazu, Geld auszugeben, das er nicht hat. Das gab es immer und gibt es auch in unserer Epoche, James' Hedonismus wird als krasser Anachronismus präsentiert, der König spricht die Sprache von heute - das Publikum reagiert:
"That was not right. A fucking last coin tender and a fucking shit."
Könige sind selbst Teil des Problems
Laurie Sansom, der künstlerische Leiter des schottischen Nationaltheaters, arbeitet in seiner Uraufführungsinszenierung ganz im Sinne der Autorin heraus, dass die Könige überfordert waren, alle drei. Sie vermochten die schwierige politische Situation ihres armen Landes nicht einmal wirklich zu erfassen, geschweige denn, die grundsätzlichen Probleme zu lösen - sie waren selbst Bestandteil des Problems. Sansom hat brillante Regieideen. So lässt er zum Beispiel den Knabenkönig James II. von einer handgeführten, lebensgroßen Puppe spielen – sie macht den Marionettencharakter des kleinen Monarchen unmittelbar sinnfällig.
Die Inszenierung, getragen vom spielfreudigen Ensemble des schottischen Nationaltheaters, arbeitet die Vielschichtigkeit des Textes heraus: Rona Munro hat der historischen Ebene eine Analyse der fortdauernden und gegenwärtigen Schwierigkeiten Schottlands eingeschrieben. Rona Munros Quintessenz ist unmissverständlich: Seid einig, einig, einig, ruft die Dramatikerin ihren Landsleuten von der Bühne aus zu - und plädiert für Nüchternheit. Niemand sollte glauben, dass alle Probleme von heute auf morgen gelöst wären, wenn Schottland unabhängig würde. Auf alte Abhängigkeiten folgen neue.
Auf der Produktionsebene zeigen die Theaterleute ein Beispiel für produktive Gemeinsamkeit. Das gab es noch nie: Das schottische Nationaltheater arbeitet nicht nur mit dem Edinburgh International Festival zusammen, sondern auch mit dem Royal National Theatre in London, dem Flaggschiff britischer Bühnen. Die Londoner, nicht gerade für ihre Bescheidenheit berühmt, treten höflich zurück, die Uraufführung findet in Edinburgh statt - und wird in London nachgespielt.
So könnte eine produktive Kooperation auch in politischen Bereichen aussehen.
So könnte eine produktive Kooperation auch in politischen Bereichen aussehen.
Ein langer, großer, außergewöhnlicher Theatertag in Edinburgh, schottisch-englische, britische Zusammenarbeit am Firth of Forth.