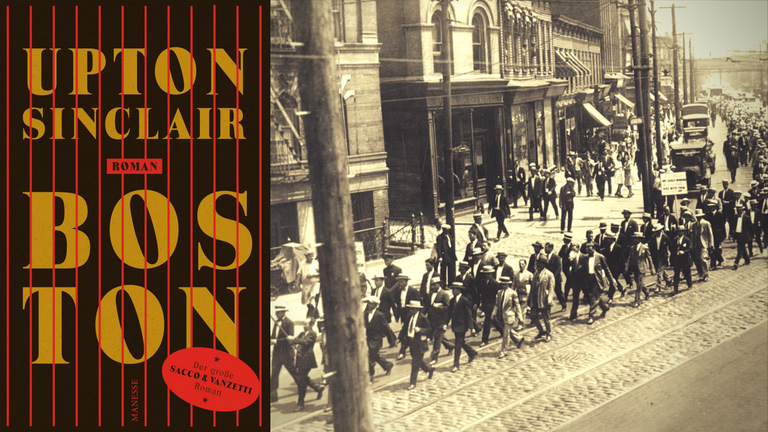Der 1885 in einer Kleinstadt im Mittleren Westen geborene Sinclair Lewis gehörte zu jener Generation amerikanischer Schriftsteller, die in ihren Romanen soziale Missstände der industriellen Gesellschaft und die moralische Verwahrlosung des prosperierenden Bürgertums darstellten. Doch im Vergleich zu seinem unwesentlich älteren Zeitgenossen Upton Sinclair war Lewis subtiler in der Wahl seiner Mittel, weniger kolportagehaft in seinem Stil und eleganter in der Zeichnung seiner Charaktere.
Lewis verfügte über einen unsteten Geist; er war ein hochbegabter Exzentriker, der sich in jungen Jahren durch Europa treiben ließ, später als Privatsekretär von Jack London arbeitete, bevor 1912 sein erster Roman "Hyke and the Aeroplane" erschien, der zunächst aber niemanden interessierte. Erst mit "Main Street" landete Sinclair Lewis im Jahr 1920 einen Publikumserfolg, der von dem zwei Jahre später erschienenen "Babbitt" noch übertroffen wurde.
"Babbitt", so auch der Name des Protagonisten, ist in den USA zu einer geradezu ikonischen Figur geworden, zu einem Sinnbild der Durchschnittlichkeit, in dem sich der amerikanische Way of Life wie in einem Prisma bündelt und in all seinen Facetten kenntlich machen lässt. Es ist kein Zufall, dass John Updike knapp 40 Jahre später seinem Protagonisten Harry Angstrom den Spitznamen "Rabbit" gab und in seiner kritischen Zeitdiagnostik bewusst an Sinclair Lewis’ Protagonisten anknüpfte. Als Sinclair Lewis 1930 als erster US-amerikanischer Autor mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, betonte das Komitee, dass es vor allem der "Babbitt"-Roman war, der zu dieser Entscheidung geführt hat.
Das exzessive Leben, das Sinclair Lewis geführt hat, begann schon früh seine Spuren zu hinterlassen. Seine erste Ehe scheiterte; seine zweite Ehe mit der Journalistin Dorothy Thompson hielt nur, weil sie unendliche Geduld für die Eskapaden ihres Mannes aufbrachte und sogar als Lewis’ Sekretärin fungierte, wenn seine zitternden Finger die Tastatur der Schreibmaschine nicht mehr trafen. Sinclair Lewis starb 1951 in Rom an den Folgen seiner Alkoholabhängigkeit.
Nun hat der Manesse Verlag "Babbitt", den bekanntesten von Lewis’ insgesamt 21 Romanen, in einer ausgezeichneten Neuübersetzung von Bernhard Robben neu aufgelegt. Christoph Schröder hat "Babbitt" gelesen und stellt uns den Roman als Buch der Woche im Deutschlandfunk vor.
An einem Frühlingsmorgen des Jahres 1920 lernen wir ihn kennen, den amerikanischen Jedermann George F. Babbitt, wie er sich aus seinem Bett auf der Schlafveranda seines im Kolonialstil erbauten Hauses erhebt und sich anschickt, sein Tagwerk zu verrichten. Ein pummeliger Mann von 46 Jahren mit rosiger Gesichtshaut, spärlichem Haar, Pausbacken und Nickelbrille.
Wie eine Kamera begleitet Sinclair Lewis Babbitt bei all seinen Verrichtungen und in all seinen Gedanken. Bei seinem Ärger über die schmuddelige Badematte und den patschnassen Fußboden, den seine Tochter ihm im Badezimmer hinterlassen hat. Bei der ersten Unerhörtheit des Morgens, die darin besteht, dass Babbitt es tatsächlich wagt, sich das Gesicht nach dem Rasieren mit dem Gästehandtuch abzutrocknen; einem Accessoire, das dort hängt, um zu zeigen, dass man zur besseren Gesellschaft gehört.
Bei den langatmigen Gesprächen mit seiner Frau Myra und den drei Kindern Verona, Theodore Roosevelt, genannt Ted, und Tinka.
Als Leser werden wir Zeuge einer mit Kalkül in allen Banalitäten geschilderten Aneinanderreihung von kleinen Ärgernissen und Ritualen, an deren Ende die geglückte Herstellung eines repräsentativen Bildes steht. George F. Babbitt ist gerüstet und bereit für die große Welt:
"Äußerlich bot er den Anblick des perfekten Geschäftsmannes auf dem Weg ins Büro – wohlgenährt, mit untadeligem braunen Filzhut, randloser Brille, großer Zigarre im Mund und auf vorstädtischer Schnellstraße am Steuer eines passablen Wagens. In ihm aber schlummerte eine aufrichtige Liebe für sein Viertel, für seine Stadt und seinesgleichen. Der Winter war vorüber und die Zeit fürs Bauen gekommen, für sichtbares Wachstum; für Babbitt gab es nichts Schöneres. Die morgendliche Depression verflog, und er verbreitete rotwangigen Frohsinn."
Was Erfolg hat, ist gut
Babbitts Beruf und der Schauplatz des Romans stehen in enger Verbindung. Zenith heißt die heimliche zweite Protagonistin, eine fiktive Stadt im Mittleren Westen, rund 300.000 Einwohner groß. Lewis schildert Zenith als ein urbanes Gebilde inmitten eines Epochenwandels und gleichzeitig, der Name ist Programm, auf dem vorläufigen Höhepunkt einer Entwicklungsstufe. Die alten, schindelgedeckten und lehmfarbenen Häuser verfallen, verschwinden nach und nach und machen dem Fortschritt Platz, den Wolkenkratzern mit ihren imposanten Silhouetten, den blanken Türmen des Kapitalismus. Zugleich entstehen auf den Hügeln rund um die Stadt die Vorortsiedlungen der Wohlhabenden, wie beispielsweise Floral Heights; jenes Stadtviertel, in dem Babbitt selbst lebt.
In der Darstellung der Lebensumstände Babbitts ließ Sinclair Lewis, wie Michael Köhlmeier in seinem Nachwort erläutert, äußerste Akribie walten. Nicht nur, dass er die Stadt Zenith selbst präzise entwarf – Babbitts Wohnhaus zeichnete er gar aus mehreren Perspektiven auf Millimeterpapier nach, um das Babbitt-Universum beim Schreiben plastisch vor Augen zu haben.
Die infrastrukturellen Umbrüche in der Stadt betrachtet Babbitt mit Wohlgefallen. Er ist Immobilienmakler und betreibt gemeinsam mit seinem Schwiegervater ein erfolgreiches Büro. Und was Erfolg hat, ist gut. Von Beginn an erscheint Babbitt als ein furchterregend positivistisches Monstrum im harmlosen Gewand der Fortschrittsgläubigkeit.
Alles, das wird sich im weiteren Verlauf des Romans erweisen, wird in der Darstellung der Babbitt’schen Weltbetrachtung zunächst als Tatsache hin- und danach wieder in Frage gestellt. Lewis’ Blick heftet sich an seine mediokre Figur und deren Bemühungen um eine perfekte Außendarstellung, die wiederum nötig ist, um das Selbstbild aufrecht zu erhalten – und führt zugleich auch immer unkommentiert dessen Zerbröselung vor. Sehen wir Babbitt, dem Anerkennungssüchtigen, dabei zu, wie er sich als Gastgeber eines Abendessens zurechtmacht:
"Er hatte dabei Bilder von einem prachtvollen Speisesaal vor Augen, von Kristallglas, Kerzen, poliertem Holz, Spitze, Silber und Rosen. Mit solcherlei Gedanken an ein derart aufwendiges Unterfangen wie das anstehende Abendessen widerstand er der Verlockung, das gerüschte Frackhemd ein viertes Mal anzuziehen, entschied sich für ein gänzlich frisches Hemd, zog die schwarze Schleife straff und wischte sich mit dem Taschentuch über die schwarzen Lackschuhe. Zufrieden betrachtete er die silbernen, mit einem Granat besetzten Manschettenknöpfe und strich sich dann über die Fesseln, die von seidenen Socken aus stämmigen Babbitt-Stelzen in die eleganten Gliedmaßen eines Klubmitglieds verwandelt wurden."
200 Seiten für einen prototypischen Babbitt-Tag
Exakt 200 Seiten, also mehr als ein Viertel des Romans, braucht Sinclair Lewis, um einen prototypischen Babbitt-Tag vom Erwachen am frühen Morgen bis zum mühsamen Einschlafen am Abend zu schildern. Und keine einzige dieser Seiten ist langweilig oder überflüssig, weil jedes Detail seinen Platz und seine Funktion hat; weil jede noch so vermeintlich bedeutungslose Beschreibung einen Mosaikstein bildet, um das aggressive Geltungsbedürfnis Babbitts zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen.
Wenn er mit seinem Auto in Richtung Stadt fährt, pflegt Babbitt an der Straßenbahnhaltestelle einen wartenden Passagier mitzunehmen. Selbstverständlich nur, wenn dieser ordentlich gekleidet ist. Der einzige Zweck dieser nur scheinbar freundlichen Geste ist aber der, dem Mitfahrer die Qualitäten des eigenen Automobils vor Augen zu führen und ihn so lange zuzuquatschen, bis er froh ist, endlich am Ziel angekommen zu sein.
Die Komik des Romans ist vor allem im ersten Teil ein Produkt der Gnadenlosigkeit, mit der Babbitt seinen Erfolg vorzeigt. Und wenn er betont, dass es wichtig wäre, dass endlich einmal ein Geschäftsmann an der Spitze des Landes stünde, sind die Bezugslinien zur Gegenwart unübersehbar. Den Satz "Make America great" würde Babbitt sofort unterschreiben. Dazu passt, dass Babbitt zwar ein Mensch mit klaren moralischen Grundsätzen ist, dass er aber durchaus bereit dazu ist, in Bezug auf sich selbst diese Grundsätze nicht allzu streng auszulegen:
"Und dennoch war Babbitt ein tugendhafter Mensch. Er befürwortete die Prohibition, auch wenn er sich selbst nicht daran hielt, lobte die Gesetze gegen die Geschwindigkeitsübertretung, auch wenn er selbst immer wieder dagegen verstieß; er beglich seine Schulden, spendete für die Kirchengemeinde und das Rote Kreuz; außerdem hielt er sich ans Gängige und betrog nur in dem Maße, als es durch einschlägige Beispiele gerechtfertigt schien."
Das Faszinierende an diesem Roman und an seiner Hauptfigur ist die Ambivalenz, in der Sinclair Lewis sie angelegt hat. "Babbitt" trägt eindeutig satirische Züge, aber eben nur in einem begrenzten Maß. Die Satire erzeugt Typen, die sich durch Flachheit auszeichnen. George F. Babbitt aber, und das ist eine große Kunst, ist in seiner literarischen Darstellung und in den damit verbundenen Ausdrucksmöglichkeiten weder flach noch schematisch gezeichnet.
Schaffung und Selbstaufhebung wechseln sich ab
Sinclair Lewis führt seinen Protagonisten von Schauplatz zu Schauplatz, von Szene zu Szene. Und in jeder dieser Szenen wird deutlich, dass Babbitt ein Mensch ist, der sich selbst und sein eigenes Tun permanent selbst aufhebt, um sich im nächsten Moment wieder neu konstituieren zu müssen. Im Inneren tobt in Babbitt der Sturm des Selbstzweifels, der Unzufriedenheit über die Existenz, in die er sich selbst hineingenagelt hat. Seine Ehe? Sterbenslangweilig, wie Babbitt sich eingestehen muss, wenn er über seine Frau Myra und den Verlauf ihrer Beziehung nachdenkt:
"Sie wurde ihm, was man eine gute Ehefrau nennt, treu ergeben, arbeitsam und hin und wieder sogar fröhlich. Ihre dumpfe Abneigung gegen die enger gewordene Beziehung versprach anfangs, in heftige Leidenschaft umzuschlagen, doch erwartete sie nur gelangweilte Routine."
Das im Roman entwickelte Auseinanderklaffen zwischen Babbitts Selbstwahrnehmung als defizitär und der mühevollen Aufrechterhaltung seines Images als zukunftsorientierter Erfolgsmensch spiegelt sich vor allem in der Rhetorik, die Sinclair Lewis Babbitt in den Mund legt. Denn Babbitt, man mag es kaum glauben, gilt in Zenith als ein begabter und erfolgreicher Redner.
Er meldet sich zu Wort und wird gehört – sei es in den Versammlungen der Immobilienmakler, sei es bei den Treffen der Mitglieder seines Clubs, oder sei es bei Wahlkampfveranstaltungen der Republikanischen Partei, der Babbitt, versteht sich, angehört. Stets spricht er in einem aufgeblasenen, von Floskeln durchsetzten Jargon des dünkelhaften Emporkömmlings. Babbitts Sprache ist ein jovial-männlicher Kumpelton, der Aufbruchsbereitschaft und Zupacken insinuiert, in Wahrheit aber nur bedeutungsheischend, pathetisch und leer ist:
"Meine Herren, mir scheint, als sollte uns jedes Jahr zu diesem Anlass, wenn Freund und Feind zusammenkommen, um das Kriegsbeil zu begraben und sich von den Wogen der Kameradschaft zu den blumigen Anhöhen des guten Einvernehmens hinauftragen zu lassen, ein Anliegen sein, als Bürger dieser besten Stadt der Welt Aug in Aug und Schulter an Schulter beieinander zu stehen, um uns einmal darüber klar zu werden, wie weit wir es gebracht haben, und dies sowohl hinsichtlich unserer selbst wie hinsichtlich des Allgemeinwohls."
Gefangen in seinem uneigentlichen Jargon
So kann das über Seiten gehen, und es ist faszinierend und quälend zugleich, einem Menschen dabei zuhören zu müssen, wie er im Dienst der vermeintlich guten Sache – Fortschritt, Wohlstand, Stadtentwicklung – aus seinem Jargon der Uneigentlichkeit nicht herausfinden kann, weil ihm nur das begrenzte Vokabular der Werbe- und Warenwelt zur Verfügung steht. Wie er das Leitbild des moralisch integren Amerikaners aufbaut, dem er selbst so verzweifelt zu entsprechen versucht. Was Sinclair Lewis an Babbitt vollzieht, ist quasi der selbstperformative Widerspruch der Darstellung eines reinen Klischees, die aber zu keinem Zeitpunkt klischeehaft geraten ist. Mit Verve und im Hinblick auf seine Umwelt auch mit autoritären Mitteln arbeitet Babbitt an der Vorstellung, das Bewusstsein durch das materiell abgesicherte Sein bestimmen zu können:
"Unser idealer Bürger: Zuallererst sehe ich da jemanden vor mir, der fleißiger ist als ein Biber, der seine wertvolle Zeit nicht mit Tagträumereien vergeudet oder über Dinge meckert, die ihn nichts angehen, sondern der seine ganze Schaffenskraft in einen Laden steckt. Er mäht den Rasen, spielt ein bisschen Golf, und dann ist auch schon Zeit fürs Abendessen. Anschließend erzählt er seinen Kindern eine Geschichte, geht mit der Familie ins Kino, liest die Abendzeitung oder ein, zwei Kapitel in einem guten, spannenden Western. Dann geht er zufrieden ins Bett, mit reinem Gewissen, hat er doch seinen Teil zum Gedeihen der Stadt und dem seines eigenen Bankkontos beigetragen."
Doch es gibt einen Menschen, zu dem Babbitt ein ganz spezielles, weniger auf Fassade getrimmtes, ja geradezu zärtliches Verhältnis pflegt: Sein Studienfreund Paul Riesling fungiert im Roman als Spiegel, in dem Babbitt die eigene Existenz zurückgeworfen sieht. Paul, der als Vertreter für Dachpappe arbeitet und ein unglückliches Leben an der Seite einer dauereifersüchtigen und dauerunzufriedenen Ehefrau führt, schießt eines Tages in einem spontanen Akt der Verzweiflung auf seine Frau. Und das ist auch genau der Augenblick, in dem Babbitts Koordinatensystem durcheinander gerät:
"Tags darauf wurde er zu drei Jahren in einem Staatsgefängnis verurteilt und abgeführt – ganz undramatisch und auch nicht in Handschellen, nur ein müde dahinstolpernder Mann neben einem gut gelaunten Deputy Sheriff – und nachdem Babbitt sich auf dem Bahnhof von Paul verabschiedet hatte, kehrte er in sein Büro zurück und begriff, dass er sich in einer Welt wiederfand, die ohne Paul bedeutungslos war."
Ausgerechnet Babbitt führt plötzlich ein Lotterleben
Spätestens Pauls Verurteilung markiert innerhalb des Romangefüges einen Bruch. Babbitts bis dahin in festen Grundsätzen verlaufendes Leben gerät aus dem Lot. Man würde das, was ihm widerfährt, heute möglicherweise schlicht mit dem Begriff "Midlife Crisis" abtun. Die Parameter verschieben sich, die Gewissheiten schwinden, die Selbstkontrolle geht verloren. Man könnte einwenden, dass der Umschwung, den Sinclair Lewis seinem Anti-Helden angedeihen lässt, möglicherweise ein wenig plötzlich und unmotiviert vor sich geht, doch wird am Ende des Romans auf verblüffende Weise deutlich, warum er nötig war. Babbitt also, der Meister der bürgerlichen Fassade, registriert nicht ohne Selbstekel die Risse in seiner Welt:
"Er wünschte sich... ach, er wünschte sich, einer dieser Lebemänner zu sein, von denen man so oft las. Studiopartys. Wilde Mädchen, hübsch und unabhängig. Nicht unbedingt verdorben. Nein, das sicher nicht! Aber auch nicht fade, nicht wie Floral Heights. Wie hatte er nur all die Jahre ..."
Ausgerechnet Babbitt, der Mensch gewordene Ausbund an demonstrativer Charakterstärke, beginnt, ein Lotterleben zu führen. Seine Ehefrau Myra lässt er großzügig für einige Zeit zu ihrer kranken Schwester fahren. Kaum ist sie weg, zettelt er eine Affäre mit der attraktiven Witwe Tanis Judique an. Die wiederum ist Teil einer Clique von Bohemiens, die Babbitt zunächst als eine lose Verbindung freiheitlich gesinnter Exzentriker erscheint – bis ihm klar wird, dass auch in diesen Kreisen klare Verhaltensmuster und strenge Regeln herrschen. Der Zwang zur Selbstdisziplin ist lediglich ausgetauscht gegen den Zwang zur Selbstentäußerung.
Das ist das wahrhaft Perfide und auch Erbarmungswürdige an der Babbitt-Figur: dass es für sie keinen Ausweg gibt und keine Rettung. Die Flucht in die Liberalität, die möglicherweise sogar authentisch sein könnte, wird gebremst von den ökonomischen Zwängen: Mit dem neuen Babbitt will keiner mehr Geschäfte machen.
Kurzzeitig entsteht der Eindruck, "Babbitt" könnte sich zu einem Entwicklungsroman auswachsen, doch das täuscht. Das Gegenteil ist der Fall: Sinclair Lewis schickt Babbitt in einem Ringschluss in die Hölle der Konformität zurück und lässt ihn entgegen seiner ursprünglichen Weigerung zum Mitglied in der Liga der anständigen Bürger werden. Als seine Ehefrau Myra nach ihrer Rückkehr plötzlich krank wird und operiert werden muss, lässt Lewis seinem Babbitt den nach Paul Rieslings Verurteilung zweiten, rückverwandelnden Schock der Erkenntnis zukommen:
"Und ein schwarzer Sturm erfasste Babbitt. Schlagartig verblasste all der Unwille, der ihn beherrscht und die durchlittenen Dramen bestimmt hatte und der ihm lachhaft erschien angesichts der uralten, überwältigenden Wirklichkeit, der gewöhnlichen, alltäglichen Realität von Krankheit und drohendem Tod. Er kroch zu seiner Frau zurück. Und während sie in der bleiernen Apathie des Morphiums dahindämmerte, saß er bei ihr am Bettrand und hielt ihre Hand; zum ersten Mal seit vielen Jahren ruhte ihre Hand vertrauensvoll in seiner."
Spezialform des rasenden Realismus
Es wäre ein Irrtum, Babbitts Rückkehr ins bürgerliche Leben als Resultat einer Läuterung zu betrachten. Vielmehr erscheint sein erneuter Sinneswandel als Produkt eines Systems, das im Autokorrekturmodus jede Abweichung als sinnlos oder unmöglich erscheinen lässt und eliminiert. Sollte es in Babbitt so etwas geben wie den vagen Glauben an einen Ausbruch aus der Unfreiheit, gibt er diesen Glauben an die kommende Generation, an seine drei Kinder weiter – allerdings ohne großes Zutrauen in deren emanzipatorische Kraft.
Lewis' in "Babbitt" angewandtes Verfahren lässt sich als eine spezielle Form des rasenden Realismus beschreiben. Hinter den Kulissen der geordneten und wiedererkennbaren Welt tobt die Ambivalenz zwischen der Einsicht in ein verfehltes Leben und der gleichzeitigen Einsicht in die Unabänderlichkeit dessen. Und so wechselt auch Lewis' Blick auf seine Figur sogar innerhalb einer Szene ständig zwischen Ernsthaftigkeit und Denunziation.
Wie verwirrend der Roman schon in den 20 er-Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA gewirkt haben muss, dokumentiert seine Rezeptionsgeschichte: Während die einen das Buch als scharfe Satire begriffen, prägten Unternehmervereinigungen in völliger Ironiefreiheit den Slogan "Dare to be a Babbitt" – wage es, ein Babbitt zu sein.
"Babbitt" ist also nicht nur ein hoch intelligenter und unterhaltsamer Roman und eine prächtige Charakterstudie. Darüber hinaus verfügt er über ein aufklärerisches Potential, das zum Verständnis gesellschaftlicher Prozesse bis heute erhellend ist. Dass Sinclair Lewis 1936 in dem Roman "It can't happen here" ein Szenario beschrieb, in dem es eine Donald Trump nicht unähnliche Figur zum amerikanischen Präsidenten bringt, spricht darüber hinaus für seinen visionären Blick auf die USA. "Ich liebe dieses Land", soll Lewis einmal gesagt haben, "aber ich kann es nicht leiden." Diese Gespaltenheit ist ihm im besten Sinne zum literarischen Programm geworden.
Sinclair Lewis: "Babbitt"
Aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Robben. Nachwort von Michael Köhlmeier
Manesse Verlag, München 2017. 782 Seiten, 28 Euro
Aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Robben. Nachwort von Michael Köhlmeier
Manesse Verlag, München 2017. 782 Seiten, 28 Euro