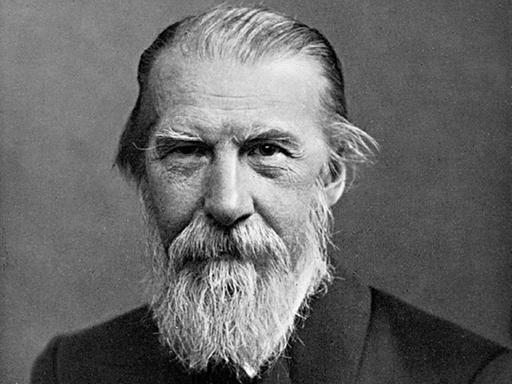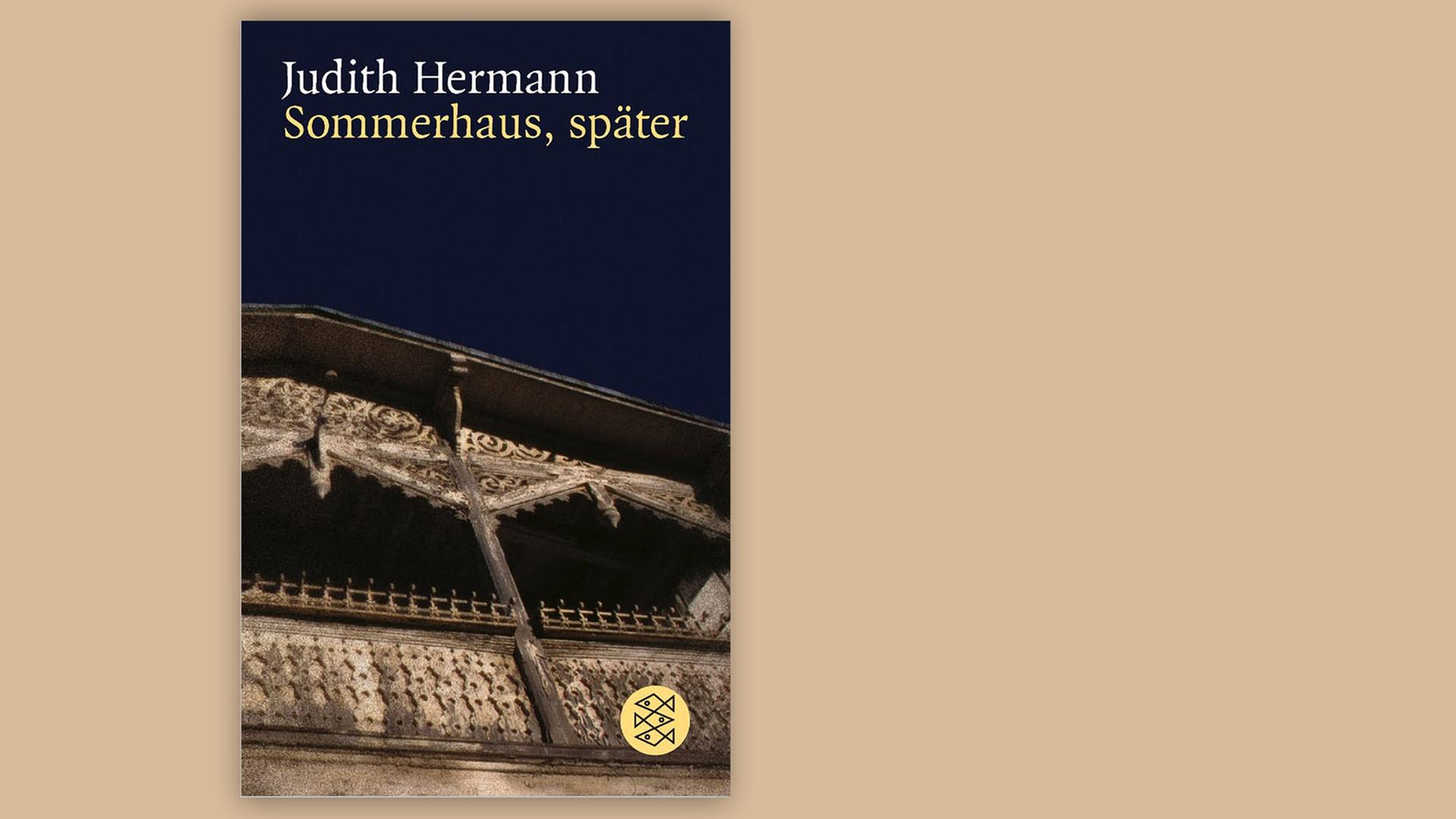Judith Hermanns „Wir hätten uns alles gesagt“ verdichtet das literarische Schaffen eines Vierteljahrhunderts. Zugleich öffnet und verwandelt es das Werk der 1970 geborenen Schriftstellerin, die 1998 mit ihrem Debüt „Sommerhaus, später“ bekannt wurde, auf faszinierende und unvermutete Weise.
Judith Hermann gibt in ihrem jüngsten Buch scheinbar Intimstes preis – über ihre Familie, über das Aufwachsen in einer düsteren Neuköllner Wohnung, über Gespräche mit ihrem Psychoanalytiker. Immerzu aber lässt sie das Erzählte ins Imaginäre kippen. So entsteht in „Wir hätten uns alles gesagt“ ein atmosphärisch dichter Schwebezustand, ein beständiges Changieren zwischen Realität und Fiktion, zwischen Zeigen und Verbergen, das kaum mehr aufzulösen ist – und das auch gar nicht aufgelöst werden soll.
Dieses Gespinst aus Verweisen und Motiven ist nicht nur mit ihrer eigenen Familiengeschichte und deren Versehrungen verbunden, es eröffnet auch einen Raum für die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Über das Schweigen und Verschweigen-Müssen
Nicht zufällig lässt Judith Hermann ihr poetologisches Verfahren des Verschiebens und Übertragens ihren vermeintlich langjährigen Psychoanalytiker erklären: „Was für eine unermüdliche Detailarbeit, alles so geschickt zu verfremden, zu entstellen, dass am Ende nichts mehr richtig ist, aber alles wahr.“
Judith Hermann hat in „Wir hätten uns alles gesagt“ weit mehr als Poetikvorlesungen geschrieben. Es sind Erzählungen über das Schweigen und Verschweigen-Müssen, über die Annäherung an das Unsagbare, das den Urgrund ihres Schreibens ausmacht – wenn nicht von Literatur und Kunst überhaupt.
„Wir hätten uns alles gesagt“ ist ein Buch, das beeindruckt durch die Vulnerabilität, die es offenbart, und das zugleich von großer Kraft ist: Denn das Vermögen von Judith Hermann besteht darin, das Nicht-Sagbare und die existenzielle Verunsicherung aufscheinen zu lassen, und ihnen im Erzählen eine sprachliche Form zu verleihen, die voller Anmut und von geradezu metaphysischem Trost ist.